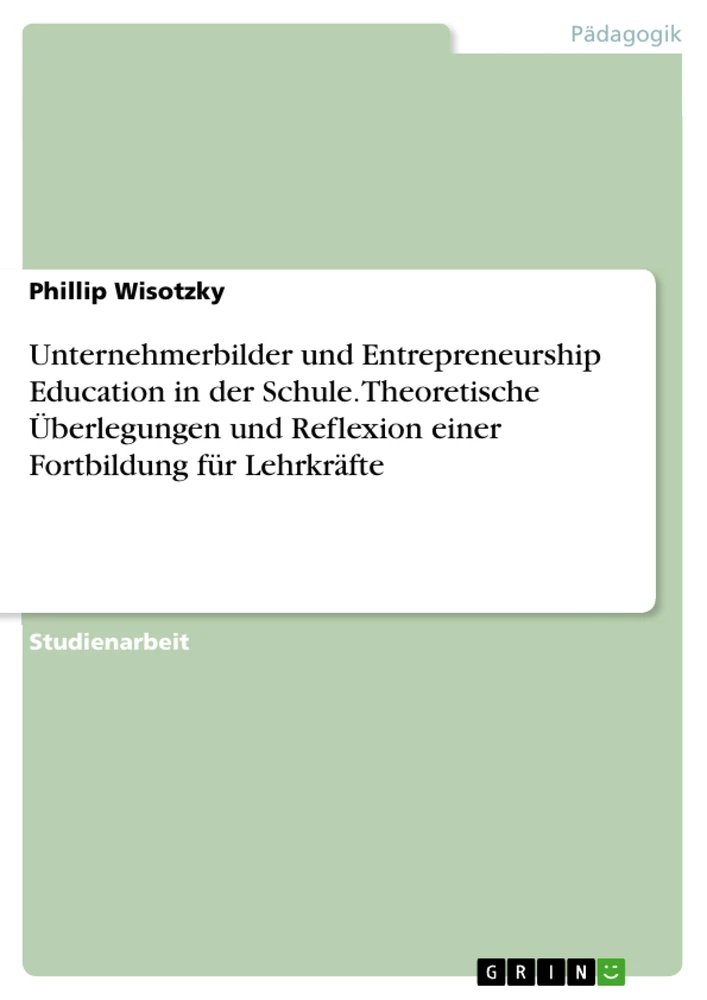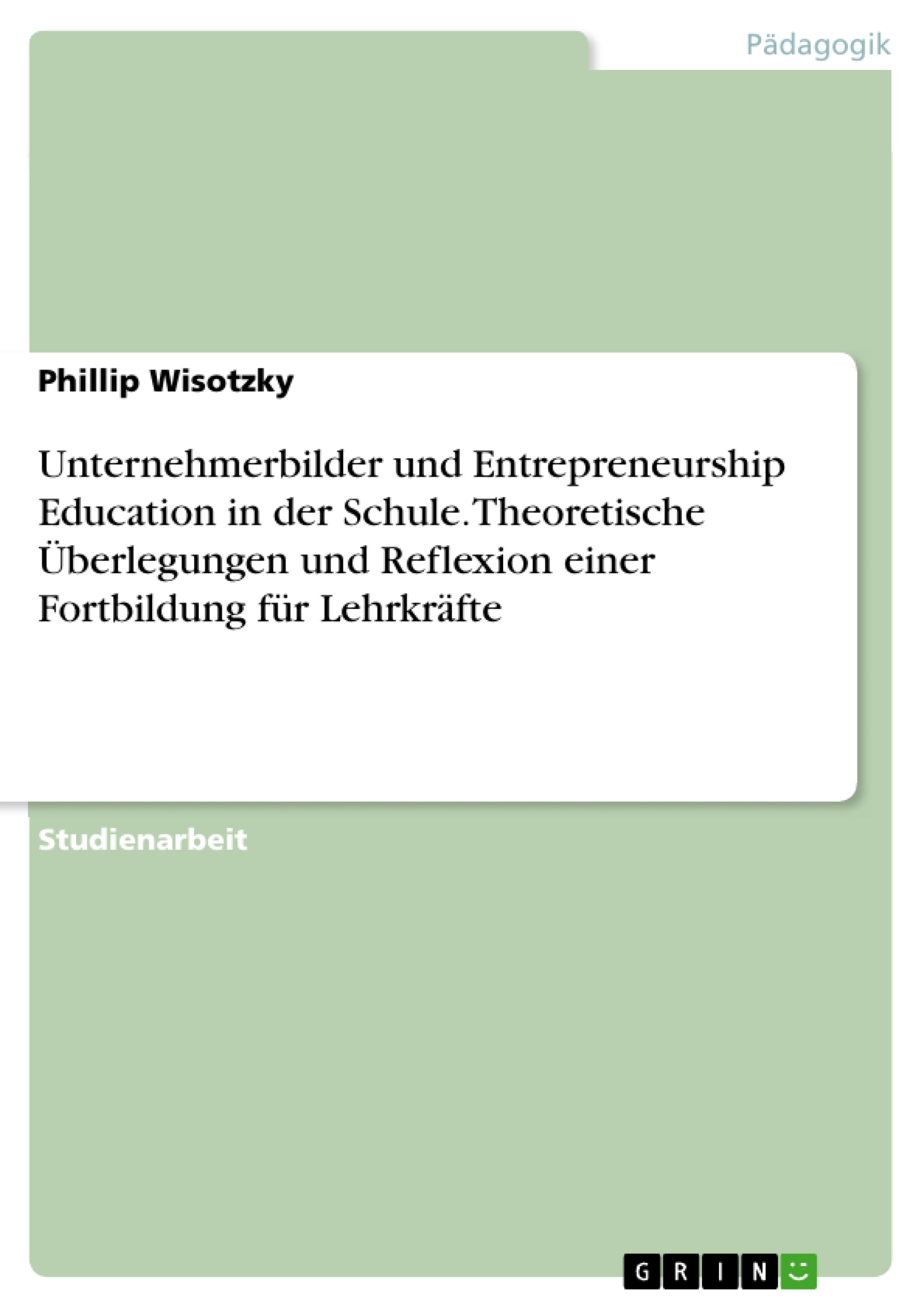In dieser Arbeit wird das Thema "Unternehmer*innenbilder" theoretisch beleuchtet und eine Diskussionsrunde zu dem Thema reflektiert. Der theoretische Teil gliedert sich zunächst in die Definitionen notwendiger Begrifflichkeiten, um anschließend auf Einflussfaktoren eingehen zu können. Das darauffolgende Kapitel wird sich dann konkret mit Unternehmer*innenbildern, -rollen sowie -eigenschaften in Deutschland befassen. Im Anschluss folgen einige Belege aus wissenschaftlichen Beiträgen und Studien, um die gewonnen Erkenntnisse zu untermauern.
Im Rahmen einer schulinternen Lehrer*innenfortbildung wurde zum Thema "Entrepreneurship Education" tiefer zum wirtschaftlichen Interesse von Jugendlichen referiert und diskutiert. Am 26. April 2021 fand eine Onlinefortbildung zum Themenkomplex „Unternehmer*innenbilder“ statt. Besonders wichtig ist, dass die SuS erkennen, dass Unternehmer*innen sowie Unternehmen einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft darstellen. Lehrkräfte sollen dabei ein neutrales, fehlerfreies Bild, von Unternehmer*innen vermitteln sowie auch veraltete und festgefahrene Rollen aufbrechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 3 Das Bild der Unternehmer*innen und ihre Einflussfaktoren
- 4 Das Unternehmer*innenbild in Deutschland
- 4.1 Die fünf Unternehmer*innenbilder nach Wolfgang Zimmermann
- 4.2 Eigenschaften von Unternehmer*innen (Studie FOG‐Institut für Markt‐und Sozialforschung)
- 4.3 Das Unternehmer*innenbild der SuS
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Projektbericht dokumentiert eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema Entrepreneurship Education mit dem Fokus auf Unternehmer*innenbilder. Ziel ist es, Lehrkräften ein differenziertes Verständnis von Unternehmer*innenbildern zu vermitteln, um Schülern einen realistischen und kritischen Einblick in die Unternehmerwelt zu ermöglichen. Die Fortbildung soll dazu beitragen, veraltete Klischees aufzubrechen und ein neutrales Bild zu fördern.
- Definition und Charakterisierung von Unternehmer*innenbildern
- Einflussfaktoren auf die Bildung von Unternehmer*innenbildern (direkte und indirekte Erfahrungen)
- Analyse verschiedener Unternehmer*innenbilder in Deutschland (nach Zimmermann)
- Auswertung empirischer Studien zum Unternehmer*innenbild (FOG-Institut, Südtiroler Jugendstudie)
- Reflexion der Ergebnisse der Lehrerfortbildung und Implikationen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet das bestehende Interesse Jugendlicher an wirtschaftlichen Themen und die Unzufriedenheit mit der schulischen Wirtschaftsbildung. Sie führt in die schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema "Entrepreneurship Education" und den Schwerpunkt "Unternehmer*innenbilder" ein. Der Bericht soll die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema und die anschließende Diskussion reflektieren, beginnend mit Definitionen wichtiger Begriffe und der Analyse von Einflussfaktoren auf das Unternehmer*innenbild.
2 Definitionen: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe. Die Definition von "Unternehmer*in" wird aus dem italienischen Zivilgesetzbuch hergeleitet und durch positive Merkmale der wirtschaftlichen Tätigkeit ergänzt (Herstellung von Waren, Risikobereitschaft, Selbstständigkeit, Verfügungsrechte über Produktionsfaktoren). Der Unterschied zwischen "Unternehmer*innenbild" und "Unternehmer*innenimage" wird erläutert, wobei beide die öffentliche und persönliche Meinung zu Unternehmer*innen beinhalten, sich aber in der Zuordnung von Aufgaben und Funktionen sowie Abgrenzung zu Nicht-Unternehmer*innen unterscheiden.
3 Das Bild der Unternehmer*innen und ihre Einflussfaktoren: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die das Bild von Unternehmer*innen prägen. Es unterscheidet zwischen direkten (persönliche Erfahrungen) und indirekten (Medien, Erzählungen) Einflussfaktoren. Arbeitserfahrungen, soziographische Eigenschaften (Alter, Bildung, soziales Umfeld) und die Distanzhypothese von Schmölders (Unternehmerfern- und -nahbild) werden als prägende Elemente diskutiert. Das Unternehmerfernbild wird als abstrakter Stereotyp beschrieben, während das Nahbild durch persönliche Erfahrungen differenzierter und positiver ausfällt.
4 Das Unternehmer*innenbild in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert das deutsche Unternehmer*innenbild anhand verschiedener Perspektiven. Es präsentiert zunächst die fünf Unternehmer*innenbilder nach Wolfgang Zimmermann (Sozialreformer, Tüftler, risikobereite Spielernatur, ehrbarer Kaufmann, Familienunternehmer), die jeweils mit spezifischen Eigenschaften charakterisiert werden. Anschließend werden Ergebnisse der Studie des FOG-Instituts für Markt- und Sozialforschung aus dem Jahr 2017 vorgestellt, die positive Eigenschaften wie zielorientiert, erfolgreich und fleißig hervorhebt, aber auch Aspekte wie gewinnorientiert und reich benennt. Eine interne Lehrer*innenumfrage zeigt ähnliche Ergebnisse. Schließlich werden Ergebnisse der Südtiroler Jugendstudie aus dem Jahr 2014 präsentiert, die ein überwiegend positives Bild von Unternehmer*innen bei Jugendlichen aufzeigt, aber auch den geringen Einfluss von Schule und Lehrkräften auf diese Bildbildung offenbart.
Schlüsselwörter
Entrepreneurship Education, Unternehmer*innenbilder, Einflussfaktoren, Unternehmer*innenimage, FOG-Institut, Südtiroler Jugendstudie, Wolfgang Zimmermann, Wirtschaft, Schulbildung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Stereotype, gesellschaftliche Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zum Projektbericht: Unternehmer*innenbilder in der Entrepreneurship Education
Was ist der Gegenstand dieses Projektberichts?
Der Bericht dokumentiert eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema Entrepreneurship Education mit dem Fokus auf Unternehmer*innenbilder. Ziel ist es, Lehrkräften ein differenziertes Verständnis von Unternehmer*innenbildern zu vermitteln, um Schülern einen realistischen und kritischen Einblick in die Unternehmerwelt zu ermöglichen und veraltete Klischees aufzubrechen.
Welche Themen werden im Bericht behandelt?
Der Bericht behandelt die Definition und Charakterisierung von Unternehmer*innenbildern, Einflussfaktoren auf deren Bildung (direkte und indirekte Erfahrungen), die Analyse verschiedener Unternehmer*innenbilder in Deutschland (nach Zimmermann), die Auswertung empirischer Studien (FOG-Institut, Südtiroler Jugendstudie) und die Reflexion der Ergebnisse der Lehrerfortbildung und deren Implikationen für den Unterricht.
Welche Kapitel umfasst der Bericht?
Der Bericht gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definitionen, Das Bild der Unternehmer*innen und ihre Einflussfaktoren, Das Unternehmer*innenbild in Deutschland und Fazit. Die Einleitung beleuchtet das Interesse Jugendlicher an wirtschaftlichen Themen und die Unzufriedenheit mit der schulischen Wirtschaftsbildung. Kapitel 2 klärt grundlegende Begriffe wie "Unternehmer*in" und den Unterschied zwischen "Unternehmer*innenbild" und "Unternehmer*innenimage". Kapitel 3 untersucht Einflussfaktoren auf das Bild von Unternehmer*innen (direkte und indirekte Erfahrungen). Kapitel 4 analysiert das deutsche Unternehmer*innenbild anhand verschiedener Perspektiven (Zimmermann, FOG-Institut, Südtiroler Jugendstudie). Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Definition von "Unternehmer*in" wird verwendet?
Die Definition von "Unternehmer*in" wird aus dem italienischen Zivilgesetzbuch hergeleitet und durch positive Merkmale der wirtschaftlichen Tätigkeit ergänzt (Herstellung von Waren, Risikobereitschaft, Selbstständigkeit, Verfügungsrechte über Produktionsfaktoren).
Wie unterscheiden sich "Unternehmer*innenbild" und "Unternehmer*innenimage"?
Beide beinhalten die öffentliche und persönliche Meinung zu Unternehmer*innen, unterscheiden sich aber in der Zuordnung von Aufgaben und Funktionen sowie der Abgrenzung zu Nicht-Unternehmer*innen.
Welche Einflussfaktoren auf das Unternehmer*innenbild werden betrachtet?
Es werden direkte (persönliche Erfahrungen) und indirekte (Medien, Erzählungen) Einflussfaktoren unterschieden. Arbeitserfahrungen, soziographische Eigenschaften (Alter, Bildung, soziales Umfeld) und die Distanzhypothese von Schmölders (Unternehmerfern- und -nahbild) werden diskutiert.
Welche Unternehmer*innenbilder nach Wolfgang Zimmermann werden vorgestellt?
Der Bericht präsentiert die fünf Unternehmer*innenbilder nach Wolfgang Zimmermann: Sozialreformer, Tüftler, risikobereite Spielernatur, ehrbarer Kaufmann und Familienunternehmer, jeweils mit spezifischen Eigenschaften charakterisiert.
Welche empirischen Studien werden ausgewertet?
Die Ergebnisse der Studie des FOG-Instituts für Markt- und Sozialforschung (2017) und der Südtiroler Jugendstudie (2014) werden vorgestellt und analysiert.
Welche Ergebnisse zeigen die empirischen Studien?
Die Studie des FOG-Instituts hebt positive Eigenschaften wie zielorientiert, erfolgreich und fleißig hervor, aber auch Aspekte wie gewinnorientiert und reich. Die Südtiroler Jugendstudie zeigt ein überwiegend positives Bild von Unternehmer*innen bei Jugendlichen, aber auch den geringen Einfluss von Schule und Lehrkräften auf diese Bildbildung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bericht?
Schlüsselwörter sind: Entrepreneurship Education, Unternehmer*innenbilder, Einflussfaktoren, Unternehmer*innenimage, FOG-Institut, Südtiroler Jugendstudie, Wolfgang Zimmermann, Wirtschaft, Schulbildung, Schüler*innen, Lehrkräfte, Stereotype, gesellschaftliche Wahrnehmung.
- Quote paper
- Phillip Wisotzky (Author), 2020, Unternehmerbilder und Entrepreneurship Education in der Schule. Theoretische Überlegungen und Reflexion einer Fortbildung für Lehrkräfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1163521