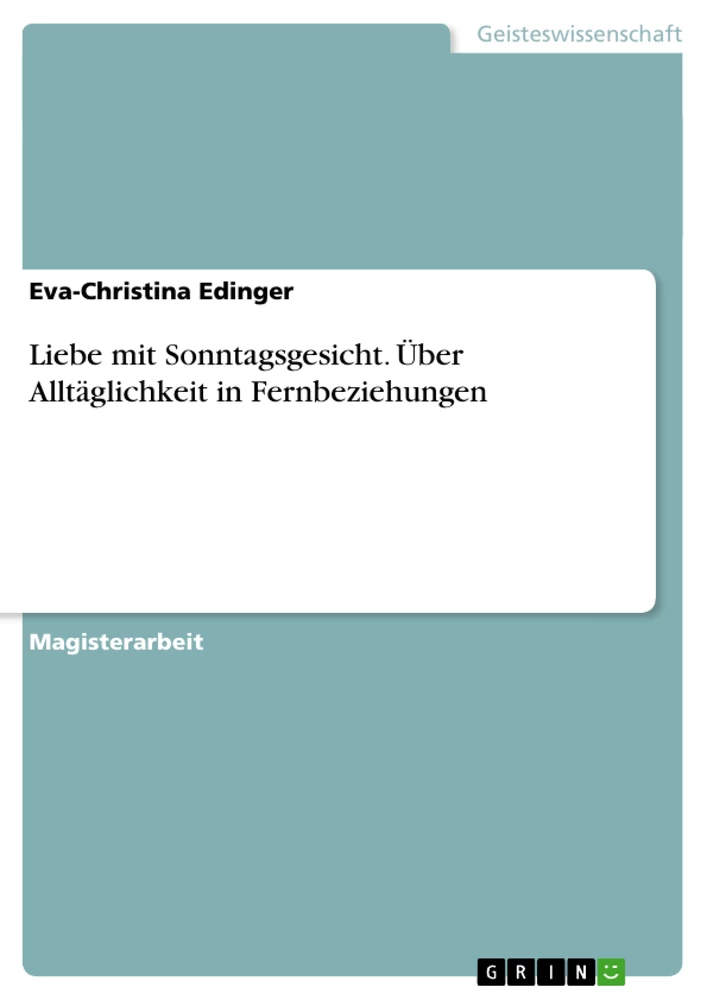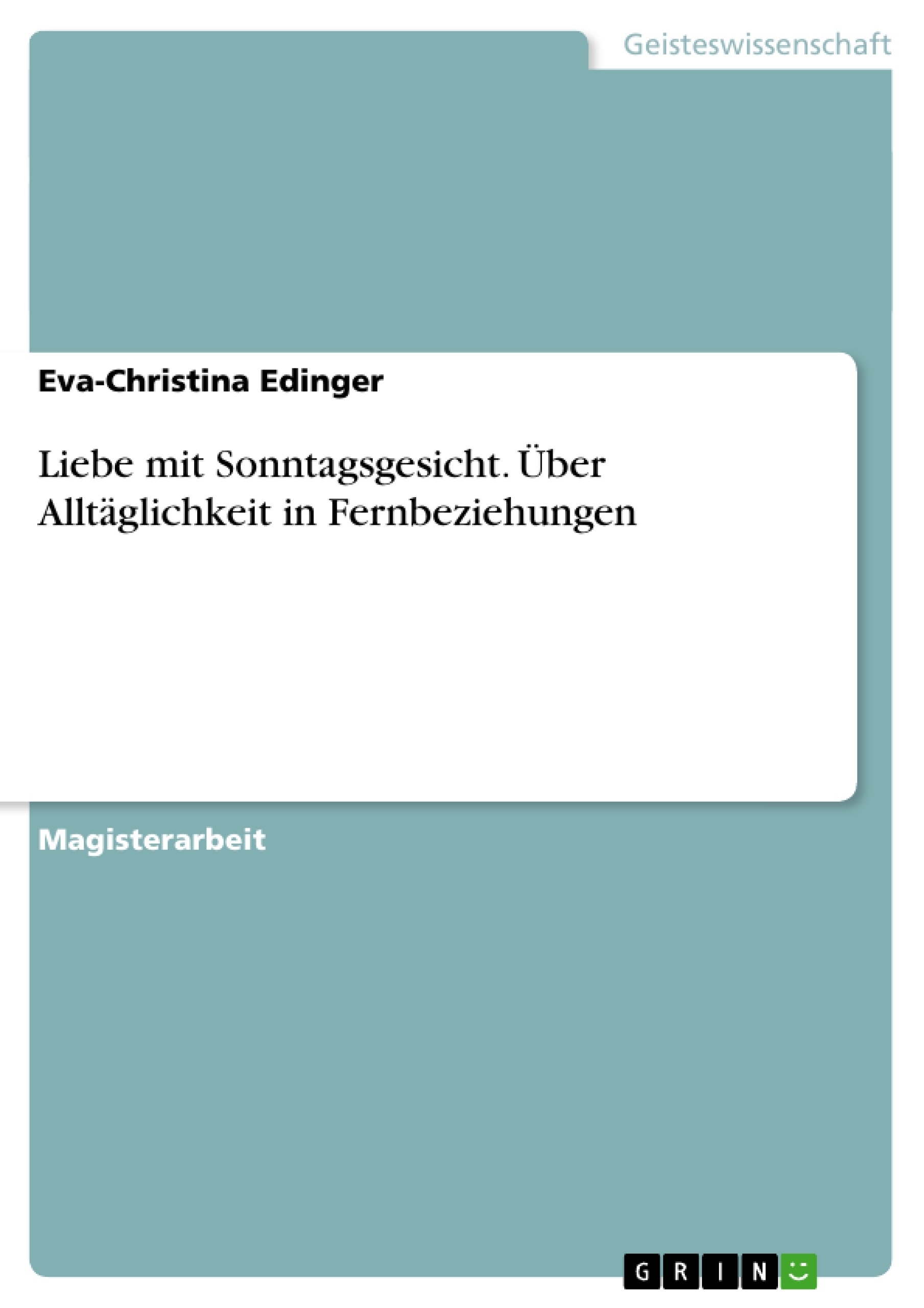Fernbeziehungen stellen nicht nur ein Teilphänomen diverser soziologischer Forschungsgegenstände dar, sondern werfen auch im Rahmen einer Monographie ein großes Spektrum an elementaren Forschungsfragen auf. Die vorliegende Arbeit widmet sich zunächst der grundlegend notwendigen Begriffsklärung im Bereich der Paarbeziehungs-Semantik. Darauf folgt ein Überblick über einschlägige Forschungsergebnisse bisheriger Untersuchungen, besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Aspekte Mobilität, Bildungsexpansion und Individualisierung gelegt.
Mit Hilfe eines qualitativen Forschungsdesigns werden vergleichbare Strukturen, aber auch Unterschiede innerhalb der Partnerschaften näher untersucht. Besonderen Stellenwert erhält hierbei der Entscheidungsprozess, den Paare durchlaufen, bevor sie sich zu einer Beziehung auf Distanz entschließen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Berufstätigkeiten der Partner, die berufliche Motivation und individuelle Karriereziele. Des Weiteren wird kritisch hinterfragt, ob Fernbeziehungen vor allem aus der (vermeintlichen) gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hin zu vermehrter Individualisierung entstehen. Die Diskussion über Lebensform vs. Lebensphase wird anhand der untersuchten Paare neu belebt und überprüft.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt die Markierung der Polarität innerhalb von Fernbeziehungen: Einer der beiden Wohnorte wird betont und erhält in einigen Fällen sogar die Bedeutung des gemeinsamen Hauptwohnsitzes. Im Zusammenhang mit der Polarität rückt die Frage nach der Entstehung von Alltäglichkeit und Alltagsrhythmus in den Vordergrund.
Einen speziellen Teilaspekt stellt die Frage nach Ambivalenzen in Fernbeziehungen dar. Ausgehend von der bereits ambivalenten Begrifflichkeit zur Bezeichnung von intimen, sehr durch Nähe geprägten Paarbeziehungen, deren offensichtliches Merkmal hier jedoch die Distanz ist, wird untersucht, welchen Einfluss die Spannungsfelder Beruf – Privatleben, Verwurzelung am eigenen Wohnort – am Wohnort des Partners sowie Individuum – Dyade auf die Gestaltung und das subjektive Erleben der Partnerschaften ausüben. Im Rückbezug auf die Phänomene Mobilität und Individualisierung lassen die Ambivalenz-spezifischen Ergebnisse Rückschlüsse zu, in wie weit Fernbeziehungen als Lebensform von den Betroffenen aktiv selbst gewählt sind bzw. in welchen Hinsicht eine Partnerschaft auf Distanz für manche Paare eine Notlösung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Theoretischer und empirischer Bezugsrahmen
- Definition und Explikation wichtiger Begriffe
- Begriffsklärungen aus der Paarbeziehungs-Semantik
- Explikation und Definition des Begriffs Fernbeziehung
- Gründe und Ursachen für Fernbeziehungen
- Bildungsexpansion
- Mobilität
- Individualisierte Lebensführung
- Neue Wege der Partnersuche
- Blick in die Forschungslandschaft
- Folgerungen
- Definition und Explikation wichtiger Begriffe
- Fragestellung und Forschungsdesign
- Fragestellungen
- Feldzugang und Entwicklung der Forschungsinstrumente
- Erhebungsplanung und Auswahl der Paare
- Der Leitfaden und die Objektive Daten Maske
- Angewendete Verfahren zur Datenanalyse
- Empirische Befunde
- Die Fallanalysen
- Zusammenhänge
- Entscheidungskriterien für das Eingehen von Fernbeziehungen
- Polarität und Haushaltsintegration
- Fernbeziehung als Ideal in Phasen erhöhter Berufskonzentration
- Berufliche und finanzielle Sicherheit
- Herstellung von Alltäglichkeit in Fernbeziehungen
- Zusammenfassung und Bilanz der empirischen Befunde
- Fernbeziehung in Folge von Individualisierung und Erlebnisgesellschaft?
- Lebensphase oder Lebensform?
- Ambivalenztheoretische Überlegungen
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Fernbeziehung aus empirischer Perspektive. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die alltäglichen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien von Paaren in Fernbeziehungen zu entwickeln. Die Studie analysiert verschiedene Aspekte, die zu Fernbeziehungen führen und wie diese Beziehungen gestaltet werden.
- Definition und Herausforderungen von Fernbeziehungen
- Ursachen und soziologische Hintergründe von Fernbeziehungen
- Alltagsbewältigung und -gestaltung in Fernbeziehungen
- Analyse spezifischer Fallbeispiele
- Einordnung der Fernbeziehung in den Kontext von Individualisierung und gesellschaftlichen Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Fernbeziehungen ein und hebt deren Forschungslücke hervor. Es wird darauf hingewiesen, dass Fernbeziehungen zwar bereits untersucht wurden, jedoch oft nur als Teilaspekt größerer Forschungsdesigns. Die Arbeit zielt darauf ab, die spezifischen Aspekte von Fernbeziehungen detaillierter zu beleuchten und bestehende Forschungslücken zu schließen.
Theoretischer und empirischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel legt den theoretischen und methodischen Grundstein der Studie. Es definiert zentrale Begriffe wie „Fernbeziehung“ und analysiert die Ursachen und Gründe für Fernbeziehungen im Kontext von Bildungsexpansion, Mobilität, Individualisierung und neuen Partnersuche-Möglichkeiten. Bestehende Forschungsergebnisse werden kritisch beleuchtet und die spezifischen Fragestellungen der Arbeit werden abgeleitet.
Fragestellung und Forschungsdesign: In diesem Kapitel werden die konkreten Forschungsfragen der Arbeit formuliert. Es wird detailliert auf den methodischen Ansatz eingegangen, inklusive der Auswahl der teilnehmenden Paare, der verwendeten Erhebungsinstrumente (Leitfaden und Objektive Daten Maske) sowie der angewandten Verfahren der Datenanalyse. Die methodische Vorgehensweise wird transparent dargestellt und begründet.
Empirische Befunde: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Fallanalysen verschiedener Paare werden vorgestellt, wobei die individuellen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Fokus stehen. Die Analyse der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren (z.B. Entscheidungskriterien, Haushaltsintegration, berufliche Sicherheit) und der Gestaltung der Fernbeziehungen bildet einen weiteren Schwerpunkt. Hier werden auch Aspekte wie Alltagsgestaltung in Fernbeziehungen eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Fernbeziehung, Paarbeziehung, Alltäglichkeit, Individualisierung, Mobilität, Beruf, Familie, Empirische Studie, Fallanalysen, Lebensgestaltung, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Fernbeziehungen im Kontext von Individualisierung und Erlebnisgesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht empirisch das Phänomen der Fernbeziehung. Sie beleuchtet die alltäglichen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien von Paaren in Fernbeziehungen und analysiert die verschiedenen Aspekte, die zu Fernbeziehungen führen und wie diese Beziehungen gestaltet werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Herausforderungen von Fernbeziehungen, die Ursachen und soziologischen Hintergründe, die Alltagsbewältigung und -gestaltung in Fernbeziehungen, spezifische Fallbeispiele und die Einordnung der Fernbeziehung in den Kontext von Individualisierung und gesellschaftlichen Veränderungen. Es werden Begriffsklärungen aus der Paarbeziehungs-Semantik und die Explikation des Begriffs Fernbeziehung vorgenommen. Weiterhin werden die Gründe für Fernbeziehungen wie Bildungsexpansion, Mobilität, individualisierte Lebensführung und neue Wege der Partnersuche untersucht.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die konkreten Forschungsfragen werden im Kapitel "Fragestellung und Forschungsdesign" detailliert dargelegt. Die Arbeit untersucht Entscheidungskriterien für das Eingehen von Fernbeziehungen, Polarität und Haushaltsintegration, die Fernbeziehung als Ideal in Phasen erhöhter Berufskonzentration, berufliche und finanzielle Sicherheit sowie die Herstellung von Alltäglichkeit in Fernbeziehungen.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Studie verwendet einen empirischen Ansatz. Die methodische Vorgehensweise wird transparent dargestellt und begründet. Es wird auf den Feldzugang, die Entwicklung der Forschungsinstrumente (Leitfaden und Objektive Daten Maske), die Erhebungsplanung, die Auswahl der Paare und die angewendeten Verfahren zur Datenanalyse eingegangen. Die Ergebnisse basieren auf Fallanalysen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Empirische Befunde" präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden Fallanalysen verschiedener Paare vorgestellt, wobei die individuellen Herausforderungen und Bewältigungsstrategien im Fokus stehen. Die Analyse der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren und der Gestaltung der Fernbeziehungen bildet einen weiteren Schwerpunkt.
Wie werden die Ergebnisse zusammengefasst?
Die Zusammenfassung und Bilanz der empirischen Befunde werden in einem eigenen Kapitel präsentiert. Zusätzlich werden Überlegungen zur Einordnung der Fernbeziehung in den Kontext von Individualisierung und Erlebnisgesellschaft sowie die Frage, ob es sich um eine Lebensphase oder Lebensform handelt, angestellt. Ambivalenztheoretische Überlegungen werden ebenfalls einbezogen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Fernbeziehung, Paarbeziehung, Alltäglichkeit, Individualisierung, Mobilität, Beruf, Familie, Empirische Studie, Fallanalysen, Lebensgestaltung, Soziologie.
Gibt es eine Einleitung und ein Fazit?
Ja, die Arbeit enthält eine Einleitung, die die Thematik einführt und die Forschungslücke hervorhebt. Eine Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in verschiedene Kapitel unterteilt, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind. Diese beinhalten ein Vorwort, eine Einleitung, einen theoretischen und empirischen Bezugsrahmen, die Fragestellung und das Forschungsdesign, die empirischen Befunde, eine Zusammenfassung der Befunde, Überlegungen zur Individualisierung und Erlebnisgesellschaft, die Frage nach Lebensphase oder Lebensform, ambivalenztheoretische Überlegungen und eine Schlussbemerkung.
- Quote paper
- Magistra Artium Eva-Christina Edinger (Author), 2007, Liebe mit Sonntagsgesicht. Über Alltäglichkeit in Fernbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116349