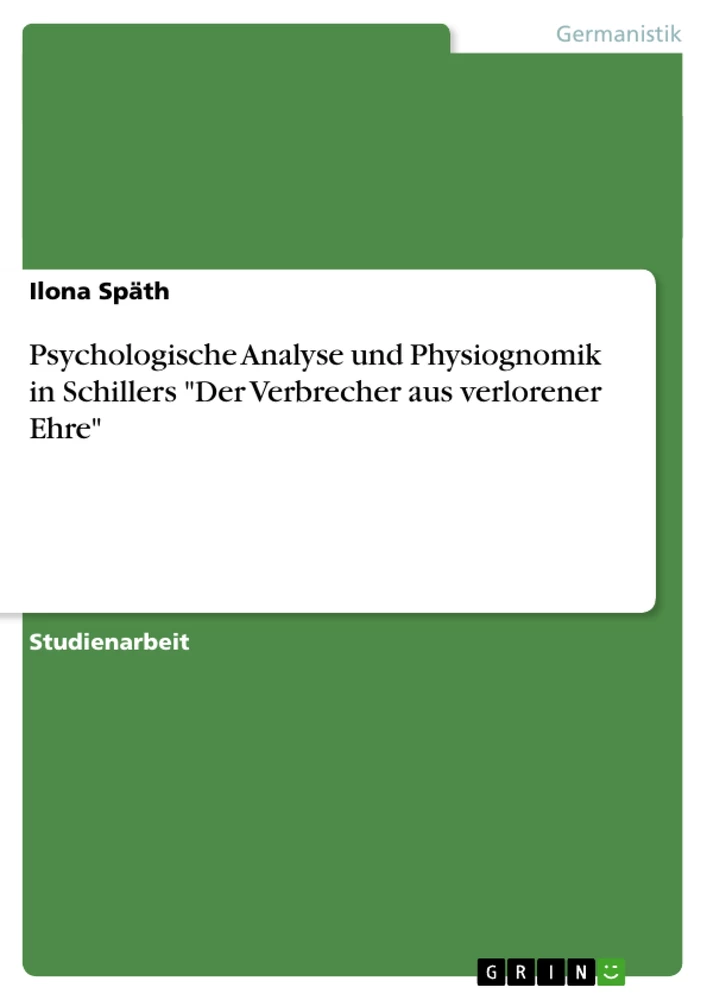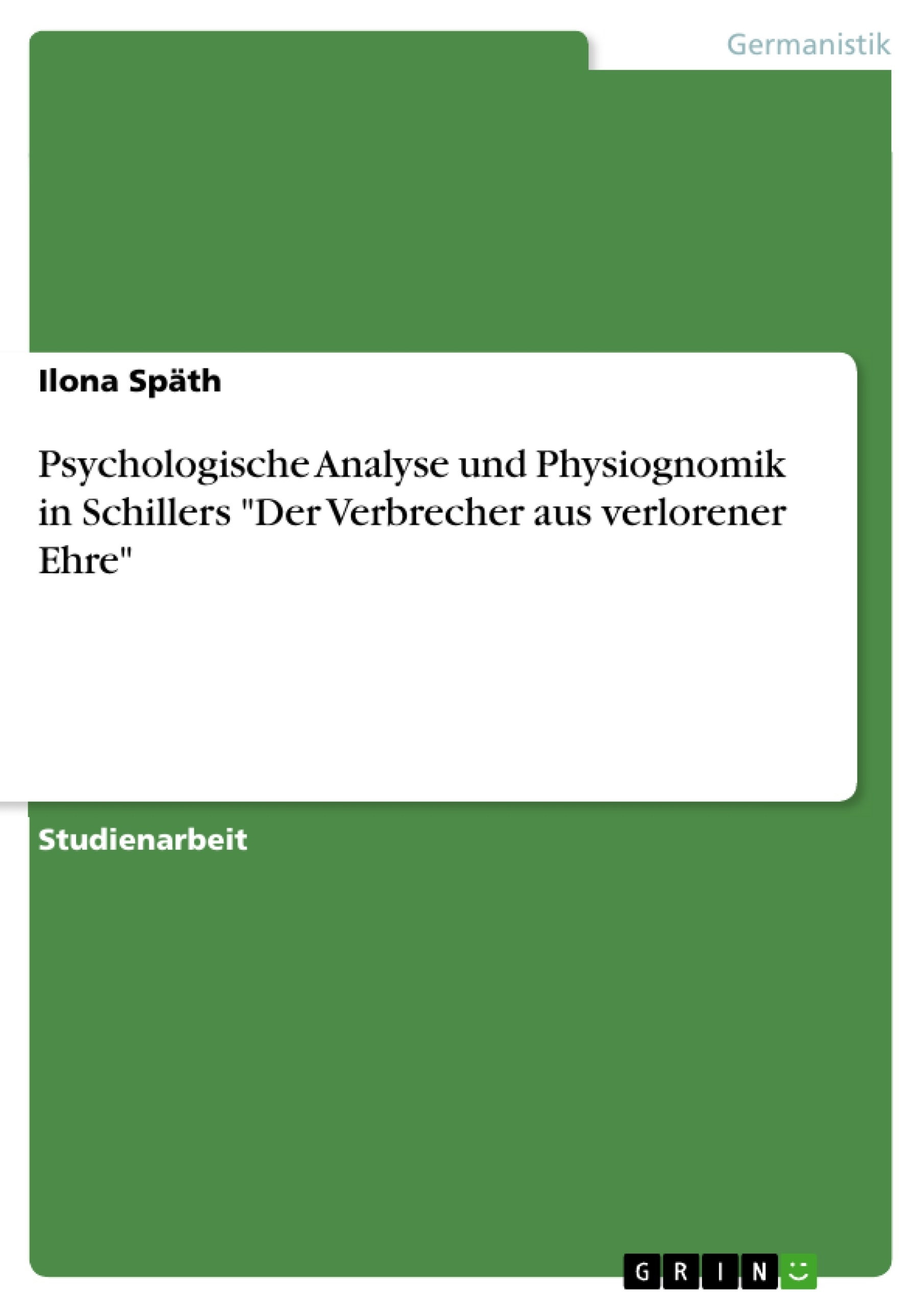Im Zeitalter der Aufklärung beschäftigten sich mehrere literarische Werke mit dem
Themengebiet des Verbrechens. Während in den Jahrzehnten zuvor die Taten genauestens
beschrieben wurden, stand in der Aufklärung der Verbrecher selbst im Mittelpunkt. Das
Interesse galt nicht mehr dem Verbrechen und dessen Wirkungen, sondern den Motiven und
der Psyche des Verbrechers. Es galt durch eine differenziertere Betrachtungsweise zu
erforschen, was einen Menschen dazu bringt ein Verbrechen zu begehen. Damals entstand
eine Vielzahl an psychologischen Untersuchungen, die ganz der Ansicht von Karl Philipp
Moritz entsprechen, dass „der wahre Gegenstand der menschlichen Erkenntnis und
insbesondere der Philosophie der Mensch sei“.
Viele der in der Literatur dargestellten Verbrechen beruhen auf wahren Begebenheiten. So
auch die 1786 publizierte Erzählung Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich
Schiller. Anfangs wurde die Erzählung anonym unter dem Titel Verbrecher aus Infamie, eine
wahre Geschichte in der Thalia veröffentlicht, später unter Schillers Namen als Der
Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte. in den Kleineren prosaischen
Schriften (I. Teil). Der Erzählung liegt die Lebensgeschichte des Sonnenwirts Friedrich
Schwan aus Ebersbach in Württemberg zugrunde, der von 1729 bis zu seiner Hinrichtung
1760 lebte. Schillers Interesse an der Begebenheit galt hauptsächlich dem seelischen
Niedergang Friedrich Schwans, sowie den gesellschaftlichen und psychologischen
Gesichtspunkten.
In dieser Hausarbeit ist es nun mein Ziel zu zeigen, wie Friedrich Schiller den Verbrecher in
der Erzählung darstellt um seine sozial-psychologische Intention zu verwirklichen. Außerdem
will ich Schillers Haltung zu der damals sehr populären Physiognomik herausarbeiten, die er
in seiner Erzählung deutlich macht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Psychologische Analyse
- a. Sozial-psychologische Intention
- b. Psychologische Darstellung Christian Wolfs
- 2. Physiognomik im Verbrecher aus verlorener Ehre
- a. Die Räuber-Darstellung
- b. Physiognomie von Christian Wolf
- c. Schillers Haltung zur Physiognomik
- 1. Psychologische Analyse
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Verbrechers in Schillers Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und analysiert die sozial-psychologische Intention des Autors. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung von Schillers Haltung zur Physiognomik und deren Integration in die Erzählung. Die Analyse betrachtet die Erzähltechnik und die psychologische Tiefe der Charakterzeichnung.
- Sozial-psychologische Intention Schillers
- Psychologische Darstellung des Verbrechers
- Rolle der Physiognomik in der Erzählung
- Schillers anthropologische und strafrechtliche Ansichten
- Erzählmethode und deren Wirkung auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung situiert Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" im Kontext der Aufklärung und ihres veränderten Blicks auf Kriminalität. Im Gegensatz zu früheren Darstellungen, die sich auf die Tat konzentrierten, rückt Schiller die Psyche des Verbrechers in den Mittelpunkt. Die Einleitung erwähnt die Quellenlage der Erzählung – die Lebensgeschichte des Sonnenwirts Friedrich Schwan – und benennt die Ziele der vorliegenden Arbeit: die Analyse der sozial-psychologischen Intention Schillers und seiner Haltung zur Physiognomik.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die psychologische Analyse der Erzählung. Schiller präsentiert einen komplexen Charakter, zerrissen von Trieben und Wünschen, und untersucht das Wechselspiel von Physis und Psyche. Der zweite Abschnitt widmet sich der Physiognomik in der Erzählung. Er analysiert, wie Schiller die Physiognomie der Figuren, insbesondere die von Christian Wolf, einsetzt, um Charaktereigenschaften zu verdeutlichen und seine eigenen Ansichten zur Physiognomik auszudrücken.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Der Verbrecher aus verlorener Ehre, Psychologische Analyse, Physiognomik, Aufklärung, Sozialpsychologie, Anthropologie, Strafrecht, Erzähltechnik, Charakterzeichnung, Moral, Seelenkunde.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Schillers Erzählung "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" unter sozial-psychologischen und physiognomischen Aspekten. Sie untersucht die psychologische Darstellung des Verbrechers, Schillers Intentionen und seine Haltung zur Physiognomik, sowie die Erzähltechnik und die anthropologischen und strafrechtlichen Ansichten des Autors.
Welche Themen werden im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die psychologische Analyse des Verbrechers, untersucht sein komplexes Wesen und das Wechselspiel von Physis und Psyche. Der zweite Abschnitt analysiert die Rolle der Physiognomik in der Erzählung, insbesondere wie Schiller die Physiognomie der Figuren, besonders die von Christian Wolf, einsetzt, um Charaktereigenschaften zu verdeutlichen und seine eigenen Ansichten auszudrücken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit zwei Unterabschnitten: Psychologische Analyse und Physiognomik im Verbrecher aus verlorener Ehre) und einen Schluss. Die Einleitung situiert die Erzählung im Kontext der Aufklärung und erläutert die Ziele der Arbeit. Der Hauptteil liefert die detaillierte Analyse, und der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Friedrich Schiller, Der Verbrecher aus verlorener Ehre, Psychologische Analyse, Physiognomik, Aufklärung, Sozialpsychologie, Anthropologie, Strafrecht, Erzähltechnik, Charakterzeichnung, Moral, Seelenkunde.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die sozial-psychologische Intention Schillers in "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" zu untersuchen und seine Haltung zur Physiognomik zu analysieren. Sie analysiert die psychologische Darstellung des Verbrechers, die Rolle der Physiognomik in der Erzählung und die Erzähltechnik Schillers.
Wie wird die Physiognomik in der Erzählung dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie Schiller die Physiognomie der Figuren verwendet, um deren Charaktereigenschaften zu verdeutlichen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Physiognomie von Christian Wolf und wie sie Schillers eigene Ansichten zur Physiognomik widerspiegelt.
Welche Rolle spielt die Aufklärung in der Erzählung?
Die Einleitung verortet die Erzählung im Kontext der Aufklärung und ihres veränderten Blicks auf Kriminalität. Im Gegensatz zu früheren Darstellungen wird hier die Psyche des Verbrechers in den Mittelpunkt gerückt.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung beschreibt die Einleitung als Kontextualisierung der Erzählung in der Aufklärung, den Hauptteil als Analyse der psychologischen und physiognomischen Aspekte und den Schluss als Zusammenfassung der Ergebnisse. Die einzelnen Unterkapitel des Hauptteils werden ebenfalls kurz zusammengefasst.
- Arbeit zitieren
- Ilona Späth (Autor:in), 2008, Psychologische Analyse und Physiognomik in Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116054