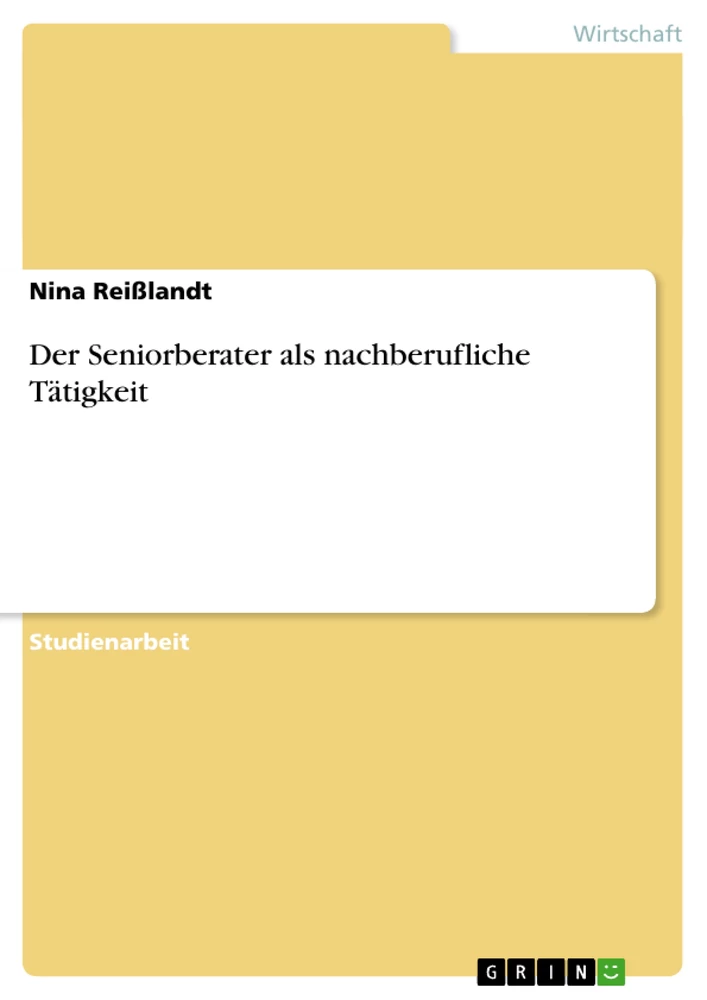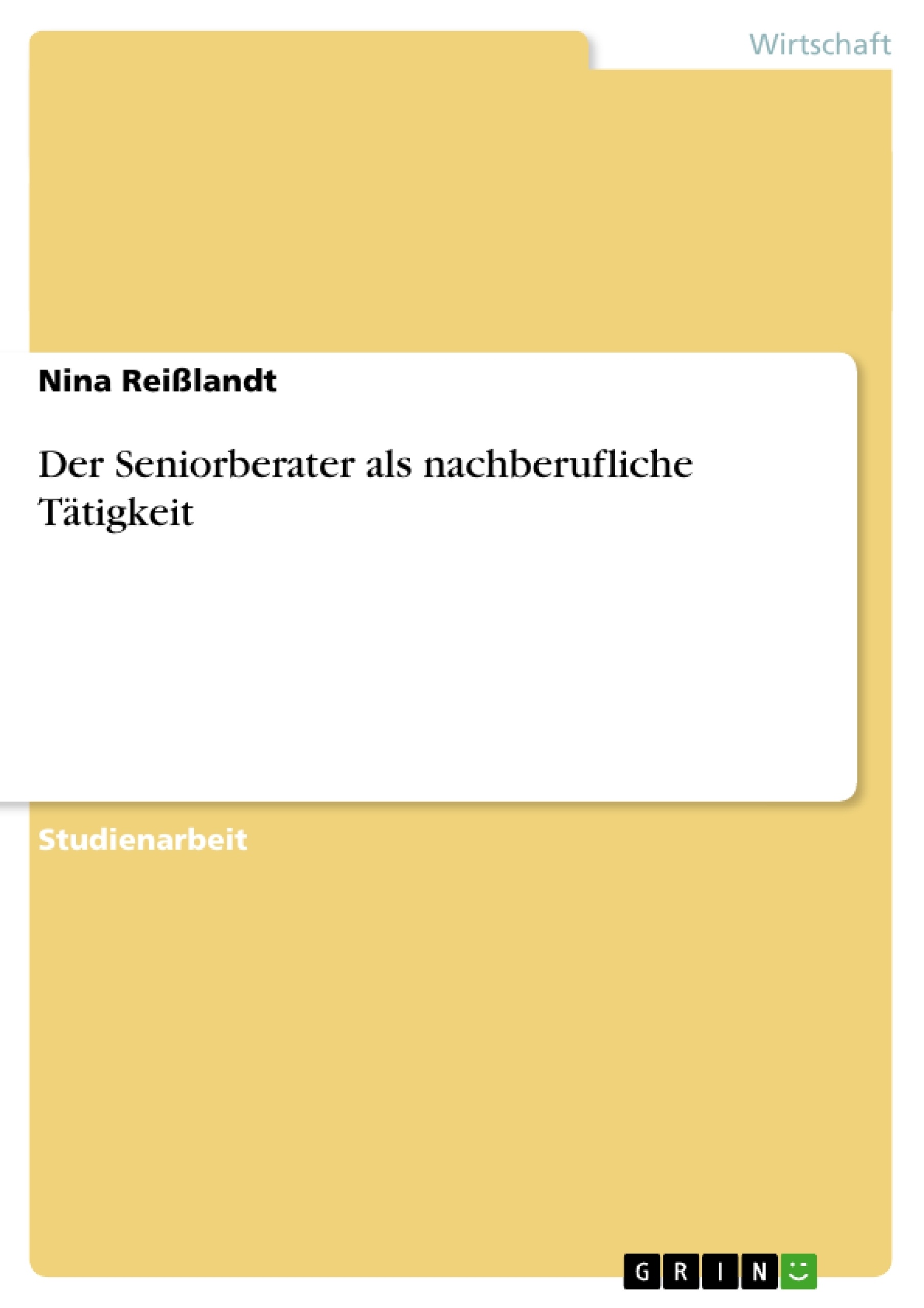Was wirklich zählt, wenn das Arbeitsleben endet? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer dringenden Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel und seinen Folgen für unsere Gesellschaft. Die alternde Bevölkerung Deutschlands stellt uns vor enorme Herausforderungen, von der Finanzierung der Renten bis zur Integration älterer Menschen in ein sich veränderndes soziales Gefüge. Dieses Buch beleuchtet aufschlussreich die kritischen Übergänge, mit denen Menschen konfrontiert sind, wenn sie sich vom Berufsleben verabschieden, und enthüllt die oft übersehenen psychologischen, sozialen und finanziellen Hürden. Es analysiert, wie der Verlust des beruflichen Status, des Tagesrhythmus und sozialer Kontakte zu einer tiefgreifenden Krise führen kann, die durch fehlende „weiche“ Übergänge in den Ruhestand noch verstärkt wird. Statt ältere Menschen lediglich als Belastung darzustellen, werden ihre wertvollen Ressourcen und Kompetenzen hervorgehoben und innovative Lösungsansätze wie das Berufsbild des Seniorberaters vorgestellt. Die Aktivitätstheorie, soziale Integration, Freizeitgestaltung und finanzielle Sicherheit werden als Schlüsselfaktoren für ein erfülltes Leben im Alter identifiziert. Leserinnen und Leser erhalten wertvolle Einblicke, wie ein aktiver Lebensstil, der Erhalt sozialer Kontakte und der sinnvolle Umgang mit Freizeit den Übergang in den Ruhestand positiv gestalten können. Darüber hinaus wird die Bedeutung technischer Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit dem Internet, für die soziale Teilhabe älterer Menschen betont. Eine unentbehrliche Lektüre für alle, die sich mit den Herausforderungen und Chancen des demografischen Wandels auseinandersetzen und nach Wegen suchen, das Potenzial älterer Generationen voll auszuschöpfen. Die Themen Altersvorsorge, Rentenpolitik, Demografie, soziale Integration im Alter und aktives Altern werden umfassend behandelt. Dieses Buch ist ein Muss für Fachleute aus den Bereichen Sozialarbeit, Altenpflege, Politik und Wirtschaft sowie für alle, die sich persönlich auf den Ruhestand vorbereiten oder Angehörige dabei unterstützen möchten, diesen Lebensabschnitt sinnvoll und erfüllend zu gestalten. Es fordert dazu auf, das Bild des Alters in der Öffentlichkeit neu zu denken und ältere Menschen nicht als passive Empfänger von Leistungen, sondern als aktive Gestalter unserer Gesellschaft wahrzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Probleme beim Übergang in das nachberufliche Leben
2.1 Die Aktivitätstheorie
2.2 Soziale Integration und Freizeitgestaltung
2.3 Finanzielle Aspekte des Ruhestandes
3. Senioren in Deutschland
3.1 Gesellschaftsbild von Senioren in der Öffentlichkeit
3.2 Ressourcen und Kompetenzen von Senioren
4. Der Seniorberater
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
In Deutschland gilt das Thema Altern als Tabuthema. Trotzdem müssen wir uns im Zuge der demographischen Entwicklung hinsichtlich der zunehmenden Alterung der deutschen Bevölkerung mit der Stellung älterer Menschen in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, denn laut Prognosen der Vereinten Nationen hinsichtlich der Einwohnerzahl in Deutschland werden im Jahre 2050 auf einen Rentner nur noch zwei statt wie heute noch vier Erwerbstätige kommen.[1] Gründe dafür sind zum einen der enorme Rückgang der Geburtenrate sowie das allgemeine Älterwerden der Menschen aufgrund des medizinischen Fortschritts.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bevölkerung BRD 1950 Bevölkerung BRD 2050
( Statistisches Bundesamt 2003 )
Zudem scheuen sich gerade deutsche Politiker, als Folge des nazistischen Rassenwahns, das Thema Bevölkerungspolitik überhaupt in den Mund zu nehmen.[2] Das zunehmende Altern der Gesellschaft, das selbst durch einen überproportionalen Geburtenboom oder durch starke Zuwanderung nicht mehr aufzuhalten ist, wird in der Öffentlichkeit zum größten Teil unter negativen Aspekten wie das Scheitern des Rentenversicherungssystems diskutiert.
Ich werde im Folgenden darstellen, mit welchen Problemen Menschen beim Übergang in den Ruhestand konfrontiert werden und inwiefern diverse Institutionen dieser Gruppe bei diesen Problemen Hilfe und Unterstützung bieten können. Des Weiteren werde ich offen legen, dass Rentner von der Öffentlichkeit noch viel zu stark als Last und finanzielle Bedrohung angesehen werden, anstatt ihre enormen Kompetenzen und Potentiale positiv zu nutzen. Außerdem werde ich das Berufsbild eines Seniorberaters darstellen, welches eine Lösungsmöglichkeit sowohl für viele Probleme der Ruheständler als auch für wirtschaftliche Probleme bezüglich der demographischen Entwicklung bietet.
2. Probleme beim Übergang in das nachberufliche Leben
In der modernen westlichen Welt ist der Status und auch der Wert eines Menschen sowohl im privaten Bereich als auch innerhalb des Berufsfeldes weitgehend durch seinen Beruf bestimmt. Scheidet nun ein Mensch aus dem Berufsleben aus, fallen diese Status determinierenden Faktoren weg. Berufliche Arbeit bietet außerdem weit mehr als die reine Befriedigung finanzieller Bedürfnisse. Die Zufriedenheit im Beruf korreliert mit der Zufriedenheit im privaten Bereich, denn berufliche Arbeit hat vielschichtige Motive wie Verantwortung, Selbstbestätigung, Tagesrhythmus-gestaltung, Kontakte, Kreativität und Freude. Beim Eintritt in den Ruhestand ist man nun gezwungen, die Befriedigung dieser Motive woanders zu erlangen, denn die Tätigkeiten, mit denen man sich den Großteil des Tages beschäftigt, fallen plötzlich weg, ebenso wie die Kontakte zu den Berufskollegen. Andere Kontakte müssen nun aufgebaut oder vorhandene intensiviert werden. Aufgrund dessen wird der Eintritt in den Ruhestand oft als Krisensituation empfunden, die sehr unterschiedlich bewältigt wird und zu einem sozialen und psychischem Bruch führen kann.[3]
Zudem handelt es sich bei dem deutschen Staat um einen korporatistischen Wohlfahrtsstaat, d.h. der „gewöhnliche“ Arbeitnehmer geht direkt von voller Erwerbstätigkeit in den vollen Ruhestand. Es fehlen daher trotz vermehrter Vorruhestandsregelungen weiche Zwischenlösungen, die den Übergang in den vollen Ruhestand erleichtern. Statistisch gesehen gehen in Deutschland nur noch rund 2,0% der Frauen und rd. 5,7% der Männer im Rentenalter arbeiten, wohingegen in den liberalen Wohlfahrtsstaaten wie beispielsweise den USA durchschnittlich 11,4% der Menschen über 65 Jahren noch arbeiten, womit sich der Übergang in den Ruhestand weitaus individualisierter gestaltet.
Des Weiteren sieht sich ein Großteil der Rentner mit einer wirtschaftlichen Situation konfrontiert, die aus vielerlei Gründen ungünstiger ist als vorher.
Welche Prämissen gibt es also, damit Menschen nach dem Ausstieg aus dem Beruf weiterhin ein glückliches und erfülltes Leben führen können? In den nachfolgenden Kapiteln werde ich zeigen, dass die Erkenntnisse der aktuell gültigen Aktivitätstheorie sowie die soziale Integration und die Freizeitgestaltung und auch die finanzielle Absicherung eine enorm wichtige Rolle für die Lebenszufriedenheit spielen.
2.1 Die Aktivitätstheorie
Nach einer empirischen Untersuchung von Schumacher/Gunzelmann/Brähler korreliert die allgemeine und bereichsspezifische Lebenszufriedenheit des Menschen mit einer aktiven Gestaltung des Lebens.[4] Dieses Untersuchungsergebnis deckt sich mit der aus den 60er Jahren stammenden Aktivitätstheorie, die besagt, dass das „Leisten“ so tief in den Menschen eingeprägt ist wie ein physiologisches Grundbedürfnis. Somit ist nur der Mensch zufrieden und glücklich, der ein aktives Leben führt und das Gefühl hat, von anderen gebraucht zu werden.[5] Also muss der aktive Lebensstil gerade nach dem Eintritt in den Ruhestand beibehalten oder durch neue Aktivitäten ersetzt werden, um den Wegfall der Berufstätigkeit zu kompensieren und auch im Alter ein positives Selbstbild zu gewährleisten.[6]
2.2 Soziale Integration und Freizeitgestaltung
Der Übergang in den Ruhestand führt fraglos zu einem Verlust an Kontakten mit Kollegen, welcher durch Kontakte mit anderen Menschen kompensiert werden muss. Jetzt spielen insbesondere Verwandtschaftsbeziehungen und Kontakte zu Freunden und Nachbarn eine große Rolle. Erschwert werden können diese Kontakte zum einen durch die Wohnbedingungen sowie die psychische, physische und technische Mobilität des Ruheständlers. Durch den sich vollziehenden gesellschaftlichen Wandel werden außerdem zunehmend mehr ältere Menschen über nur ein geringes oder kein familiäres Kontakt- und Unterstützungspotential verfügen, denn der Anteil allein stehender älterer Menschen steigt kontinuierlich. Um die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten optimal nutzen zu können, sind insbesondere technische Voraussetzungen von großer Bedeutung. Das Telefon steht hier an erster Stelle, um Kontakte auf Distanz pflegen zu können, aber eine ebenso gute Möglichkeit zur Aufrechterhaltung und Knüpfung neuer sozialer Kontakte bietet das Internet, dass, aufgrund mangelnder Erfahrung mit dessen Umgang, bislang leider erst von ca. 30,5 % der Menschen über 50 genutzt wird.[7] Ebenso wichtig wie technische Voraussetzungen ist die Möglichkeit zur Mobilität hinsichtlich des Anschlusses an öffentliche Verkehrsmittel oder der Nutzung des eigenen Privatwagens, um persönliche Kontakte pflegen zu können. Die Schaffung und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte hängt auch stark von der individuellen Persönlichkeit ab, insbesondere hinsichtlich der Kontaktfähigkeit und Kontaktwilligkeit. Sonstige Institutionen, die die Möglichkeit zur Kommunikation bieten (Altenclubs, Altenzentren, Altengruppen, etc.) werden meist nur von denen genutzt, die ohnehin kontaktfreudig sind.
Freizeitaktivitäten von Ruheständlern hängen stark von sozioökonomischen, sozialen und personalen Faktoren wie Bildungsstand, ausgeübter Beruf, Familienumfeld, finanzielle Situation, Alter, Geschlecht, Gesundheit usw. ab. Grob lassen sie sich in folgenden Aktivitäten zusammenfassen: Medienkonsum (Zeitung lesen, Fernsehen,…), Kulturkonsum (Kino, Theater, Konzerte, Kirchgang,…), Sport, Garten- und Heimarbeiten, Reisen, Spaziergänge sowie Besuche bei Freunden und Verwandten. Interessanterweise ergab sich bei Untersuchungen von Rentnern im Urlaub, dass bei der Altersgruppe der 60 bis 90jährigen 65-80% einen „aktiven“ Urlaub wie beispielsweise Studienreisen durchführen, wohingegen Jüngere den Urlaub eher zur Erholung nutzen.[8] Viele dieser Tätigkeiten sind durchaus als positiv zu bewerten, während insbesondere die passive Berieselung durch das Fernsehen die Gefahr beinhaltet, durch parasoziale Interaktion mit den Darstellern als Ersatz für soziale Kommunikation zu dienen.[9] Leider verbringen die über 60-Jährigen durchschnittlich 4 Stunden pro Tag vor dem Fernseher mit einer steigenden Tendenz im zunehmenden Alter.
[...]
[1] ) A. Höning: „Wer wann in Rente darf“, Rheinische Post, Ausgabe v. 23.10.06
[2] ) E. Niejahr: „Die vergreiste Republik“, Die Zeit, Ausgabe 02/2003
[3] ) C. Wingenbach: „Übergänge in den Ruhestand“, www.carelounge.de/altenarbeit/wissen/themen_ruhestd.php,
besucht am 03.12.2006
[4] ) J. Schumacher/ T. Gunzelmann/ E. Brähler: „Lebenszufriedenheit im Alter - Differentielle Aspekte und Einflussfaktoren“, www.uni-leipzig.de/~gespsych/material/zufr_alt.pdf, besucht am 02.12.2006
[5] ) D. Knopf: „Menschen im Übergang von der Erwerbsarbeit in den Ruhestand – Eine Herausforderung
für die Erwachsenenbildung“, www.bmbf.de/pub/ruhestand.pdf, besucht am 02.12.2006
[6] ) C. Wingenbach: „Übergänge in den Ruhestand“, www.carelounge.de/altenarbeit/wissen/themen_ruhestd.php,
besucht am 03.12.2006
[7] ) HeiseOnline: „Ältere Menschen eignen sich zunehmend das Internet an“, www.heise.de/newsticker/meldung/64438, besucht am 04.12.2006
[8] ) I. Füsgen/ A. Welz: „Reisen im Alter“, nach: F. Karl/ W. Tokarski, 1992, S. 130f
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert das Altern als Tabuthema in Deutschland und die Notwendigkeit, sich mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Prognosen der Vereinten Nationen zeigen, dass im Jahr 2050 auf einen Rentner nur noch zwei Erwerbstätige kommen werden. Gründe hierfür sind der Rückgang der Geburtenrate und das Älterwerden der Menschen. Die Einleitung beleuchtet, dass die Alterung der Gesellschaft oft negativ diskutiert wird, insbesondere im Zusammenhang mit dem Rentenversicherungssystem. Es wird die These aufgestellt, dass Rentner zu stark als Last angesehen werden, anstatt ihre Kompetenzen positiv zu nutzen. Die Arbeit stellt das Berufsbild des Seniorberaters vor, welches eine Lösung für Probleme der Ruheständler und wirtschaftliche Probleme darstellen könnte.
Welche Probleme werden beim Übergang in das nachberufliche Leben angesprochen?
Der Übergang in den Ruhestand führt zum Verlust des berufsbedingten Status und der damit verbundenen Zufriedenheit. Berufliche Arbeit bietet mehr als nur finanzielle Befriedigung, wie Verantwortung, Selbstbestätigung, Tagesgestaltung, Kontakte und Kreativität. Der Wegfall dieser Aspekte kann als Krisensituation empfunden werden. Es fehlen "weiche" Übergänge, die den Einstieg in den Ruhestand erleichtern würden. Viele Rentner sehen sich zudem mit einer ungünstigeren wirtschaftlichen Situation konfrontiert. Die Aktivitätstheorie, soziale Integration, Freizeitgestaltung und finanzielle Absicherung sind wichtige Faktoren für die Lebenszufriedenheit.
Was besagt die Aktivitätstheorie?
Die Aktivitätstheorie besagt, dass "Leisten" ein tief verwurzeltes physiologisches Grundbedürfnis ist. Zufrieden und glücklich ist nur, wer ein aktives Leben führt und das Gefühl hat, gebraucht zu werden. Daher muss der aktive Lebensstil nach dem Eintritt in den Ruhestand beibehalten oder durch neue Aktivitäten ersetzt werden, um den Wegfall der Berufstätigkeit zu kompensieren und ein positives Selbstbild zu gewährleisten.
Welche Rolle spielen soziale Integration und Freizeitgestaltung?
Der Verlust von Kontakten mit Kollegen muss durch andere soziale Kontakte kompensiert werden. Verwandtschaftsbeziehungen, Freundschaften und Nachbarschaftskontakte spielen eine große Rolle. Wohnbedingungen und die Mobilität des Ruheständlers beeinflussen die Kontaktpflege. Der Anteil alleinstehender älterer Menschen nimmt zu. Technische Voraussetzungen wie Telefon und Internet sind wichtig für die Kommunikation. Freizeitaktivitäten hängen von sozioökonomischen, sozialen und personalen Faktoren ab. Beispiele sind Medienkonsum, Kulturkonsum, Sport, Gartenarbeit, Reisen und Besuche bei Freunden und Verwandten. Passiver Medienkonsum wie Fernsehen birgt die Gefahr parasozialer Interaktion als Ersatz für soziale Kommunikation.
- Quote paper
- Nina Reißlandt (Author), 2007, Der Seniorberater als nachberufliche Tätigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116016