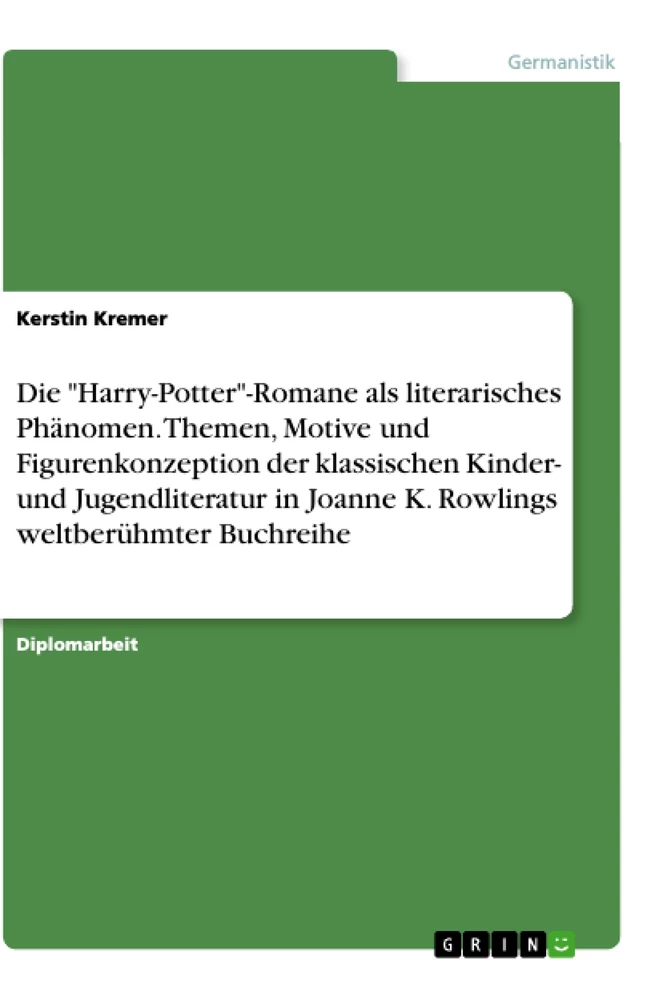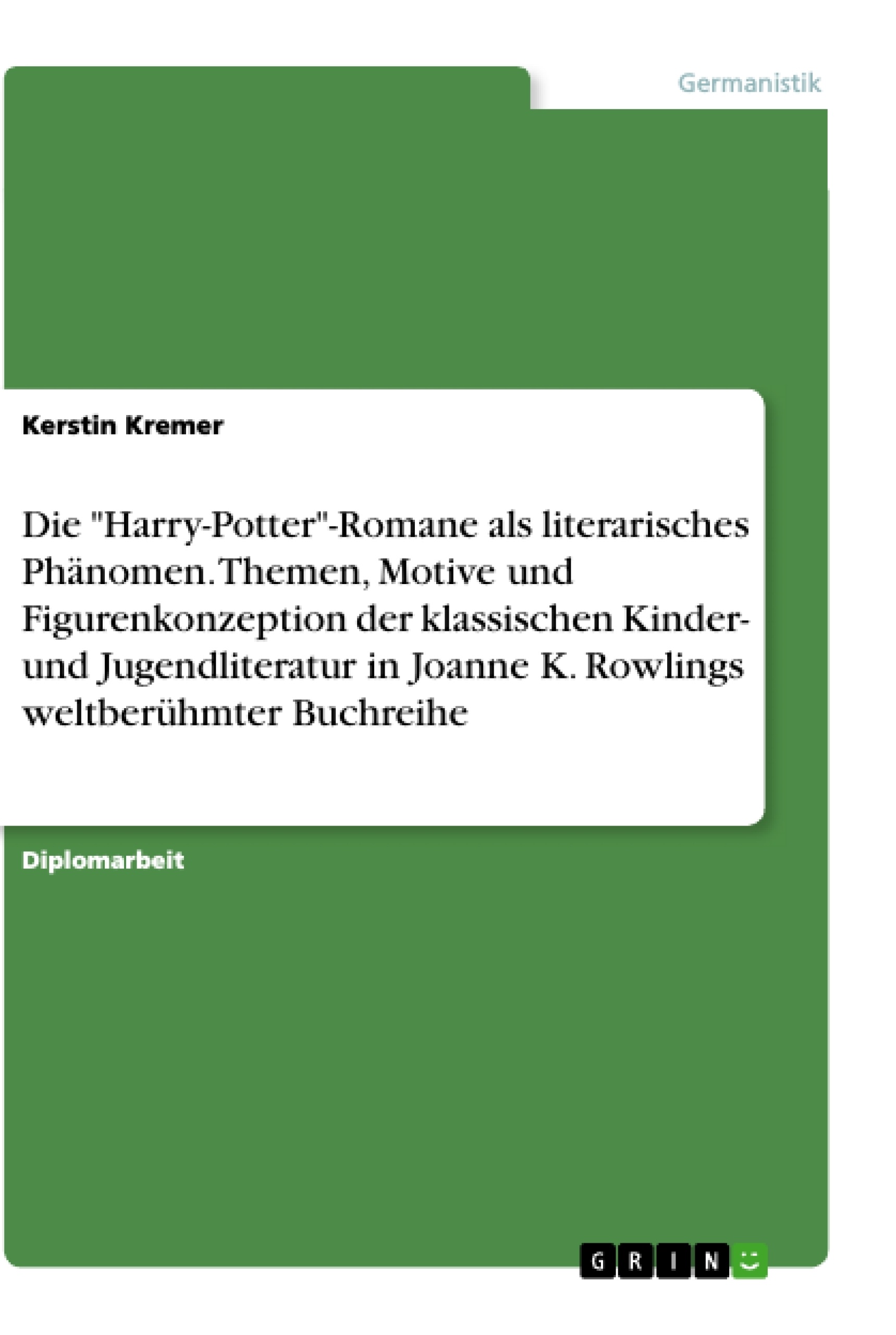Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum die Buchreihe um den Zauberlehrling „Harry Potter“ eine weltweite Berühmtheit erlangen konnte.
"Er wird berühmt werden – eine Legende – […] ganze Bücher wird man über ihn schreiben – jedes Kind auf der Welt wird seinen Namen kennen!" Das prophezeit die Hexe Minerva McGonagall auf den ersten Seiten eines 1997 in England mit der Auflage von 500 Stück erschienen Buches. Seitdem wurden sechs weitere Bände veröffentlicht, der Letzte in England am 26. 07. 2007.
Mit ihm endet eine Kinderbuchreihe, aus der bis heute weltweit 325 Millionen Exemplare in 200 Ländern verkauft wurden und die in 65 Sprachen übersetzt sind. Die Autorin dieser Bücher, Joanne K. Rowling, deutet mit den Worten am Anfang ihres Erstlingswerkes „Harry Potter und der Stein der Weisen“ voraus, welchen Weg die Geschichten über den Zauberschüler nehmen sollte – der Name "Harry Potter" ist längst in aller Munde. Joanne K. Rowlings Zauberlehrling war wochenlang in den nationalen und internationalen Bestsellerlisten vertreten, die Verfilmungen der ersten fünf Bände spielten Millionen ein und zu den Lesern gehören bekanntermaßen längst nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene.
Bleibt die Frage nach dem Warum. Warum hat eine Bücherreihe in über 200 Ländern Erfolg? Warum steht ein Kinderbuch wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten? Warum lesen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene diese Bücher?
Dieser Diplomarbeit liegt die These zugrunde, dass die Antworten auf diese Fragen zum Großteil innerhalb der Bücher selbst zu finden sind: in ihrer Intertextualität und den Themen und Motiven, derer sie sich aus erfolgreichen Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur bedienen. Die Arbeit will den literaturwissenschaftlichen Anteil am Erfolg der Romanreihe aufzeigen. Auf der Grundlage aller sieben Bände, denn vor allem für die Entwicklung einzelner Figuren sind alle Bände relevant, soll versucht werden, Parallelen zu ziehen, zwischen den Merkmale klassischer Kinder- und Jugendliteraturgenres, deren Themen, Motiven und Figurenkonzeptionen und der Romanreihe von Joanne K. Rowling.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Begriffsabgrenzungen
- 2.1 Systematisierung und Definition von Kinder- und Jugendliteratur
- 2.1.1 Korpusbildung über die literarische Handlungsebene
- 2.1.2 Korpusbildung über die Textebene
- 2.1.3 Definition anhand der Altersbegrenzung
- 2.2 Kanon der klassischen Kinder- und Jugendliteratur und der Begriff ‚Kinderklassiker‘
- 2.3 Die „Harry-Potter“-Romane als Kinderklassiker
- 2.4 Abgrenzung der Begriffe ‚Thema‘, ‚Motiv‘ und ‚Figurenkonzeption‘
- 2.4.1 Das Thema als abstraktester Baustein eines literarischen Werkes
- 2.4.2 Motive als zentrale Kerne eines Textes
- 2.4.3 Die Figurenkonzeption in der Wechselwirkung mit Thema und Motiv
- 2.4.4 Klassische Figurenkonzeptionen in „Harry Potter“
- 2.5 Kanonbildung in der klassischen Kinder- und Jugendliteratur
- 3. Textsortentraditionen in der klassischen Kinder- und Jugendliteratur
- 3.1 Phantastische Kinder- und Jugendliteratur
- 3.1.1 Das Zwei-Welten-Modell als Grundlage der Begriffsdefinition
- 3.1.2 Klassische Strukturmotive als Elemente der phantastischen Literatur
- 3.1.3 Das Motiv der ‚Anderswelt‘
- 3.1.4 Die Anderswelt als Strukturmotiv in „Harry Potter“
- 3.1.5 Das Motiv der ‚magischen Reise‘
- 3.1.6 Das Strukturmotiv der ‚phantastischen Reise‘ in „Harry Potter“
- 3.1.7 Das Thema des ‚Kampfes zwischen Gut und Böse‘
- 3.1.8 Der ‚Kampf Gut gegen Böse‘ als zentrales Thema der „Harry-Potter“-Romane
- 3.2 Das Abenteuerbuch in der Kinder- und Jugendliteratur
- 3.2.1 „Harry Potter“ in der Tradition des Abenteuerbuches
- 3.2.2 Klassische Motive des Abenteuerbuches
- 3.2.3 Das Thema der ‚Suche‘ in der Abenteuerliteratur
- 3.2.4 Das Thema der ‚Suche‘ in „Harry Potter“
- 3.2.5 Der ‚Gral‘ als Motiv der Artusdichtung in „Harry Potter“
- 3.2.6 ‚Wald‘, ‚Fluss‘ und ‚Meer‘ als Abgrenzungsmotive in der Abenteuerliteratur und in den „Harry-Potter“-Romanen
- 3.3 Charakteristika und Motive des Subgenres Kriminalgeschichte in der Literatur
- 3.3.1 Einteilung des Genres über strukturelle Merkmale
- 3.3.2 Systematisierung über klassische Bauformen
- 3.3.3 Die klassische Detektivgeschichte für Kinder und Jugendliche
- 3.3.4 Die „Harry-Potter“-Romane als klassische Detektivgeschichte
- 3.3.5 Die Detektivgeschichte als Serie in der Kinder- und Jugendliteratur im Vergleich mit „Harry Potter“
- 3.3.6 Themen, Figuren und Motive der Detektivgeschichte
- 3.3.7 Die Figur des ‚Detektivs‘ in der Kinder- und Jugendliteratur
- 3.3.8 Harry Potter als Detektiv
- 3.3.9 Das Thema der ‚Angst‘ und seine Verarbeitung in „Harry Potter“
- 3.3.10 Das Motiv des ‚Zufalls‘ in „Harry Potter“
- 3.4 Märchen, Mythen und Sagen als Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur und ihre Themen und Motive in „Harry Potter“
- 3.4.1 Strukturmerkmale des Märchens und die Ansätze in „Harry Potter“
- 3.4.2 Typologie und Grundtyp des Märchens in Abgrenzung zur Sage
- 3.4.3 Die Motive ‚Außenseiter‘, ‚Elternferne‘, ‚Elternlosigkeit‘ und ‚Essen‘ im Märchen
- 3.4.4 Klassische Märchenmotive in „Harry Potter“
- 3.4.5 Das ‚Spiegelmotiv‘ im Märchen und seine Variation in „Harry Potter“
- 3.4.6 Das Märchenmotiv der ‚Verwandlung‘ in den „Harry-Potter“-Romanen
- 3.4.7 Der Mythos in der Kinder- und Jugendliteratur
- 3.4.8 Das Motiv des ‚Labyrinths‘
- 3.4.9 Das Labyrinth in „Harry Potter“
- 3.4.10 Fabeltiere und -wesen des Mythos und ihre Gestaltung in „Harry Potter“
- 3.5 Die Tradition des britischen Boarding school novel
- 3.5.1 ‚Schule‘ als Handlungsort im Boarding school novel
- 3.5.2 Das Schulthema in „Harry Potter“
- 3.5.3 ‚Freundschaft‘ als Grundthema des Boarding school novel
- 3.5.4 Das Thema ‚Freundschaft‘ in „Harry Potter“
- 4. Schlussbemerkung
- Intertextualität der „Harry-Potter“-Romane
- Vergleich mit etablierten Genres der Kinder- und Jugendliteratur
- Analyse von Themen und Motiven in Bezug auf den Erfolg der Reihe
- Untersuchung der Figurenkonzeption und deren Rolle in der Handlung
- Potenzial der „Harry-Potter“-Romane als Kinderklassiker
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den literaturwissenschaftlichen Beitrag zum Erfolg der „Harry-Potter“-Romane. Die Arbeit analysiert die Intertextualität der Reihe und deren Bezug zu Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. Ziel ist es, Parallelen zwischen den Merkmalen klassischer Genres und Rowlings Romanen aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die immense Popularität der „Harry-Potter“-Romane dar und formuliert die These, dass der Erfolg auf der Intertextualität und der Verwendung von Motiven aus erfolgreichen Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur beruht. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, indem sie die Definition wichtiger Begriffe und die Analyse verschiedener literarischer Genres in Bezug auf die „Harry-Potter“-Romane ankündigt.
2. Grundlegende Begriffsabgrenzungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Kinder- und Jugendliteratur“, „Klassiker“, „Thema“, „Motiv“, und „Figurenkonzeption“. Es differenziert zwischen verschiedenen Definitionen von Kinder- und Jugendliteratur und diskutiert die „Harry-Potter“-Romane im Kontext dieser Definitionen. Das Kapitel legt die Grundlage für die spätere Analyse, indem es die methodischen Werkzeuge bereitstellt.
3. Textsortentraditionen in der klassischen Kinder- und Jugendliteratur: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Textsorten der klassischen Kinder- und Jugendliteratur (Phantastik, Abenteuer, Kriminalroman, Märchen/Mythen, Boarding school novel) und untersucht deren Merkmale, Themen, Motive und Figurenkonzeptionen. Es zieht Parallelen zu den „Harry-Potter“-Romanen und zeigt auf, wie Rowling Elemente verschiedener Genres in ihrem Werk verarbeitet und kombiniert.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendliteratur, Harry Potter, Intertextualität, Phantastik, Abenteuerroman, Kriminalroman, Märchen, Mythos, Boarding school novel, Thema, Motiv, Figurenkonzeption, Kanonbildung, Zwei-Welten-Modell, Gut gegen Böse, Suche, Zufall, Angst, Verwandlung, Freundschaft, Schule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Analyse der "Harry-Potter"-Romane
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den literaturwissenschaftlichen Beitrag zum Erfolg der „Harry-Potter“-Romane. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Intertextualität der Reihe und deren Bezug zu Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. Ziel ist es, Parallelen zwischen den Merkmalen klassischer Genres und Rowlings Romanen aufzuzeigen und das Potenzial der Romane als Kinderklassiker zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Intertextualität der „Harry-Potter“-Romane, Vergleich mit etablierten Genres der Kinder- und Jugendliteratur (Phantastik, Abenteuerroman, Kriminalroman, Märchen, Mythen, Boarding school novel), Analyse von Themen und Motiven im Hinblick auf den Erfolg der Reihe, Untersuchung der Figurenkonzeption und deren Rolle in der Handlung, sowie die Definition und Abgrenzung wichtiger Begriffe wie Kinder- und Jugendliteratur, Klassiker, Thema, Motiv und Figurenkonzeption.
Welche Textsorten und Genres werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Textsorten der klassischen Kinder- und Jugendliteratur und deren Merkmale, Themen, Motive und Figurenkonzeptionen. Konkret werden Phantastische Kinder- und Jugendliteratur, das Abenteuerbuch, die Kriminalgeschichte, Märchen, Mythen, Sagen und die Tradition des britischen Boarding school novel untersucht und mit den „Harry-Potter“-Romanen verglichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die These und die methodische Vorgehensweise vor. Kapitel 2 (Grundlegende Begriffsabgrenzungen) definiert wichtige Begriffe und legt die Grundlage für die Analyse. Kapitel 3 (Textsortentraditionen in der klassischen Kinder- und Jugendliteratur) analysiert verschiedene Genres und deren Parallelen zu „Harry Potter“. Kapitel 4 (Schlussbemerkung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kinder- und Jugendliteratur, Harry Potter, Intertextualität, Phantastik, Abenteuerroman, Kriminalroman, Märchen, Mythos, Boarding school novel, Thema, Motiv, Figurenkonzeption, Kanonbildung, Zwei-Welten-Modell, Gut gegen Böse, Suche, Zufall, Angst, Verwandlung, Freundschaft, Schule.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Methodik, die auf der Analyse von Themen, Motiven, Figurenkonzeptionen und der Intertextualität basiert. Sie vergleicht die „Harry-Potter“-Romane mit etablierten Genres der Kinder- und Jugendliteratur, um deren Erfolg zu erklären.
Welche konkreten Motive und Themen werden in "Harry Potter" im Kontext der klassischen Kinderliteratur untersucht?
Die Arbeit untersucht zahlreiche Motive und Themen in "Harry Potter" im Vergleich zu klassischen Kinderliteratur-Genres, darunter: das Zwei-Welten-Modell, der Kampf zwischen Gut und Böse, die magische Reise, die Suche, der Gral, der Wald, Fluss und Meer als Abgrenzungsmotive, die Figur des Detektivs, Angst, Zufall, der Außenseiter, Elternferne/Elternlosigkeit, das Spiegelmotiv, Verwandlung, das Labyrinth, Fabelwesen, Freundschaft und die Schule als Handlungsort.
- Citar trabajo
- Kerstin Kremer (Autor), 2008, Die "Harry-Potter"-Romane als literarisches Phänomen. Themen, Motive und Figurenkonzeption der klassischen Kinder- und Jugendliteratur in Joanne K. Rowlings weltberühmter Buchreihe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159251