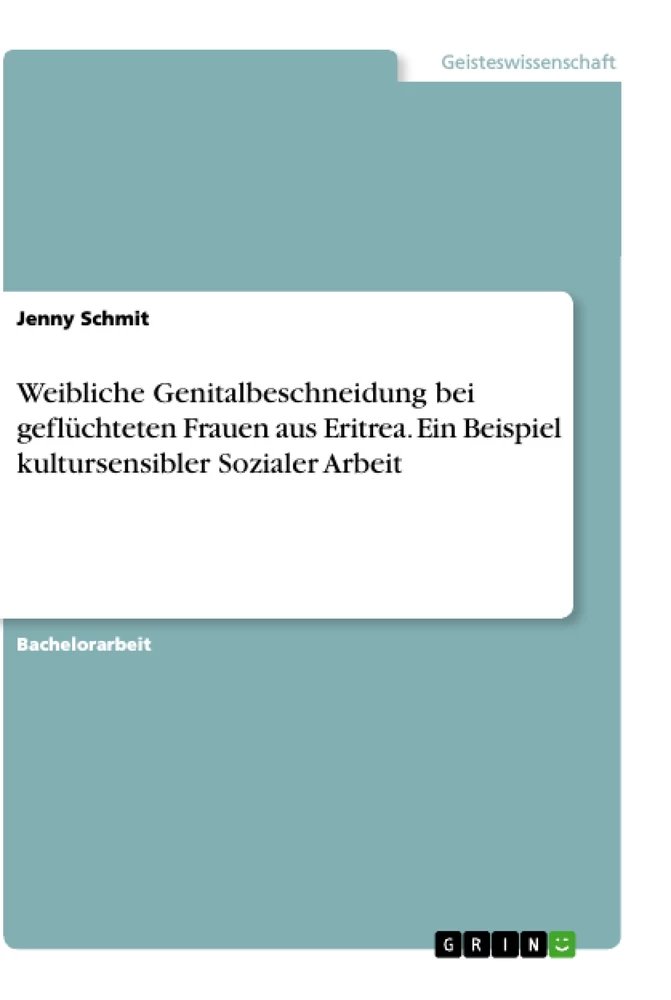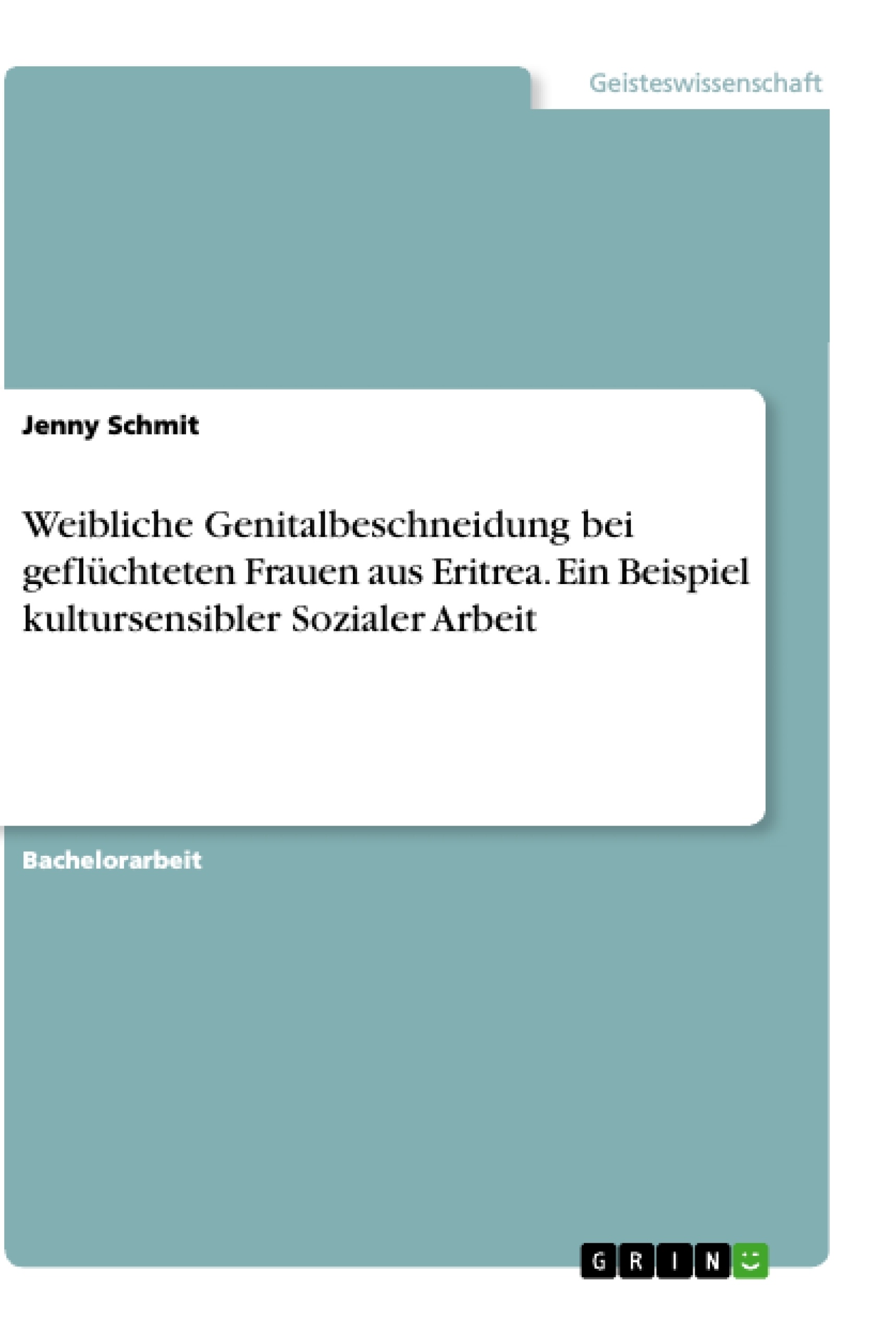Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit weiblicher Genitalbeschneidung von geflüchteten Frauen aus Eritrea und beleuchtet dieses Thema als ein Beispiel kultursensibler Sozialer Arbeit.
Westliche Gesellschaften wurden erst in den letzten Jahrzehnten durch die zunehmende Migration aus Ländern wie Somalia oder Eritrea mit dem Problem der weiblichen Genitalbeschneidung konfrontiert. Das Thema beschäftigt unterschiedliche Bereiche, wie die Politik, die Justiz und die Gesundheitsfürsorge. Zusätzlich werden Fachpersonen in ihrer Beratungsarbeit mehr denn je mit Fragen rund um FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting) konfrontiert.
Da die Praxis in Europa noch relativ unbekannt ist, wird dem Thema in der Aus- und Weiterbildung von Sozialarbeiter*innen in den Bereichen Migration und Gesundheit gewöhnlich sehr wenig Beachtung geschenkt. Die meisten Fachpersonen in diesen wichtigen Arbeitsfeldern verfügen also über, wenn überhaupt, nur wenig Wissen über das Thema und fühlen sich bei der Arbeit mit beschnittenen Mädchen und Frauen meist überfordert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eritrea: Hintergründe und Fluchtursachen
- 3. Weibliche Genitalbeschneidung am Beispiel von Eritrea
- 3.1 Begriffserklärungen
- 3.2 Verbreitung von FGM/C
- 3.3 Formen und Durchführung der Beschneidung
- 3.4 Motive für den Eingriff
- 3.4.1 Tradition und soziale Integration
- 3.4.2 Ästhetik und Gesundheit
- 3.4.3 Religiöse Hintergründe
- 3.5 Folgen für die beschnittenen Frauen
- 3.5.1 Körperliche Folgen
- 3.5.2 Psychische Folgen
- 3.5.3 Sexuelle Folgen
- 3.6 Internationale Gesetzeslagen und Präventionsbemühungen
- 3.7 FGM/C im Kontext der Migration
- 4. Kompetente und kultursensible Soziale Arbeit mit geflüchteten Frauen
- 4.1 Notwendigkeit kultursensibler Sozialer Arbeit
- 4.1.1 Definition
- 4.1.2 Kultursensibilität als Schlüssel kultureller Kompetenz
- 4.1.3 Entwicklungsmodell der Kultursensibilität von Milton J. Bennett
- 4.1.4 Prinzipien kultursensibler Sozialer Arbeit
- 4.2 Professionelle Beratung und Kommunikation
- 4.2.1 Klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers
- 4.2.2 Vernetzungen zu Partnerorganisationen
- 4.2.3 Beratung zur Rekonstruktion durch plastische Chirurgie
- 4.3 Aufklärung und Prävention
- 4.3.1 Einbezug von Männern
- 4.3.2 Empowerment zum Aufbrechen patriarchaler Strukturen
- 4.3.3 Umgang mit vermuteter und tatsächlicher Gefährdung
- 4.1 Notwendigkeit kultursensibler Sozialer Arbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) bei geflüchteten eritreischen Frauen und analysiert die Notwendigkeit kultursensibler Sozialer Arbeit in diesem Kontext. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe von FGM/C in Eritrea, die Folgen für betroffene Frauen und entwickelt Handlungsansätze für eine professionelle und respektvolle Unterstützung.
- Die Hintergründe und Ursachen von FGM/C in Eritrea
- Die körperlichen, psychischen und sexuellen Folgen von FGM/C
- Die Herausforderungen und Chancen kultursensibler Sozialer Arbeit
- Methoden der professionellen Beratung und Kommunikation mit betroffenen Frauen
- Präventionsmaßnahmen und Möglichkeiten der Aufklärung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) ein und verortet die Thematik im Kontext der Menschenrechte und der Sozialen Arbeit. Sie betont die ethischen Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen kulturellen Praktiken und dem Schutz der individuellen Rechte ergeben und begründet die Notwendigkeit kultursensibler Interventionen. Der Mangel an Wissen und Sensibilität im Umgang mit betroffenen Frauen in westlichen Gesellschaften wird als Ausgangspunkt der Arbeit hervorgehoben.
2. Eritrea: Hintergründe und Fluchtursachen: Dieses Kapitel beleuchtet die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Eritrea, die zu Fluchtbewegungen in andere Länder führen. Es werden die Ursachen der Flucht, wie politische Repression, Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche Notlage, detailliert analysiert, um den Kontext für die Verbreitung von FGM/C in der eritreischen Diaspora zu verstehen. Die Darstellung der Lebensumstände in Eritrea schafft die Grundlage, um die Motivationen von FGM/C in der eritreischen Bevölkerung besser zu verstehen und einzuschätzen.
3. Weibliche Genitalbeschneidung am Beispiel von Eritrea: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung von FGM/C in Eritrea. Es beschreibt verschiedene Formen der Beschneidung, deren Verbreitung und die dahinterliegenden Motive (Tradition, soziale Integration, Ästhetik, Religion). Es werden die schwerwiegenden körperlichen, psychischen und sexuellen Folgen für die betroffenen Frauen detailliert erläutert. Zusätzlich werden internationale Gesetzeslagen und Präventionsbemühungen thematisiert, um den globalen Rahmen der Problematik zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Integration der Thematik innerhalb der Migrationskontexte.
4. Kompetente und kultursensible Soziale Arbeit mit geflüchteten Frauen: Das Kapitel widmet sich der Entwicklung von professionellen und kultursensiblen Ansätzen der Sozialen Arbeit. Es definiert kultursensible Soziale Arbeit, präsentiert verschiedene theoretische Modelle und Prinzipien, und beschreibt konkrete Methoden der Beratung und Kommunikation. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Einbindung von Männern in die Präventionsarbeit und das Empowerment von Frauen zur Überwindung patriarchaler Strukturen. Der Umgang mit vermuteten oder tatsächlichen Gefährdungen wird ebenfalls adressiert.
Schlüsselwörter
Weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C), Eritrea, Flucht, Migration, Kultursensible Soziale Arbeit, Beratung, Prävention, Empowerment, Menschenrechte, Patriarchat, Trauma, interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) bei geflüchteten eritreischen Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C) bei geflüchteten eritreischen Frauen und analysiert die Notwendigkeit kultursensibler Sozialer Arbeit in diesem Kontext. Sie beleuchtet die Hintergründe von FGM/C in Eritrea, die Folgen für betroffene Frauen und entwickelt Handlungsansätze für eine professionelle und respektvolle Unterstützung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Hintergründe und Ursachen von FGM/C in Eritrea, die körperlichen, psychischen und sexuellen Folgen von FGM/C, die Herausforderungen und Chancen kultursensibler Sozialer Arbeit, Methoden der professionellen Beratung und Kommunikation mit betroffenen Frauen sowie Präventionsmaßnahmen und Möglichkeiten der Aufklärung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Eritrea: Hintergründe und Fluchtursachen, Weibliche Genitalbeschneidung am Beispiel von Eritrea, Kompetente und kultursensible Soziale Arbeit mit geflüchteten Frauen und Fazit. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer Einführung in die Thematik und endend mit einem Fazit und Handlungsempfehlungen.
Was wird in Kapitel 2 ("Eritrea: Hintergründe und Fluchtursachen") behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Eritrea, die zu Fluchtbewegungen führen. Es untersucht Ursachen wie politische Repression, Menschenrechtsverletzungen und wirtschaftliche Notlage, um den Kontext für die Verbreitung von FGM/C in der eritreischen Diaspora zu verstehen.
Was wird in Kapitel 3 ("Weibliche Genitalbeschneidung am Beispiel von Eritrea") behandelt?
Kapitel 3 bietet eine umfassende Darstellung von FGM/C in Eritrea, beschreibt verschiedene Formen der Beschneidung, deren Verbreitung und Motive (Tradition, soziale Integration, Ästhetik, Religion). Es erläutert detailliert die körperlichen, psychischen und sexuellen Folgen für betroffene Frauen und thematisiert internationale Gesetzeslagen und Präventionsbemühungen im Migrationskontext.
Was wird in Kapitel 4 ("Kompetente und kultursensible Soziale Arbeit mit geflüchteten Frauen") behandelt?
Kapitel 4 konzentriert sich auf professionelle und kultursensible Ansätze der Sozialen Arbeit. Es definiert kultursensible Soziale Arbeit, präsentiert theoretische Modelle und Prinzipien, und beschreibt Methoden der Beratung und Kommunikation. Es betont die Einbindung von Männern in die Präventionsarbeit, das Empowerment von Frauen und den Umgang mit Gefährdungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weibliche Genitalbeschneidung (FGM/C), Eritrea, Flucht, Migration, Kultursensible Soziale Arbeit, Beratung, Prävention, Empowerment, Menschenrechte, Patriarchat, Trauma, interkulturelle Kompetenz.
Welche konkreten Handlungsansätze werden in der Arbeit vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt konkrete Handlungsansätze für eine professionelle und respektvolle Unterstützung geflüchteter eritreischer Frauen vor, die FGM/C erlebt haben. Dies beinhaltet Methoden der kultursensiblen Beratung und Kommunikation, Präventionsmaßnahmen und Strategien zur Stärkung der Frauen und zum Aufbrechen patriarchaler Strukturen. Die genaue Ausgestaltung der Handlungsansätze wird im Kapitel zur kultursensiblen Sozialen Arbeit detailliert beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Sozialarbeiter*innen, Berater*innen, Therapeut*innen, Mitarbeiter*innen von Hilfsorganisationen, sowie Wissenschaftler*innen und Studierende, die sich mit den Themen Flucht, Migration, Frauenrechte, interkulturelle Kompetenz und kultursensible Soziale Arbeit beschäftigen.
- Quote paper
- Jenny Schmit (Author), 2021, Weibliche Genitalbeschneidung bei geflüchteten Frauen aus Eritrea. Ein Beispiel kultursensibler Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1159194