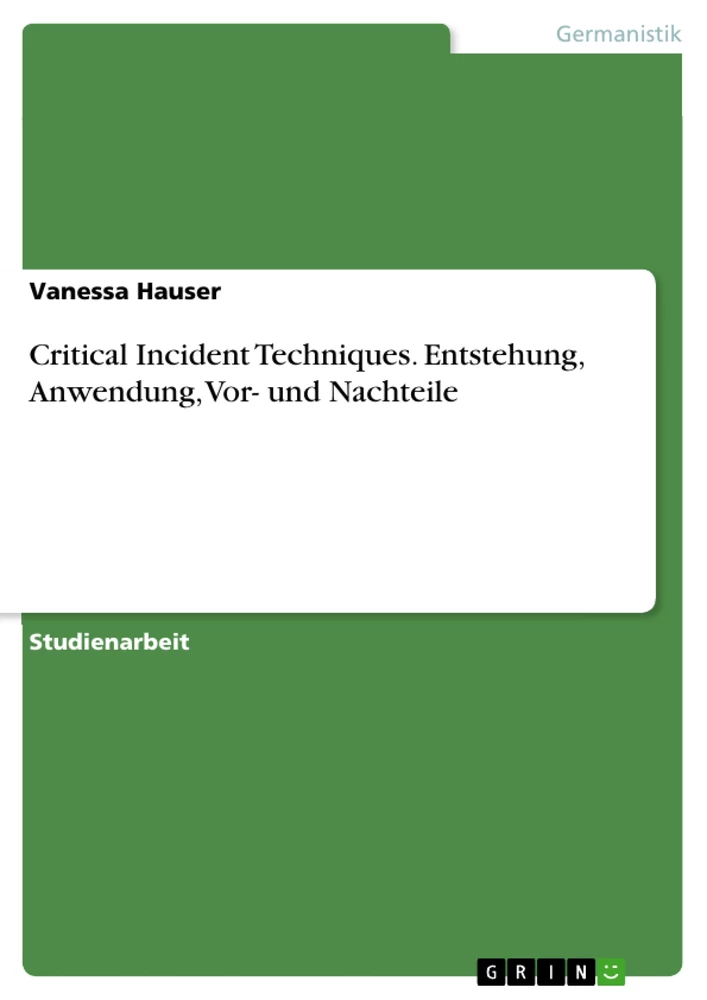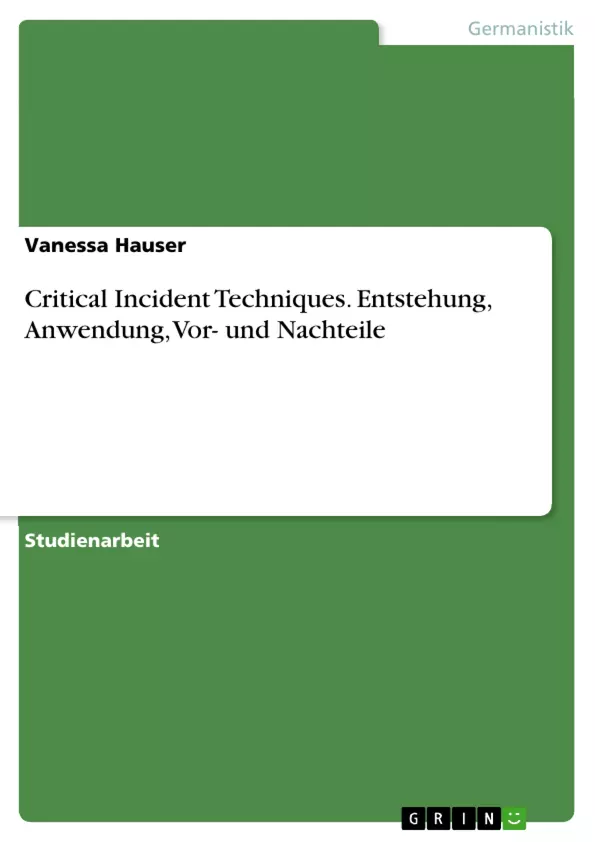Diese Arbeit befasst sich mit den "critical incident techniques" (CITs). Ausgegangen wird von den Forschungsfragen: Nach welchen Verfahren werden CITs entwickelt und wie werden sie angewendet – vor allem im Bereich der interkulturellen Kommunikation? Welche Vor- und Nachteile weisen die CITs auf?
Zum ersten Mal fiel in den 1960er-Jahren der Begriff der Globalisierung, der für eine internationale Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt und Politik steht. Globalisierung umfasst aber nicht nur Staaten oder große Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen, die aus anderen Nationen stammen und miteinander in Verbindung treten.
Seither haben jedoch zahlreiche Veränderungen stattgefunden, vor allem im digitalen Bereich: Durch die Entwicklung und den Ausbau der technologischen Errungenschaft des Internets ist es nun möglich geworden, nicht nur politische und wirtschaftliche Informationen auszutauschen, sondern auch Privatpersonen können weltweit über das WorldWideWeb miteinander in Kontakt treten.
Auch moderne Verkehrsmittel haben zu einer engeren Zusammenarbeit beziehungsweise zum Aufeinandertreffen von Menschen aus allen kulturellen Kreisen geführt. Zwischenzeitlich ist das Reisen mit den unterschiedlichsten Transportmitteln, wie der Bahn, dem Schiff, dem Auto und auch natürlich der Luftfahrt, für alle zugänglich und leistbar geworden. Insbesondere der Flugverkehr hat das Reisen in weit entfernte Staaten nicht nur für Politiker, Manager und Unternehmer ermöglicht, auch immer mehr Privatpersonen verreisen aus den unterschiedlichsten Gründen – egal ob in den Urlaub, zum neuen Arbeitsplatz, zum Studentenaustausch oder zum Praktikum – ins Ausland. Ungeachtet dessen, wie verschiedenartig die Gründe des Aufenthaltes in einem fremden Gebiet ausfallen mögen, kommt es mehr oder weniger häufig zum Kontakt beziehungsweise kommunikativen Austausch zwischen Menschen mit kulturell anderen Ansichten und Lebensweisen. Eng verbunden mit der Globalisierung, ja sogar ein wichtiger Bestandteil dieser, ist die Kommunikation zwischen den Kulturen. Jedoch kann es aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Herkünfte zu Schwierigkeiten und Missverständnissen kommen, den sog. "kritischen Ereignissen" oder "Critical Incidents".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Entstehung und Entwicklung von Critical Incident Techniques
- 2. Das Verfahren der CIT
- 3. Anwendungsbereiche der Critical Incident Technique
- 4. CITs und interkulturelle Kommunikation
- 5. Vor- und Nachteile der CIT-Methode als Trainingsprogramm
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Critical Incident Technique (CIT) und deren Anwendung, insbesondere im Bereich der interkulturellen Kommunikation. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der CIT, erläutert das Verfahren und beleuchtet verschiedene Anwendungsbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Vor- und Nachteile der Methode als Trainingsprogramm.
- Entstehung und Entwicklung der Critical Incident Technique
- Das Verfahren der CIT und dessen Anwendung
- Anwendungsbereiche der CIT, insbesondere in der interkulturellen Kommunikation
- Vorteile und Nachteile der CIT als Trainingsmethode
- Die Rolle der Semiotik im Kontext kritischer Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Globalisierung und der zunehmenden interkulturellen Kommunikation. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die durch kulturelle Unterschiede entstehen können, und die Notwendigkeit, kritische Ereignisse (Critical Incidents) zu verstehen und zu bewältigen. Die Arbeit begründet die Relevanz der Critical Incident Technique (CIT) als Methode zur Analyse und zum Umgang mit solchen Ereignissen im Rahmen der Semiotik. Die Forschungsfragen werden formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen.
1. Die Entstehung und Entwicklung von Critical Incident Techniques: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der CIT, beginnend bei ihrem Urheber John C. Flanagan und deren Anwendung im Kontext der US Air Force. Es wird die Frage diskutiert, wie viel Wissen über eine fremde Kultur notwendig ist, um Probleme in der Interaktion zu vermeiden, und der Ansatz des Lernens an Fallbeispielen als Grundlage für die CIT wird dargestellt. Die Entwicklung und Anwendung der CIT in verschiedenen Bereichen wird beschrieben und durch Beispiele illustriert. Die Bedeutung von Fallbeispielen für das Verstehen und Vermeiden von Fehlern im interkulturellen Kontext wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Critical Incident Technique (CIT), interkulturelle Kommunikation, Globalisierung, Semiotik, Missverständnisse, kulturelle Unterschiede, Fallbeispiele, Trainingsprogramm, Fehlervermeidung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Critical Incident Technique (CIT) und Interkulturelle Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Critical Incident Technique (CIT) und ihrer Anwendung, insbesondere im Bereich der interkulturellen Kommunikation. Sie untersucht die Entstehung und Entwicklung der CIT, erläutert das Verfahren und beleuchtet verschiedene Anwendungsbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Vor- und Nachteile der Methode als Trainingsprogramm.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der CIT, das Verfahren der CIT und dessen Anwendung, Anwendungsbereiche der CIT (insbesondere in der interkulturellen Kommunikation), die Vor- und Nachteile der CIT als Trainingsmethode und die Rolle der Semiotik im Kontext kritischer Ereignisse. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Kapitel und ein Fazit (nicht explizit im gegebenen HTML, aber implizit vorhanden).
Wer ist der Urheber der Critical Incident Technique?
Die CIT geht auf John C. Flanagan zurück und wurde zunächst im Kontext der US Air Force angewendet.
Welche Rolle spielt die Semiotik in dieser Arbeit?
Die Rolle der Semiotik wird im Kontext kritischer Ereignisse untersucht. Die Arbeit beleuchtet, wie semiotische Aspekte zu Missverständnissen und Problemen in der interkulturellen Kommunikation beitragen können und wie die CIT dabei helfen kann, diese zu analysieren und zu bewältigen.
Welche Vor- und Nachteile der CIT als Trainingsmethode werden diskutiert?
Die Seminararbeit analysiert die Vor- und Nachteile der CIT als Trainingsprogramm im Detail. Diese Aspekte werden jedoch im gegebenen Textauszug nicht explizit genannt.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Entstehung und Entwicklung der CIT, dem Verfahren der CIT, den Anwendungsbereichen, der CIT und interkultureller Kommunikation und schließlich den Vor- und Nachteilen der CIT als Trainingsprogramm. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Critical Incident Technique (CIT), interkulturelle Kommunikation, Globalisierung, Semiotik, Missverständnisse, kulturelle Unterschiede, Fallbeispiele, Trainingsprogramm, Fehlervermeidung.
Welche Bedeutung haben Fallbeispiele in der CIT?
Fallbeispiele sind die Grundlage der CIT-Methode. Sie dienen dem Verständnis und der Vermeidung von Fehlern im interkulturellen Kontext.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit interkultureller Kommunikation, Trainingsmethoden und der Analyse kritischer Ereignisse beschäftigen. Sie ist besonders nützlich für Personen, die in internationalen Kontexten arbeiten oder entsprechende Trainings durchführen.
- Arbeit zitieren
- Vanessa Hauser (Autor:in), 2019, Critical Incident Techniques. Entstehung, Anwendung, Vor- und Nachteile, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1158856