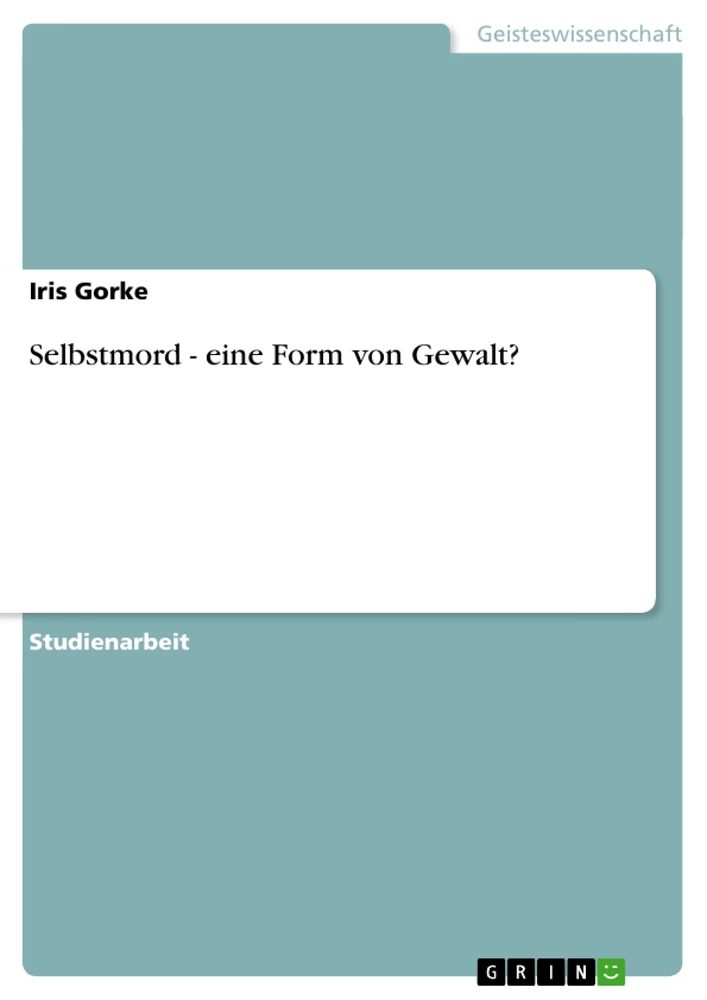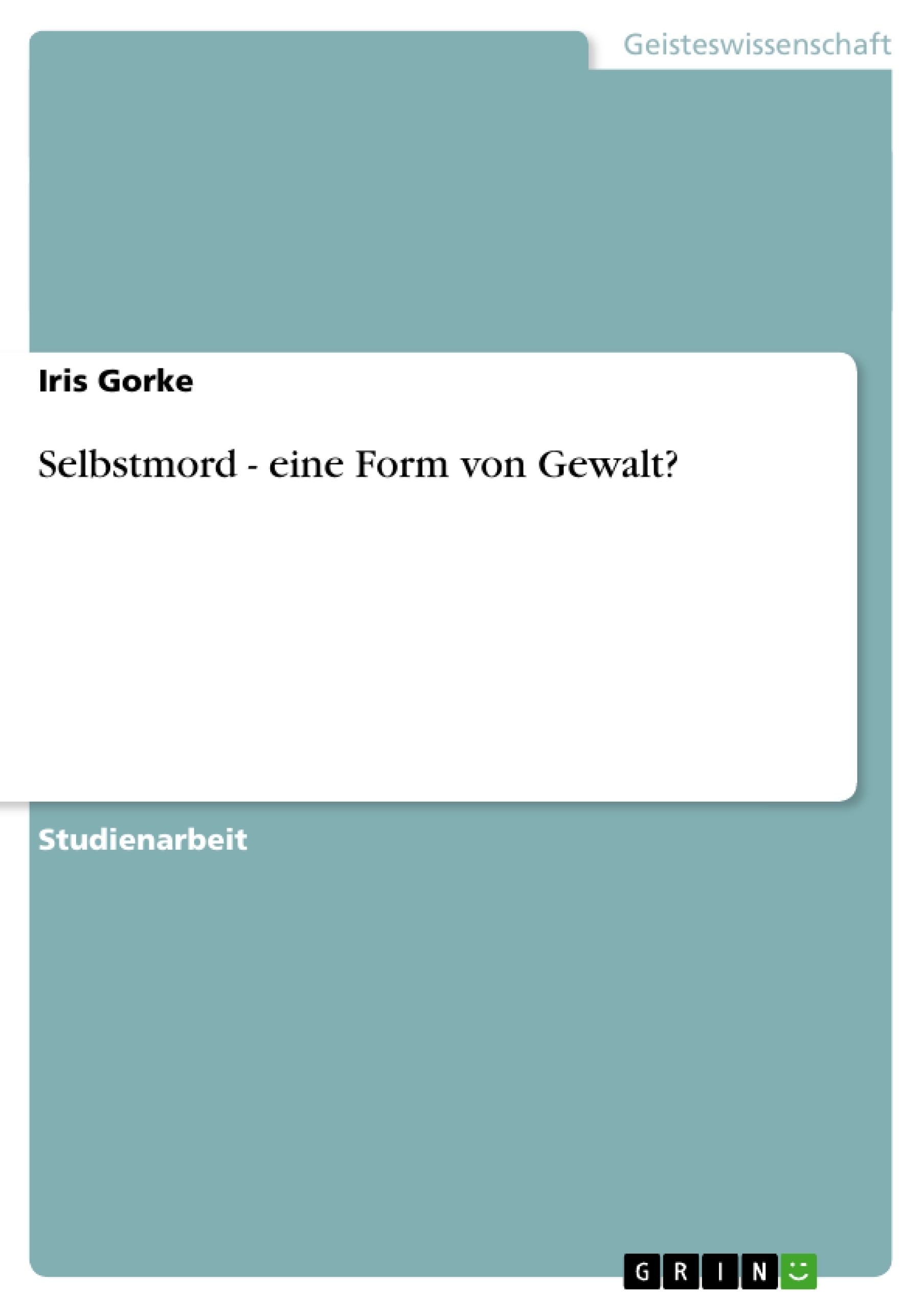Seit den Terroranschlägen vom 11. September ist das Thema der Gewalt global von besonderer Brisanz. Es vergeht kein Tag, an dem nicht in den Medien über Ursachen, Formen und Auswirkungen von Gewalt diskutiert wird. Dachte man bis dahin beim Begriff Gewalt zuerst an physische und psychische Verletzungen durch Prügeleien, Raubüberfälle, gewalttätige Familienväter oder dergleichen, so wird einem spätestens hier –übrigens mit ebenso brachialer Gewalt- vor Augen geführt, wie eng Gewalt an Macht gebunden ist. Die islamischen Extremisten demonstrierten, dass sie fähig sind, auch einen übermächtigen Gegner zu verletzen; dass sie mächtig genug sind, die Weltmacht USA in Angst und Schrecken zu versetzen. So steht im Lexikon: „Gewalt ist eine Form der Ausübung von Macht durch Anwendung von Zwangsmitteln; Gewalt kann sowohl physisch als auch psychisch ausgeübt werden. Gewalt-Verhältnisse tragen zunächst stets einseitigen Charakter, können jedoch Gegengewalt provozieren.“ 1
Gewalttätigkeit kann also als Möglichkeit zu Machtdemonstration, Machterringung oder Erhaltung der Macht betrachtet werden. Erweitert man seinen Blickwinkel, ist Gewalt aber um vieles facettenreicher. Johann Galtung definiert das Vorliegen von Gewalt, „wenn Menschen so beeinflusst werden, dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist, als ihre potentielle Verwirklichung.“2
Hier wird nun auch die sogenannte „strukturelle Gewalt“ mit einbezogen. Wenn Gewalt dort beginnt, wo der Mensch in seinen Handlungs- und Entwicklungsspielräumen bzw. Chancen eingeschränkt ist, dann bilden Gesetze und Regeln, Moral, aber auch Religion die Mittelvarianten der strukturellen Gewalt. Staat, Gesellschaft, Kultur und Religion üben strukturelle Gewalt über das Individuum aus, wenn sie, völlig legal, den Einzelnen durch Vorschriften in seinen Möglichkeiten einschränken. Die Gewalt wird gesetzlich. Politische Entscheidungen, die den Einzelnen empfindlich verletzen können, entstehen in einer Demokratie aus Mehrheitsentscheidungen. Die Mehrheit besitzt gestalterische Macht, was aber ist mit der Minderheit? Sie kann Opfer struktureller Gewalt werden. Obdachlose beispielsweise sind oft eine Zielscheibe struktureller Gewalt. Mit dem Instrument von Sondernutzungssatzungen werden sie von öffentlichen Plätzen, aus Einkaufspassagen oder Bahnhöfen vertrieben. Die Gewalt ist auch in diesem Fall durch Satzungen legitimiert [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Klärung des Gewaltbegriffs.
- 2. Der Selbstmord
- 2.1 Begriffliche Definition des Selbstmords
- 2.2 Der Suizid in der historischen Betrachtung
- 2.3 Statistiken
- 2.4 Der Zusammenhang vom Depression und Suizid
- 2.5 Suizidale Verhaltensweisen
- 2.6 Die suizidale Krise
- 2.6.1 Erwägungsstadium
- 2.6.2 Ambivalenzstadium
- 2.6.3 Entschlussstadium
- 2.7 Präsuizidales Syndrom
- 2.7.1 Einengung
- 2.7.2 Aggressionsstau und Umkehr
- 2.7.3 Todesphantasien
- 2.8 Resümee: Das „Opfer- ein Täter“?
- 3. Überprüfung der Erkenntnisse an einem Beispiel und einem Interview
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Selbstmord als eine Form von Gewalt betrachtet werden kann. Sie analysiert den Begriff der Gewalt, untersucht die Ursachen und Folgen von Selbstmord und beleuchtet die verschiedenen Aspekte der suizidalen Krise.
- Definition des Gewaltbegriffs und seine verschiedenen Ausprägungen
- Analyse der Ursachen und Folgen von Selbstmord
- Die suizidale Krise und ihre Stadien
- Der Zusammenhang zwischen Depression und Suizid
- Das „Opfer- ein Täter“-Dilemma im Kontext von Selbstmord
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel klärt den Gewaltbegriff und seine vielfältigen Ausprägungen. Es wird deutlich, dass Gewalt nicht nur physische oder psychische Verletzungen umfasst, sondern auch strukturelle Formen annehmen kann, die den Einzelnen in seinen Handlungsspielräumen einschränken. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Selbstmord. Es analysiert die Definition, die historischen Entwicklungen, die Statistik und die psychischen Faktoren, die zu Suizid führen können. Es werden die verschiedenen Stadien der suizidalen Krise und das präsuizidale Syndrom beschrieben. Das dritte Kapitel untersucht die gewonnenen Erkenntnisse anhand eines konkreten Beispiels und eines Interviews.
Schlüsselwörter
Gewalt, Selbstmord, Suizid, Depression, Aggressionsstau, Todesphantasien, strukturelle Gewalt, präsuizidales Syndrom, Opfer-Täter-Dilemma.
- Quote paper
- Iris Gorke (Author), 2002, Selbstmord - eine Form von Gewalt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11580