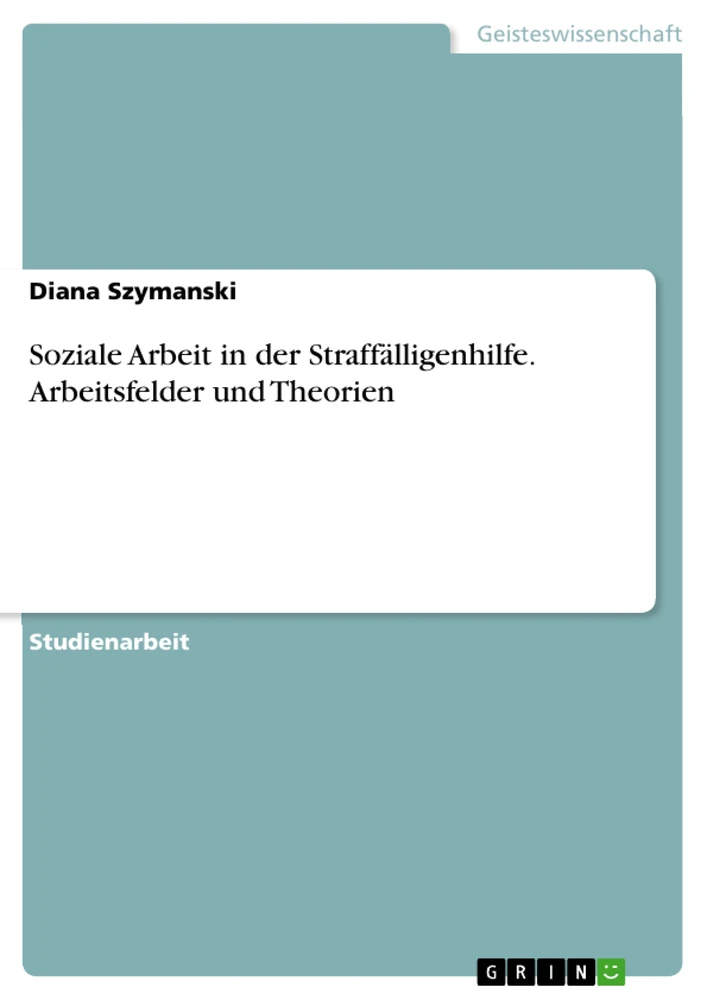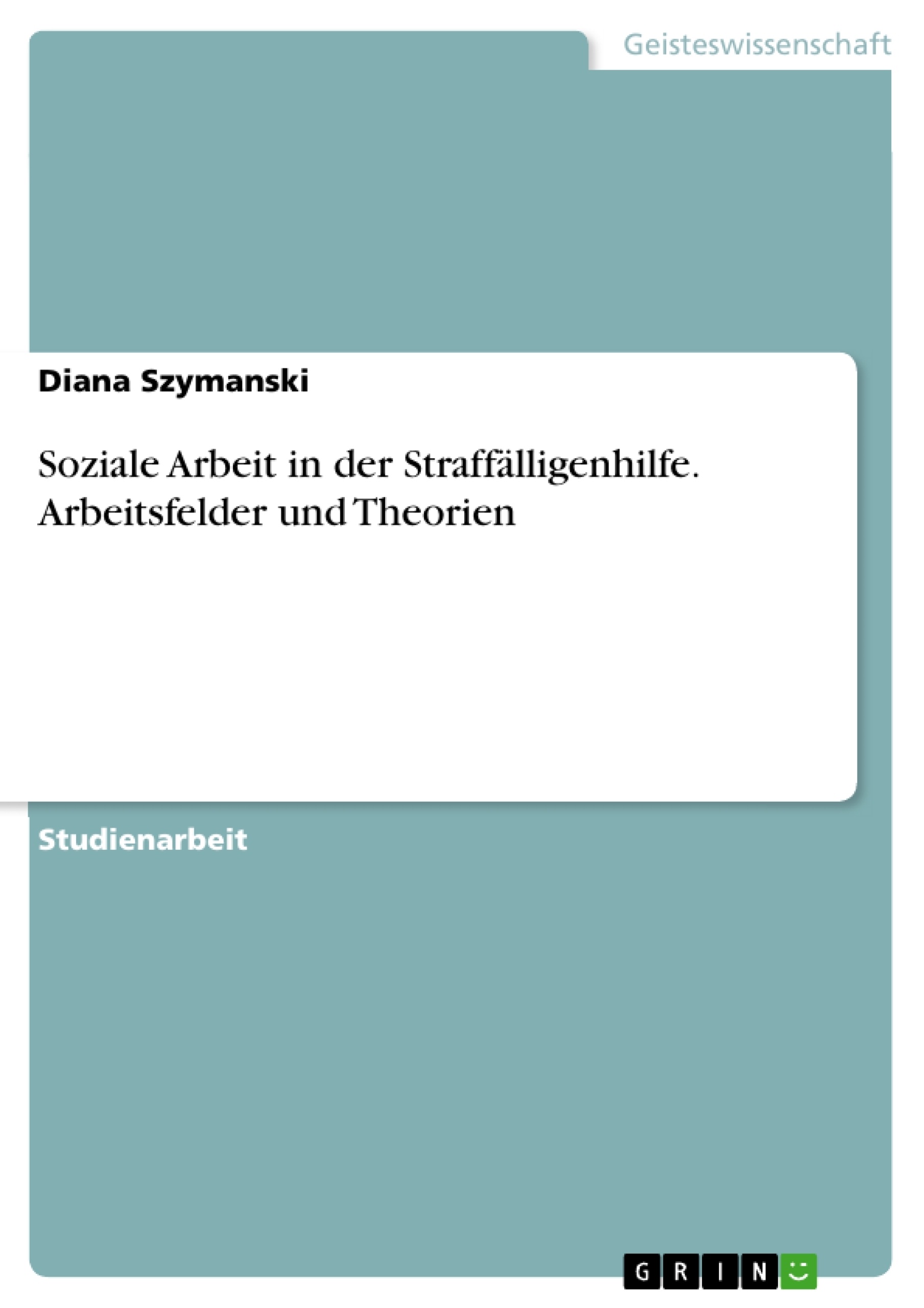Um der Fragestellung "Welchen Handlungsraum hat die Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe?" gerecht zu werden wird die Autorin dieser Arbeit im Folgenden die verschiedenen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe aufzeigen und den Bezug der Kriminalitätstheorien zur Praxis darlegen. Im Anschluss wird ein Praxisproblem und dessen Lösung erläutert.
Das Strafrecht ist für unsere Gesellschaft die Basis des Zusammenlebens. Durch das Strafgesetzbuch werden Regeln für das soziale Verhalten und Konsequenzen der Überschreitung eben dieser bestimmt. Die Grundlagen der Strafbarkeit werden in den Paragraphen 13-15 des Strafgesetzbuches aufgeführt: das Begehen durch Unterlassen, das Handeln für einen anderen, sowie vorsätzliches und fahrlässiges Handeln werden strafrechtlich verfolgt. Ebenfalls der Versuch einer Straftat wird nach § 23 StGB geahndet. Diese strafbaren Handlungen haben bei Begehen Konsequenzen
zur Folge. Je nach schwere des Verbrechens oder Vergehens kann und soll der Täter in gewissem Maße bestraft werden. Dies wird durch Freiheitsentzug, Bewährung, Geldstrafen, Nebenstrafen oder Auflagen gewährleistet.
Nach § 1 Absatz 2 des Jugendgerichtsgesetzes gelten 14–18 Jährige als Jugendliche und 18– 21 Jährige als Heranwachsende. Die Jugendlichen und Heranwachsenden werden durch das Jugendgerichtsgesetz geschützt. Sollte zwischen 14 und 21 Jahren eine Straftat begangen werden, werden Erziehungsmaßregeln angeordnet. Sollten diese Maßnahmen nicht genügen kommt eine Jugendstrafe zum Einsatz. Diese Folgen sind nach § 5 des JGG geregelt. Grundsätzlich werden Menschen jeden Alters als straffällig bezeichnet, sollte eine Straftat begangen worden sein.
Neben den unterschiedlichen Rechtsorganen spielt ebenso die Soziale Arbeit eine große Rolle im Strafprozess. Im Vordergrund steht dabei die Begleitung, die Beratung und die Resozialisierung der Straffälligen. Im Jahr 2017 berichtet das Bundeskriminalamt von insgesamt 5.761.984 erfassten Straftaten in Deutschland. Davon wurden lediglich 57,1% aufgeklärt. Zu erwähnen ist hierbei auch der Aspekt, dass die Dunkelziffer, der nicht erfassten Straftaten deutlich höher sein mag. Die vorliegenden Zahlen zeigen die Aktualität sowie die Notwendigkeit der Straffälligenhilfe in unserer Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Klassische Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe
- 2.1 Freie Straffälligenhilfe
- 2.2 Maßregelvollzug
- 2.3 Jugendgerichtshilfe
- 2.4 Weitere Arbeitsfelder
- 3 Kriminalitätstheorien für die Soziale Arbeit
- 4 Methodisches Vorgehen bei unfreiwilligen Klienten
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Handlungsraum Sozialer Arbeit in der Straffälligenhilfe. Sie beleuchtet klassische Arbeitsfelder, verbindet diese mit relevanten Kriminalitätstheorien und analysiert methodische Herausforderungen im Umgang mit unfreiwilligen Klienten.
- Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe
- Relevanz von Kriminalitätstheorien für die Praxis
- Methodisches Vorgehen bei unfreiwilligen Klienten
- Teilhabeorientierung in der Straffälligenhilfe
- Herausforderungen und Chancen Sozialer Arbeit im Strafvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe ein und begründet die Relevanz des Themas anhand von Statistiken zur Kriminalität in Deutschland. Sie hebt die Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Begleitung, Beratung und Resozialisierung von Straffälligen hervor und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Welchen Handlungsraum hat die Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe? Die Einleitung legt den Fokus auf die anschließende Darstellung der verschiedenen Arbeitsfelder und die Verknüpfung mit Kriminalitätstheorien.
2 Klassische Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe: Dieses Kapitel definiert Soziale Arbeit im Kontext der Straffälligenhilfe als Teilhabehilfe, die darauf abzielt, materielle, körperliche, psychische, soziale, kulturelle und ökologische Ressourcen eines Individuums zu fördern. Es beschreibt die vielfältigen Arbeitsfelder und Zielgruppen der Straffälligenhilfe, die sich von der Unterstützung von Tätern bis zur Arbeit mit Angehörigen und Opfern erstrecken. Die verschiedenen Arbeitsfelder werden im Detail betrachtet, und die Vielfalt der angebotenen Hilfen und die damit verbundenen Herausforderungen werden erläutert.
2.1 Freie Straffälligenhilfe: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Freie Straffälligenhilfe, die sich durch ein breites Spektrum an präventiven und unterstützenden Maßnahmen auszeichnet. Die Arbeit reicht von Schuldnerberatung und Anti-Aggressivitäts-Training bis hin zur Unterstützung bei der Erfüllung von Auflagen und der Entlassungsvorbereitung. Die Grundprinzipien der Freien Straffälligenhilfe – Freiwilligkeit, Langwierigkeit, konsistente Zuständigkeit und umfassende Betreuung – werden hervorgehoben. Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld der Betroffenen wird ebenfalls betont.
2.2 Maßregelvollzug: Das Kapitel behandelt den Maßregelvollzug, der Sicherungsverwahrung, forensische Psychiatrie und Entziehungsanstalt umfasst. Für jeden Bereich werden die rechtlichen Grundlagen und die spezifischen Herausforderungen für die Soziale Arbeit erläutert. Die Arbeit mit Straftätern in der Sicherungsverwahrung konzentriert sich auf die Förderung der Motivation zum selbstständigen und gesetzeskonformen Leben. In der forensischen Psychiatrie liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit verschiedenen Professionen und der Bewältigung der Herausforderung, die Krankheitseinsicht der Betroffenen zu fördern. Im Bereich der Entziehungsanstalt steht die Suchttherapie und die Vermeidung von Rückfällen im Vordergrund.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Straffälligenhilfe, Kriminalität, Resozialisierung, Teilhabe, Prävention, Maßregelvollzug, Freie Straffälligenhilfe, Methoden, unfreiwillige Klienten, Kriminalitätstheorien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Handlungsraum Sozialer Arbeit in der Straffälligenhilfe. Sie untersucht klassische Arbeitsfelder, verbindet diese mit relevanten Kriminalitätstheorien und analysiert methodische Herausforderungen im Umgang mit unfreiwilligen Klienten. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu den klassischen Arbeitsfeldern (Freie Straffälligenhilfe, Maßregelvollzug, Jugendgerichtshilfe und weitere), Kriminalitätstheorien, methodischem Vorgehen bei unfreiwilligen Klienten und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche klassischen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Straffälligenhilfe werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt detailliert verschiedene Arbeitsfelder, darunter die Freie Straffälligenhilfe mit ihren präventiven und unterstützenden Maßnahmen (Schuldnerberatung, Anti-Aggressivitäts-Training etc.), den Maßregelvollzug (Sicherungsverwahrung, forensische Psychiatrie, Entziehungsanstalt) mit seinen rechtlichen Grundlagen und Herausforderungen, die Jugendgerichtshilfe und weitere relevante Bereiche. Es wird die Vielfalt der Hilfen und die damit verbundenen Herausforderungen erläutert.
Welche Bedeutung haben Kriminalitätstheorien in dieser Arbeit?
Die Arbeit verbindet die beschriebenen Arbeitsfelder mit relevanten Kriminalitätstheorien, um ein umfassenderes Verständnis der Hintergründe und des Handelns von Straftätern zu ermöglichen und die Praxis der Sozialen Arbeit fundierter zu gestalten. Die konkreten Theorien werden jedoch nicht explizit benannt.
Wie wird das methodische Vorgehen bei unfreiwilligen Klienten behandelt?
Ein eigenes Kapitel widmet sich den methodischen Herausforderungen im Umgang mit unfreiwilligen Klienten in der Straffälligenhilfe. Konkrete Methoden werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet: Welchen Handlungsraum hat die Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe? Die Arbeit untersucht den Handlungsraum Sozialer Arbeit in der Straffälligenhilfe, beleuchtet klassische Arbeitsfelder, verbindet diese mit relevanten Kriminalitätstheorien und analysiert methodische Herausforderungen im Umgang mit unfreiwilligen Klienten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Arbeit, Straffälligenhilfe, Kriminalität, Resozialisierung, Teilhabe, Prävention, Maßregelvollzug, Freie Straffälligenhilfe, Methoden, unfreiwillige Klienten, Kriminalitätstheorien.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Die Arbeit enthält Zusammenfassungen für die Einleitung (Einführung in die Thematik, Begründung der Relevanz, Forschungsfrage), das Kapitel zu den klassischen Arbeitsfeldern (Definition Soziale Arbeit im Kontext Straffälligenhilfe als Teilhabehilfe, Beschreibung der Arbeitsfelder und Zielgruppen), und die Unterkapitel zu Freier Straffälligenhilfe (Fokus auf präventive und unterstützende Maßnahmen) und Maßregelvollzug (Beschreibung der Bereiche Sicherungsverwahrung, forensische Psychiatrie und Entziehungsanstalt).
- Quote paper
- Diana Szymanski (Author), 2019, Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe. Arbeitsfelder und Theorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1157877