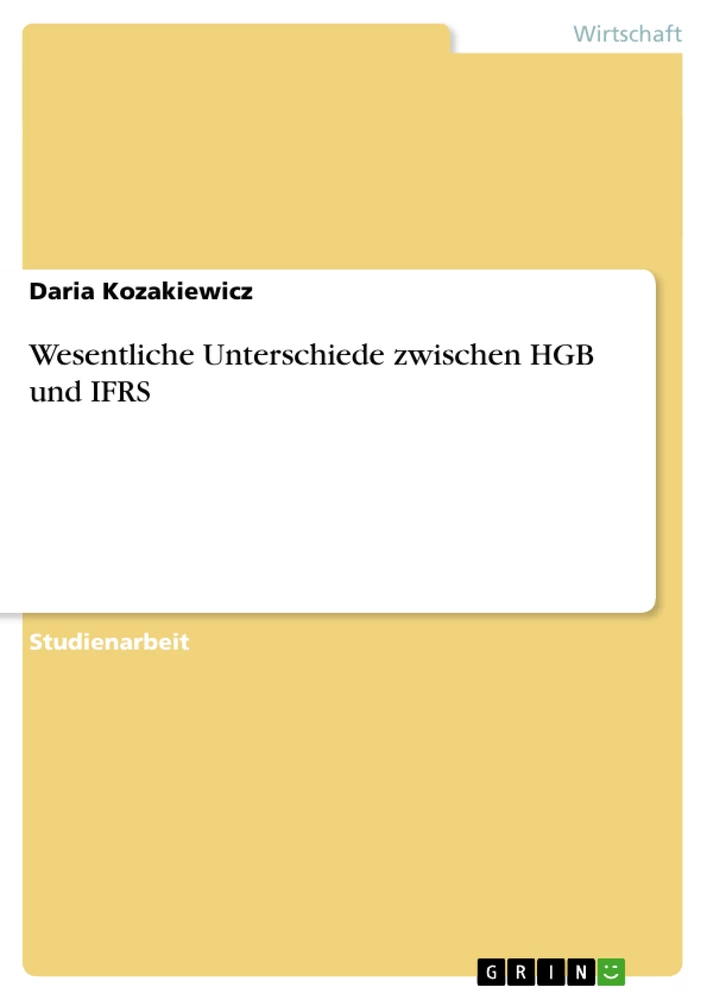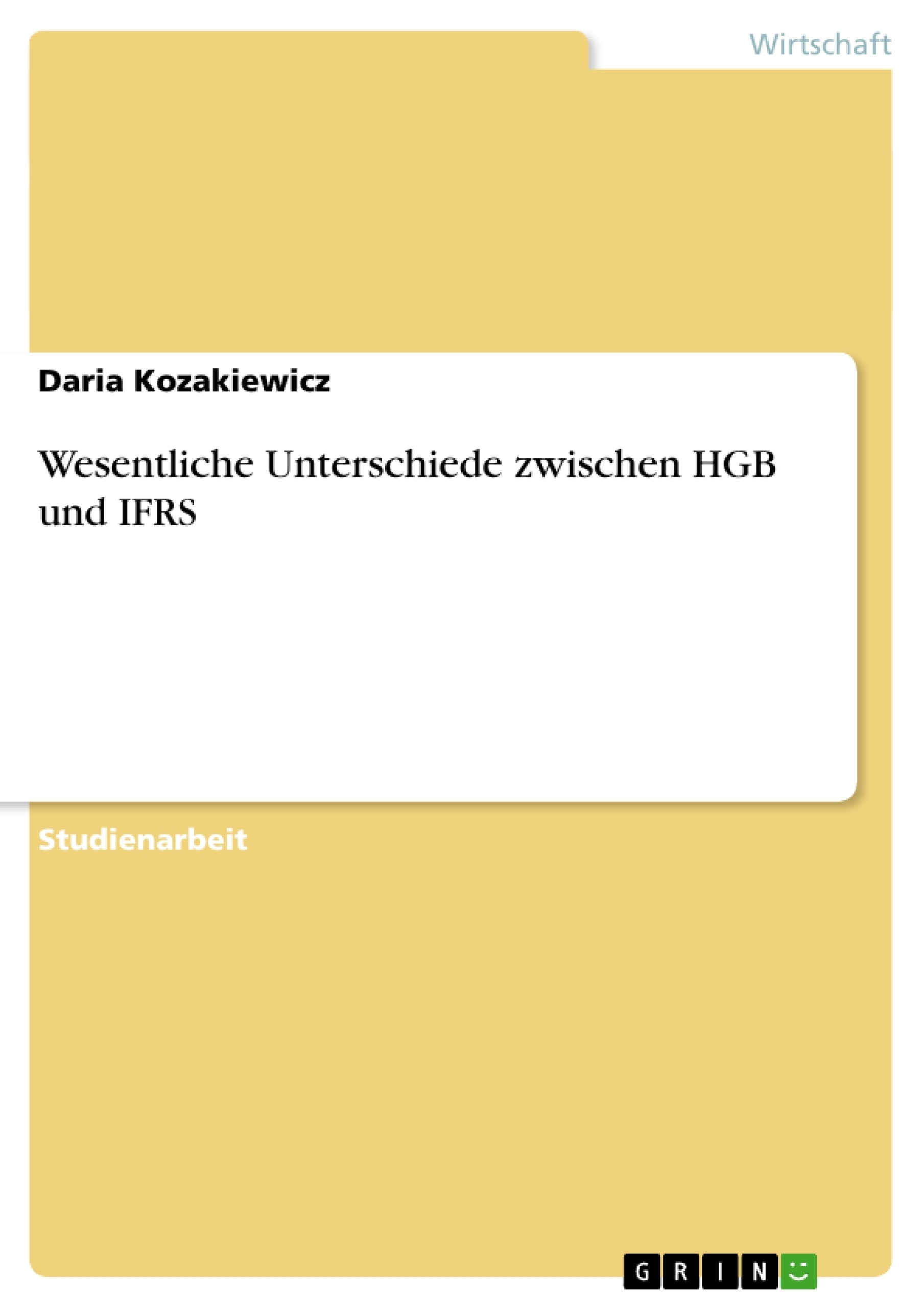In der Wirtschaft ist zunehmend eine internationale Verflechtung festzustellen. So werden Waren, Dienstleistungen und Kapital grenzüberschreitend gehandelt. Im Zuge dieser Globalisierung wachsen die Güter- und Finanzmärkte stark zusammen. Diese Veränderung führt dazu, dass ein einheitliches Rechnungslegungssystem verlangt wird, damit z.B. Kapitalanleger weltweit nach den günstigsten Anlagealternativen suchen können.
Im Rahmen dieser Arbeit, werden die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Rechnungslegungssystem des HGB und des IFRS deutlich gemacht. Um sich mit der wesentlichen Materie auseinander setzen zu können, werden erstmals die Begriffe der beiden Systeme erläutert. Durch die Vertiefung der Rechnungslegungsziele und Rechnungslegungsinstrumente, wird deutlich gemacht, dass die jeweiligen Systeme unterschiedliche Einzeljahresabschlüsse bzw. Konzernjahresabschlüsse vermitteln wollen. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, alle Unterscheidungen der Bilanzierung und Bewertung zu erläutern. Es wird deshalb der Fokus auf die Rückstellungen gerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historie
- 2.1. HGB
- 2.2. IFRS
- 3. Definition
- 3.1. HGB
- 3.2. IFRS
- 4. Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS
- 4.1. Ziele der Rechnungslegung
- 4.1.1. HGB
- 4.1.2. IFRS
- 4.2. Instrumente der Rechnungslegung
- 4.2.1. HGB
- 4.2.2. IFRS
- 4.3. Bilanzierung und Bewertung am Beispiel der Rückstellungen
- 4.3.1. HGB
- 4.3.2. IFRS
- 4.1. Ziele der Rechnungslegung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die wesentlichen Unterschiede zwischen den Rechnungslegungssystemen HGB und IFRS. Ziel ist es, die jeweiligen Systeme im Hinblick auf ihre Ziele, Instrumente und die Bilanzierung von Rückstellungen zu vergleichen und die Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit verzichtet auf eine vollständige Darstellung aller Unterschiede und konzentriert sich auf die Kernaspekte.
- Vergleich der Rechnungslegungsziele von HGB und IFRS
- Analyse der unterschiedlichen Instrumente der Rechnungslegung nach HGB und IFRS
- Untersuchung der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen unter HGB und IFRS
- Historische Entwicklung des HGB und des IFRS
- Definition und Abgrenzung der beiden Rechnungslegungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft und der Notwendigkeit eines einheitlichen Rechnungslegungssystems. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit, die im Wesentlichen im Vergleich des HGB und des IFRS liegt, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Historie: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des HGB, beginnend mit dem ADHGB von 1861, und seine fünf Bücher, sowie die Entstehung und Entwicklung des IFRS, hervorgegangen aus der IASC und der späteren Gründung des IASB. Die Notwendigkeit internationaler Rechnungslegungsstandards im Zuge der Globalisierung wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf die Öffnung der internationalen Kapitalmärkte und die damit verbundene Forderung nach Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen.
3. Definition: Das Kapitel definiert das HGB als Sonderprivatrecht der Kaufleute und erläutert seine Bedeutung für den Jahresabschluss, insbesondere durch die GoB. Es definiert die IFRS als Sammlung internationaler Rechnungslegungsstandards, die vom IASB herausgegeben werden und durch das Framework und Interpretationen ergänzt werden. Der Unterschied zwischen den rein nationalen Regelungen des HGB und den internationalen Standards des IFRS wird hier deutlich herausgearbeitet.
4. Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS: Dieses Kapitel vergleicht HGB und IFRS hinsichtlich ihrer Rechnungslegungsziele und -instrumente. Im Fokus steht die unterschiedliche Gewichtung von Gläubigerschutz (HGB) und Investor Relations (IFRS). Die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen wird exemplarisch verglichen, um die praktischen Unterschiede der beiden Systeme zu veranschaulichen. Die unterschiedlichen Adressaten der jeweiligen Rechnungslegung werden ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
HGB, IFRS, Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung, Rückstellungen, Globalisierung, Internationalisierung, Jahresabschluss, Konzernjahresabschluss, Gläubigerschutz, Anlegerinteressen, GoB, IASB, IAS, Gewinnermittlung, Kapitalerhaltung, entscheidungsrelevante Informationen.
Häufig gestellte Fragen: Vergleich HGB und IFRS
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Unterschiede zwischen den Rechnungslegungssystemen HGB (Handelsgesetzbuch) und IFRS (International Financial Reporting Standards). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Ziele, Instrumente und der Bilanzierung von Rückstellungen beider Systeme.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die historische Entwicklung sowohl des HGB als auch des IFRS, definiert beide Systeme und vergleicht sie detailliert hinsichtlich ihrer Ziele (Gläubigerschutz vs. Anlegerinteressen), Instrumente der Rechnungslegung und der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen. Die unterschiedlichen Adressaten der jeweiligen Rechnungslegung werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Historie (mit Unterkapiteln zu HGB und IFRS), Definition (ebenfalls mit Unterkapiteln zu HGB und IFRS), Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS (mit Unterkapiteln zu Zielen, Instrumenten und der Bilanzierung von Rückstellungen) und Fazit. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen HGB und IFRS?
Die zentralen Unterschiede liegen in den unterschiedlichen Zielen der Rechnungslegung: HGB priorisiert den Gläubigerschutz, während IFRS die Interessen der Investoren in den Vordergrund stellt. Dies spiegelt sich in den unterschiedlichen Instrumenten und der Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen wider. Der Vergleich von Rückstellungen dient als Beispiel, um die praktischen Unterschiede zu veranschaulichen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die wesentlichen Unterschiede zwischen HGB und IFRS aufzuzeigen, indem es die jeweiligen Systeme im Hinblick auf ihre Ziele, Instrumente und die Bilanzierung von Rückstellungen vergleicht. Es konzentriert sich auf die Kernaspekte und verzichtet auf eine vollständige Darstellung aller Unterschiede.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die Schlüsselwörter umfassen HGB, IFRS, Rechnungslegung, Bilanzierung, Bewertung, Rückstellungen, Globalisierung, Internationalisierung, Jahresabschluss, Konzernjahresabschluss, Gläubigerschutz, Anlegerinteressen, GoB, IASB, IAS, Gewinnermittlung, Kapitalerhaltung und entscheidungsrelevante Informationen.
Welche historische Entwicklung wird beschrieben?
Die historische Entwicklung umfasst die Entstehung des HGB (beginnend mit dem ADHGB von 1861) und seine fünf Bücher sowie die Entwicklung des IFRS, hervorgegangen aus der IASC und der späteren Gründung des IASB. Die Notwendigkeit internationaler Rechnungslegungsstandards im Zuge der Globalisierung wird hervorgehoben.
Wie werden HGB und IFRS definiert?
HGB wird als Sonderprivatrecht der Kaufleute definiert und seine Bedeutung für den Jahresabschluss, insbesondere durch die GoB (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung), erläutert. IFRS wird als Sammlung internationaler Rechnungslegungsstandards definiert, die vom IASB herausgegeben werden und durch das Framework und Interpretationen ergänzt werden. Der Unterschied zwischen den nationalen Regelungen des HGB und den internationalen Standards des IFRS wird herausgestellt.
- Quote paper
- Daria Kozakiewicz (Author), 2008, Wesentliche Unterschiede zwischen HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115771