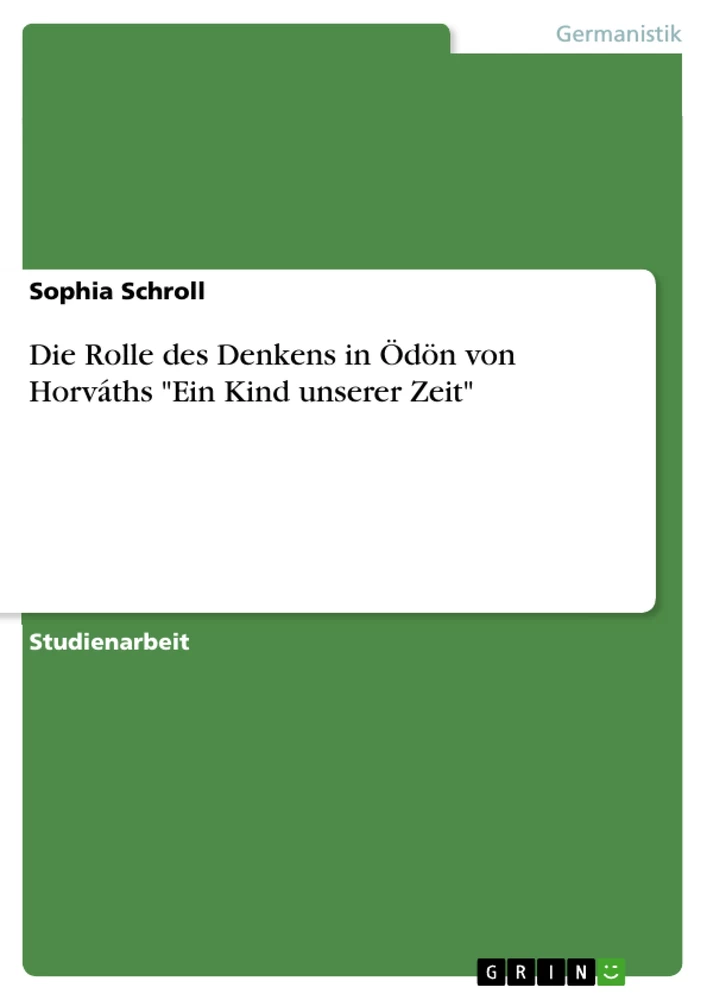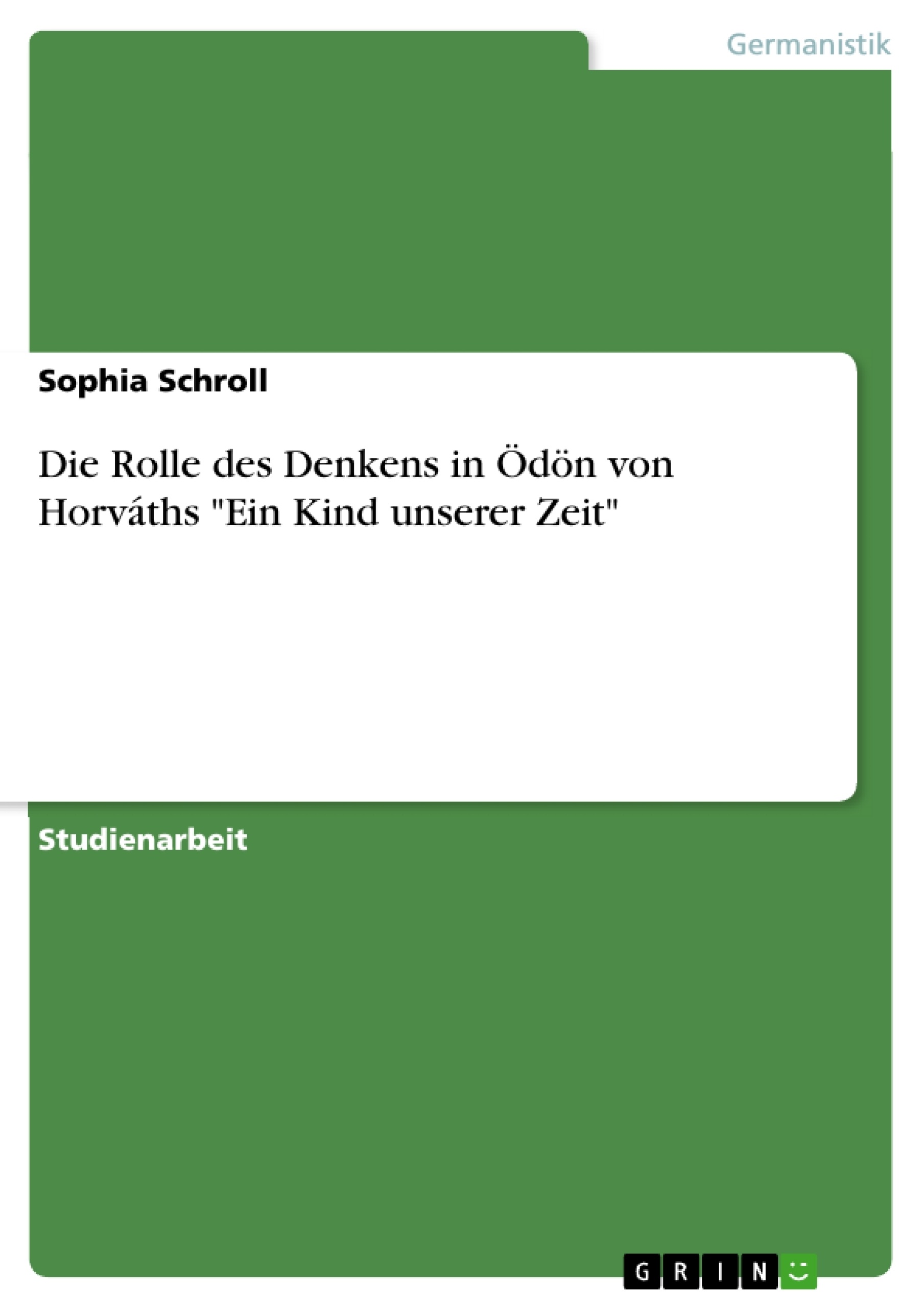Den Roman Ein Kind unserer Zeit stellte Ödön von Horváth zu Beginn des Jahres 1938 fertig, so dass er in Teilen wohl gleichzeitig zu einer anderen, vom Umfang her um einiges größeren Arbeit Horváths entstand, nämlich Jugend ohne Gott. Der Autor erlebte das Erscheinen seines Werkes im Amsterdamer Exilverlag Allert de Lange im Sommer 1938 nicht mehr, da er bereits am 1. Juni in den Champs-Elysées in Paris von einem herunterstürzenden Ast erschlagen worden ist. Beiden Romanen ist nicht nur gemeinsam, dass sie bereits im selben Jahr von den Nationalsozialisten auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt wurden , sondern auch, dass sie beide das Leben im faschistischen Staat beschreiben. Diese Beschreibung erfolgt zwar beide Male in der Ich-Erzählung, jedoch aus zwei unterschiedlichen Perspektiven; einerseits aus der Sicht des intellektuellen Lehrers bei Jugend ohne Gott und andererseits aus der Sicht des völlig systemkonformen Soldaten bei Ein Kind unserer Zeit. Axel Fritz, der in seinem 1973 erschienenen Werk Ödön von Horváth als Kritiker seiner Zeit besonders auf die Rolle Horváths als Zeitzeuge eingeht, äußert sich über dessen literarisches Schaffen folgendermaßen:
„Horváth zeigt darüber hinaus auch die Hintergründe und Ursachen des äußeren Zeitgeschehens, das in seinem Werk eine so dominierende Rolle spielt: die soziale, geistige und moralische Konstitution des mittelständischen Spießbürgertums, sein aus Traditionalismus, Standesdenken, Egoismus und Dummheit geprägtes (falsches) Bewusstsein, das die politische Entwicklung zum Faschismus ermöglichen half.“
Tatsächlich spielt das von Fritz erwähnte „falsche Bewusstsein“ als Ursache für den Faschismus in beiden Werken eine große Rolle, denn schließlich durchlaufen beide Hauptfiguren einen „Bewusstseinswandel“, der sie letztendlich dann dem Regime gegenüberstellt. Der Lehrer wandelt sich von einem ängstlichen Skeptiker des Systems zu einem öffentlichen Protestler, während der Soldat aufgrund seiner enttäuschenden Erfahrungen vom überzeugten Anhänger zum aggressiven Kritiker wird. Die immense Wichtigkeit des individuellen Denkens und Reflektierens, welches einem solchen Bewusstseinswandel unweigerlich zugrunde liegen muss, liegt auf der Hand. Daher soll auch die Rolle des Denkens in Horváths Roman Ein Kind unserer Zeit in Zusammenhang mit dem Bewusstseinswandel der Hauptfigur im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle des Denkens bei „,Ein Kind unserer Zeit"
- Ausgangssituation
- Der Generationenkonflikt
- Überzeugte Anhängerschaft_
- Sprache des Soldaten nach faschistischem Vorbild
- Man soll nicht denken, sondern handeln!
- Der Bewusstseinswandel des Soldaten
- Das Schicksal des Hauptmanns – der Auslöser_
- Das Schicksal des Soldaten - der Wandel
- Das langsame Aufbrechen der Denkblockade
- Der Vollzug des individuellen Denkens
- Das Schicksal der Kassiererin - Aggressive Kritik.
- Die Ermordung des Buchhalters - Abschluss mit der eigenen Vergangenheit
- Ausgangssituation
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Proseminararbeit befasst sich mit der Rolle des Denkens im Roman „Ein Kind unserer Zeit“ von Ödön von Horváth. Ziel ist es, die Entwicklung des Denkens der Hauptfigur, eines Soldaten, im Kontext des faschistischen Regimes zu analysieren und die Bedeutung des individuellen Denkens für den Bewusstseinswandel des Protagonisten zu beleuchten.
- Der Generationenkonflikt als Motor des Denkens
- Die Rolle des faschistischen Systems in der Denkblockade des Soldaten
- Der Bewusstseinswandel des Soldaten durch individuelle Erfahrungen
- Die Bedeutung des Denkens für die Kritik am System
- Die Verbindung von individueller Erfahrung und politischer Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman „Ein Kind unserer Zeit“ von Ödön von Horváth in den Kontext der Zeit und des Werkes des Autors. Sie beleuchtet die Entstehung des Romans im Exil und die Kritik des Autors am faschistischen Regime. Die Einleitung führt außerdem die zentrale These der Arbeit ein: Die Rolle des Denkens im Bewusstseinswandel des Soldaten.
Das zweite Kapitel analysiert die Ausgangssituation des Soldaten. Es werden der Generationenkonflikt und die völlige Anhängerschaft des Soldaten an das faschistische System als prägende Faktoren für seine Denkweise dargestellt. Der Generationenkonflikt wird als Motor für den Denkprozess des Soldaten beschrieben, während die Überzeugung des Soldaten vom System seine denkerische Entwicklung blockiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Bewusstseinswandel des Soldaten. Es wird gezeigt, wie die Erfahrungen des Soldaten, insbesondere das Schicksal des Hauptmanns, seine Denkblockade aufbrechen. Der Soldat beginnt, das System zu hinterfragen und entwickelt ein individuelles Denken, das ihn zu einem aggressiven Kritiker des Regimes macht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rolle des Denkens, den Bewusstseinswandel, den Generationenkonflikt, das faschistische System, die Kritik am Regime, die individuelle Erfahrung und die politische Kritik. Der Text analysiert die Entwicklung des Denkens eines Soldaten im Kontext des faschistischen Regimes und zeigt, wie individuelle Erfahrungen und das Denken zu einem Bewusstseinswandel und einer Kritik am System führen können.
- Quote paper
- Sophia Schroll (Author), 2008, Die Rolle des Denkens in Ödön von Horváths "Ein Kind unserer Zeit" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115763