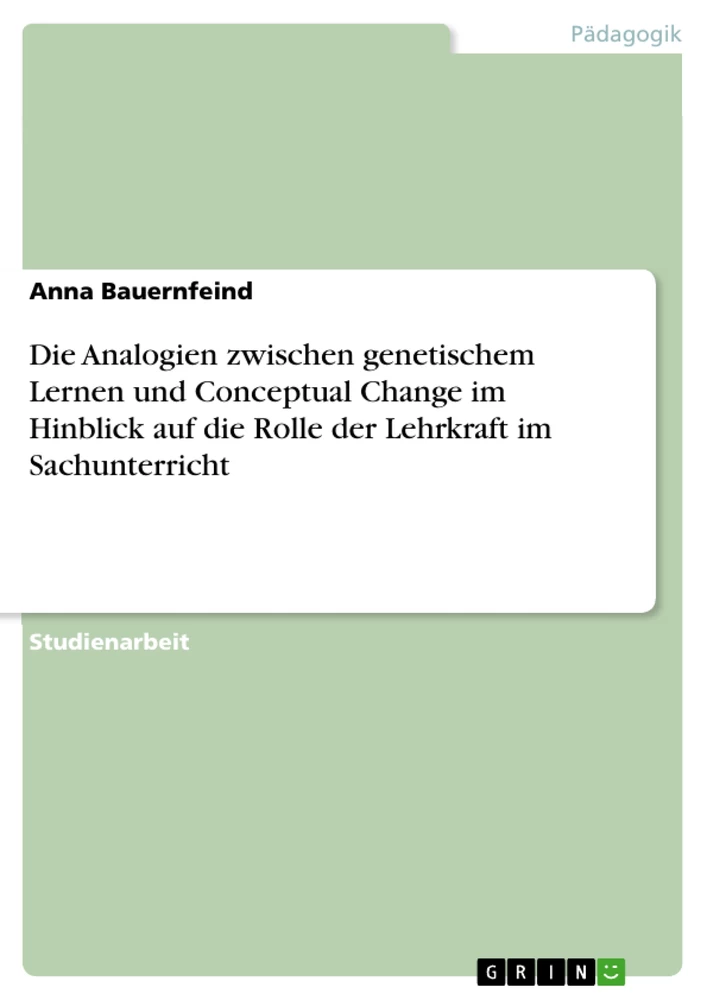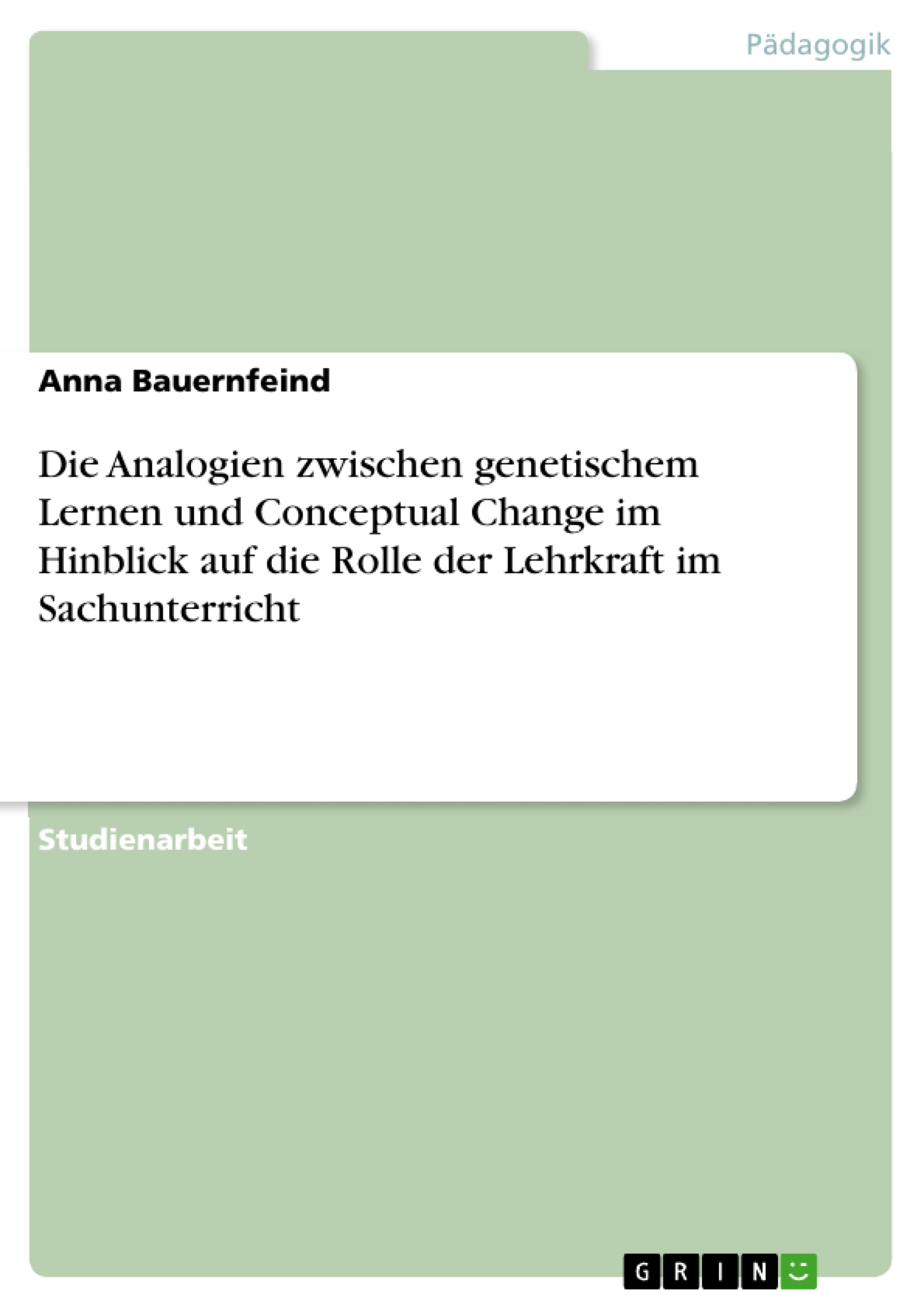Der Pädagoge und Physiklehrer Martin Wagenschein verfolgte den Anspruch, dem Individuum Gelegenheiten zu eröffnen, zu einem selbstständigen, kritisch-hinterfragenden, sozialen und konstruktiven Mitglied der Gesellschaft heranzureifen. Sein großes Anliegen ist in dem Konzept des "Genetischen Lernens" wiederzufinden. Was darunter zu verstehen ist und wie es möglich sein kann, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Lehrkraft physikalische Relationen im Sachunterricht begreifen lernen, wird im ersten Teil dieser Arbeit beleuchtet. Inwieweit Vorstellungen der Lernenden durch geeignete Lernangebote verändert werden können, wird anschließend anhand des Conceptual Change aufgezeigt. Nach der Gegenüberstellung beider Theorien wird im Hinblick auf die Analogien die Rolle der Lehrkraft im Sachunterricht herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Genetisches Lernen
- Genetisch-sokratischer Sachunterricht nach Wagenschein/Thiel (1973)
- Genetische Lehren und Lernen als Dreischritt
- Conceptual Change
- Definition
- Konzeptwechselarten
- Konditionen für Conceptual Change
- Kohärenz von Genetischem Lernen und Conceptual Change
- Rolle der Lehrkraft
- Scaffolding als Unterstützungsmaßnahme
- Scaffolding im naturwissenschaftlichen Sachunterricht
- Genetisches Lernen
- Praxisbeispiel im Sachunterricht der Grundschule
- Projekttag zum Thema „Schwimmen und Sinken“
- Lehrplanbezug
- Perspektivrahmen Sachunterricht
- Einbettung in die Unterrichtssequenz und Lernvoraussetzungen
- Kompetenzerwartungen
- Ablauf des Projekttags
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Analogien zwischen dem Genetischen Lernen und Conceptual Change im Hinblick auf die Rolle der Lehrkraft im Sachunterricht. Sie analysiert die Konzepte des Genetischen Lernens nach Wagenschein und des Conceptual Change, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Darüber hinaus untersucht sie die Rolle der Lehrkraft bei der Unterstützung von Lernprozessen und die Bedeutung von Scaffolding im naturwissenschaftlichen Sachunterricht.
- Genetisches Lernen nach Wagenschein
- Conceptual Change und seine Konditionen
- Analogien zwischen Genetischem Lernen und Conceptual Change
- Rolle der Lehrkraft im Sachunterricht
- Scaffolding als Unterstützungsmaßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der bayrischen Verfassung und die Bedeutung ganzheitlicher Lehr- und Lernprozesse dar. Sie führt das Konzept des Genetischen Lernens ein und erklärt seine Relevanz für den Sachunterricht. Das zweite Kapitel widmet sich dem theoretischen Hintergrund, beginnend mit dem Genetischen Lernen nach Wagenschein und seinen zentralen Zielen: allgemeine Bildung, produktive Findigkeit, Einwurzelung und kritisches Vermögen. Es wird erläutert, wie dieses Konzept in der Praxis umgesetzt werden kann und welche Rolle die Lehrkraft dabei spielt.
Im Anschluss werden die Konzepte des Conceptual Change und seiner Definition, Arten und Konditionen diskutiert. Die Arbeit zeigt die Kohärenz zwischen Genetischem Lernen und Conceptual Change auf und beleuchtet die Rolle der Lehrkraft im Sachunterricht, insbesondere im Hinblick auf Scaffolding als Unterstützungsmaßnahme. Schließlich präsentiert das dritte Kapitel ein Praxisbeispiel im Sachunterricht der Grundschule: ein Projekttag zum Thema „Schwimmen und Sinken“, der die Verbindung zwischen Theorie und Praxis aufzeigt.
Schlüsselwörter
Genetisches Lernen, Conceptual Change, Sachunterricht, Lehrkraft, Scaffolding, allgemeine Bildung, produktive Findigkeit, Einwurzelung, kritisches Vermögen, Projekttag, Schwimmen und Sinken.
- Quote paper
- Anna Bauernfeind (Author), 2021, Die Analogien zwischen genetischem Lernen und Conceptual Change im Hinblick auf die Rolle der Lehrkraft im Sachunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1156640