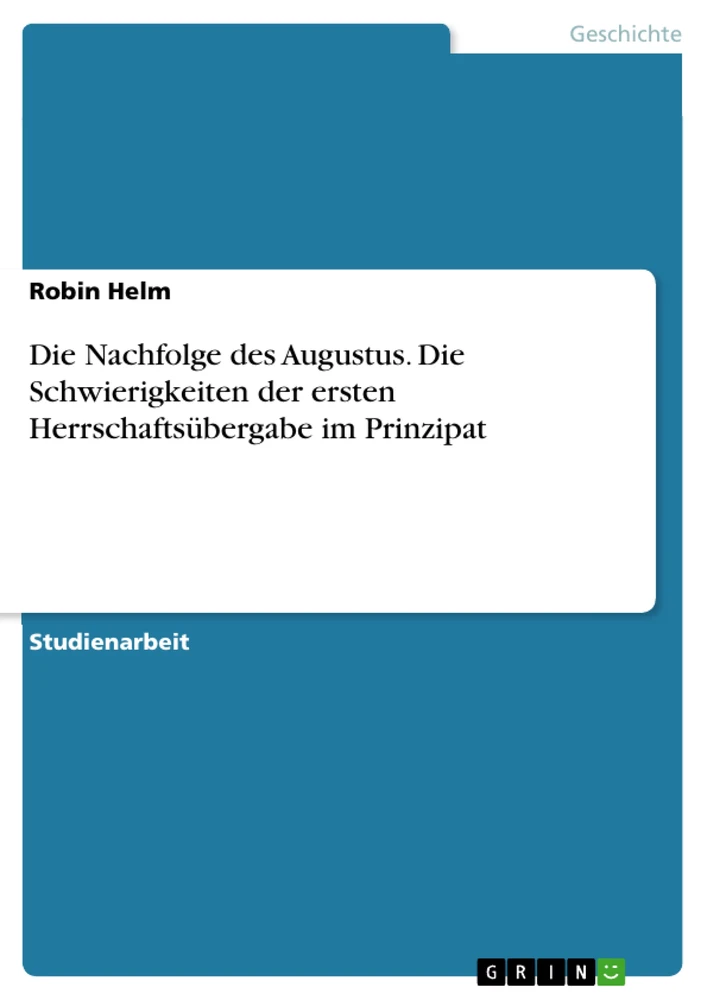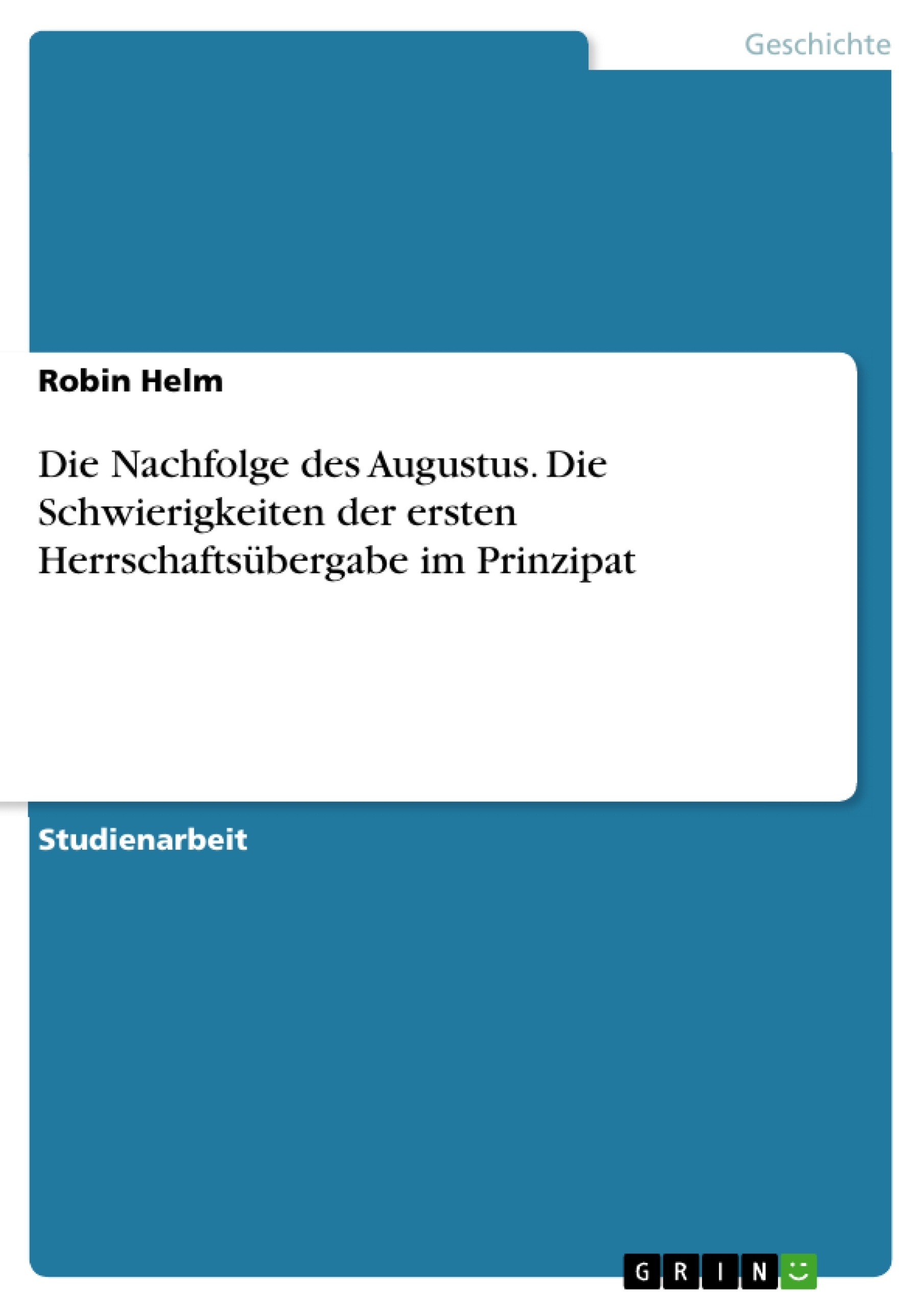In der vorliegenden Hausarbeit wird der Versuch unternommen, die Nachfolgeproblematiken, mit denen Augustus konfrontiert war, zu ergründen. Welche Kriterien und Methoden wandte Augustus an, um eine möglichst geräuschlose Herrschaftsübergabe zu gewährleisten? Wer waren die präsumtiven Nachfolgekandidaten im Konzert der Nachfolgeregelung? Aus diesen Gründen wird im Hauptteil auch die Rede von Marcellus, Agrippa, Gaius und Lucius Caesar sowie schlussendlich von Tiberius sein. Zuvor werden die Grundzüge des Prinzipats skizziert und die daraus resultierenden Besonderheiten im Hinblick auf die Nachfolgeproblematik aufgeworfen. Danach folgt die Auseinandersetzung mit der Nachfolgepolitik des Augustus und die Beantwortung der genannten Fragestellung. Zuletzt fasst die Schlussbetrachtung die wesentlichen Punkte der Ausarbeitung nochmals zusammen. Für diese Hausarbeit dienten als zentrale Quellen die Historia Romana von Velleius Paterculus, die Kaiserviten Suetons, die Annalen von Tacitus und das Geschichtswerk des Cassius Dio.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wesentliche Grundzüge der augusteischen Ausnahmestellung
- Grundproblematik und Grundvoraussetzungen der Nachfolge
- Die schwierige Nachfolgepolitik des Augustus
- Marcellus und Agrippa
- Gaius und Lucius Caesar sowie Tiberius im Konzert der Nachfolge
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Nachfolgeplanung Augusts im Prinzipat. Sie analysiert die Kriterien für die Auswahl eines Nachfolgers, die angewandten Methoden zur Sicherstellung eines reibungslosen Machtwechsels und die Rolle der potentiellen Kandidaten – Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar und Tiberius.
- Die Besonderheiten des augusteischen Prinzipats und dessen Auswirkungen auf die Nachfolge
- Die Schwierigkeiten der Übertragung der außergewöhnlichen Machtfülle Augusts
- Die Kriterien der Nachfolgekandidatenwahl
- Die Rolle der verschiedenen Nachfolgekandidaten
- Die Strategien Augusts zur Sicherung der Dynastie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Jahr 27 v. Chr. als eine Zäsur in der römischen Geschichte. Octavian, der Adoptivsohn Caesars, gab seine Macht an den Senat zurück und erhielt den Ehrennamen Augustus. Er begründete das Prinzipat, ein inoffizielles Herrschaftssystem, das den Anschein der Republik wahrend, faktisch eine neue Form der Herrschaft etablierte. Augustus strebte nach der Sicherung seiner Machtposition und der seines Geschlechts, der Julischen Familie, auch über seinen Tod hinaus. Um dies zu gewährleisten, musste er frühzeitig einen geeigneten Nachfolger finden, was sich als schwierig erwies, da das Prinzipat nicht vererbbar war. Die Arbeit untersucht daher die Nachfolgeproblematiken Augusts und die angewandten Methoden zur Sicherung eines geräuschlosen Machtwechsels.
2. Wesentliche Grundzüge der augusteischen Ausnahmestellung: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlage der Macht Augusts: das imperium proconsulare (maius) und die tribunicia potestas, verliehen vom Senat. Zusätzlich stützte sich seine Macht auf sein immenses Privatvermögen, seine große Klientel und sein hohes Ansehen (auctoritas). Augustus nutzte sein Vermögen geschickt, um den römischen Staat abhängig zu machen und sich die Loyalität des Heeres und des Volkes zu sichern. Das Prinzipat war ein fragiles System, dessen Legitimation auf der Akzeptanz von Plebs, Heer und Senat beruhte. Augustus musste kontinuierlich Leistungen erbringen, um diese Gruppen zufrieden zu stellen.
Schlüsselwörter
Augustus, Prinzipat, Nachfolge, Julisch-claudische Dynastie, imperium proconsulare, tribunicia potestas, auctoritas, Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar, Tiberius, Machtübergabe, Römische Republik, Res publica restituta.
Häufig gestellte Fragen zu: Die Nachfolgeproblematik Augusts im Prinzipat
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Nachfolgeplanung Kaiser Augusts im römischen Prinzipat. Sie analysiert die Kriterien für die Auswahl eines Nachfolgers, die angewandten Methoden zur Sicherstellung eines reibungslosen Machtwechsels und die Rolle der potentiellen Kandidaten – Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar und Tiberius.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Besonderheiten des augusteischen Prinzipats und dessen Auswirkungen auf die Nachfolge, die Schwierigkeiten der Übertragung der außergewöhnlichen Machtfülle Augusts, die Kriterien der Nachfolgekandidatenwahl, die Rolle der verschiedenen Nachfolgekandidaten und die Strategien Augusts zur Sicherung der Dynastie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einleitung beschreibt den Beginn des Prinzipats und die Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung für Augustus. Das Kapitel über die „Wesentlichen Grundzüge der augusteischen Ausnahmestellung“ analysiert die Machtbasis Augusts (imperium proconsulare, tribunicia potestas, auctoritas, Vermögen und Klientel). Weitere Kapitel befassen sich mit der schwierigen Nachfolgepolitik Augusts, insbesondere den Kandidaten Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar und Tiberius. Eine Schlussbetrachtung rundet die Arbeit ab.
Wer waren die wichtigsten Nachfolgekandidaten Augusts?
Die wichtigsten potentiellen Nachfolger Augusts waren Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar und Tiberius. Die Arbeit analysiert die Rolle jedes einzelnen Kandidaten im Kontext der Nachfolgeplanung.
Welche Rolle spielten imperium proconsulare und tribunicia potestas für die Nachfolge?
Das imperium proconsulare (maius) und die tribunicia potestas waren zentrale Bestandteile der Macht Augusts. Die Arbeit untersucht, wie die Übertragung dieser Machtpositionen in der Nachfolge geplant und letztendlich umgesetzt wurde, und welche Schwierigkeiten damit verbunden waren.
Wie sicherte Augustus die Macht der Julischen Familie?
Augustus versuchte durch sorgfältige Auswahl und Förderung potentieller Nachfolger aus seiner Familie (der Julischen Familie) die Kontinuität seiner Herrschaft und den Fortbestand der Dynastie zu gewährleisten. Die Arbeit analysiert die Strategien, die er hierzu verfolgte.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Augustus, Prinzipat, Nachfolge, Julisch-claudische Dynastie, imperium proconsulare, tribunicia potestas, auctoritas, Marcellus, Agrippa, Gaius, Lucius Caesar, Tiberius, Machtübergabe, Römische Republik und Res publica restituta.
Was war das Prinzipat?
Das Prinzipat war ein inoffizielles Herrschaftssystem, das unter Augustus entstand. Es vereinte Elemente der Republik mit monarchischen Strukturen und ermöglichte Augustus, die faktische Macht auszuüben, während der Schein der Republik gewahrt blieb.
Welche Bedeutung hat das Jahr 27 v. Chr. im Kontext der Arbeit?
Das Jahr 27 v. Chr. markiert eine Zäsur in der römischen Geschichte. Octavian (später Augustus) gab seine Macht offiziell an den Senat zurück, erhielt aber bedeutende Ehrentitel und begründete das Prinzipat.
Welche Schwierigkeiten brachte die Nachfolge Augusts mit sich?
Die Nachfolge Augusts war schwierig, da das Prinzipat nicht vererbbar war und Augustus einen geeigneten Nachfolger finden musste, der seine Machtposition und die Stabilität des Reiches sichern konnte. Die Arbeit untersucht die damit verbundenen politischen, dynastischen und persönlichen Herausforderungen.
- Quote paper
- Robin Helm (Author), 2021, Die Nachfolge des Augustus. Die Schwierigkeiten der ersten Herrschaftsübergabe im Prinzipat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1154871