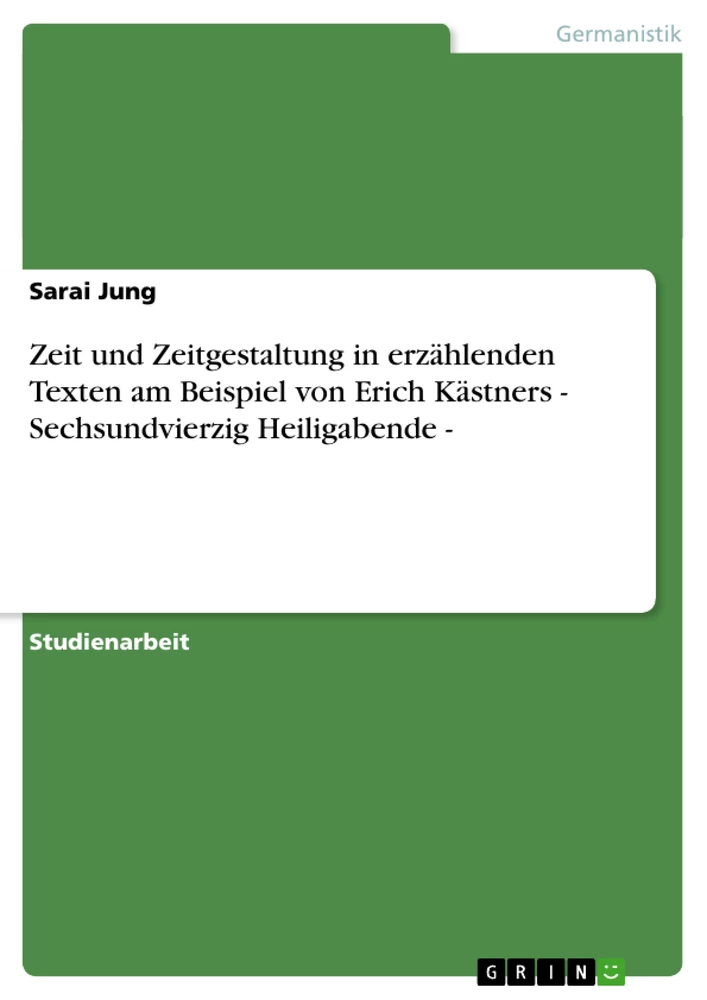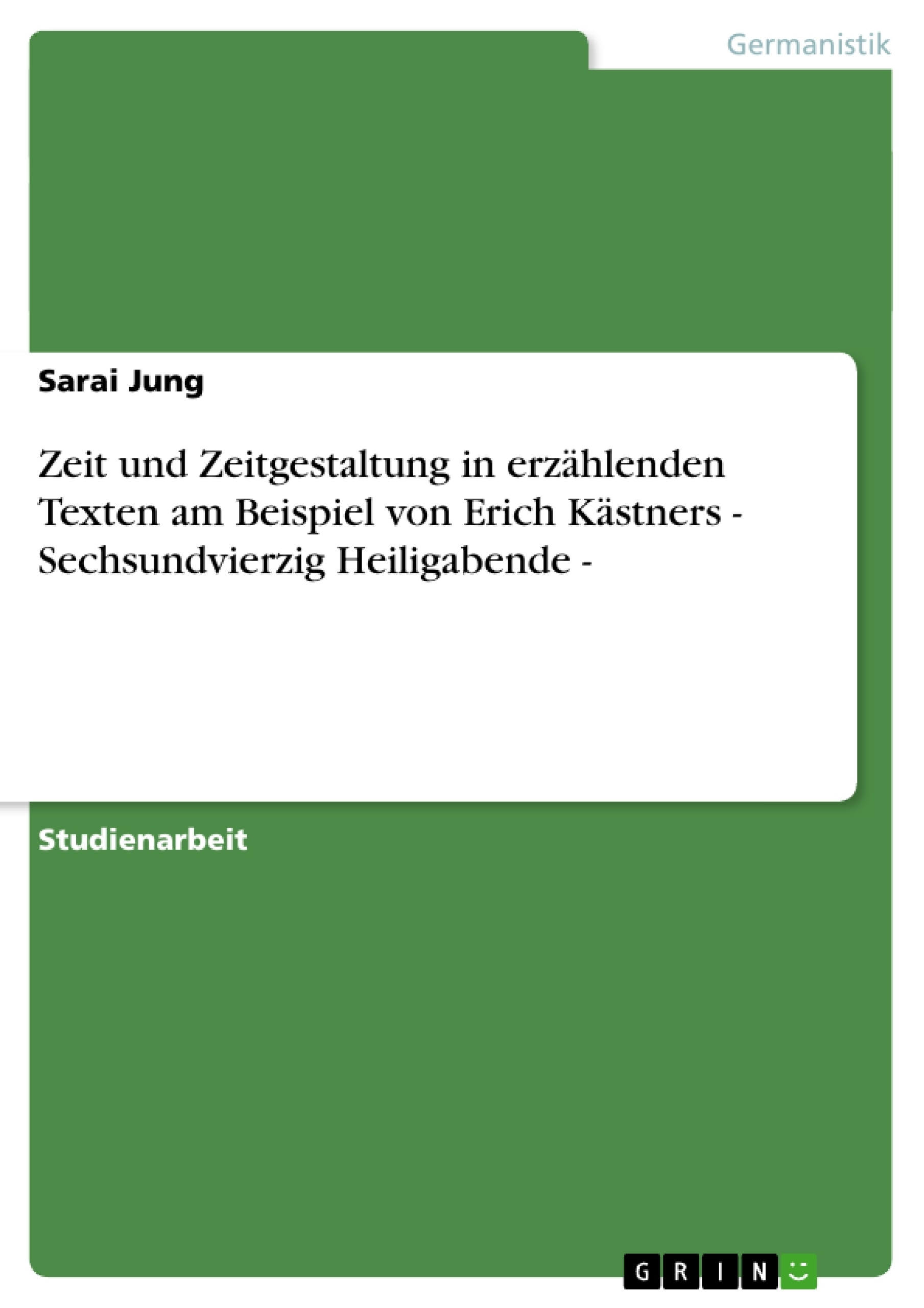Zeit – Was ist das eigentlich? Nur sehr schwer lässt sich eine Antwort auf eine solch einfache Frage finden, obwohl es sich um ein ganz alltägliches Phänomen handelt, das aus unserem Leben nicht weg zu denken ist. Unser ganzer Alltag ist im Wesentlichen durch Zeit strukturiert und bestimmt. Zeit ist unbestritten objektiv messbar. Wenn man den einzelnen aber danach fragt, wie lange denn ein Augenblick dauert, oder eine Stunde, oder auch eine Ewigkeit, dann wird klar, dass die Zeitwahrnehmung alles andere als objektiv ist. Denn Zeit ist zweitens und vor allem subjektives Erleben. Drittens aber ist Zeit Geschichte, denn sie ist „das was geschieht, und damit auch das, was wir über das Geschehene berichten, wie wir es sehen und verstehen“. Wenn wir sprechen, dann ordnen wir alles auf der Zeitachse in unser Koordinatensystem ein. Wir legen je nach unserem Empfinden und unseren Bedürfnissen fest, ob etwas zuvor, danach oder gleichzeitig geschehen ist; ob etwas vergangen, gegenwärtig oder zukünftig ist; wie lange etwas ungefähr oder genau gedauert hat.
In einer Erzählung dürfen wir an der ganz persönlichen Zeiterfahrung eines Erzählers oder der Figuren seiner Geschichte teilhaben. Der Erzähler nimmt den Leser bei der Hand und führt ihn durch seine Geschichte, indem er die Zeitstrukturen bewusst gestaltet. Er greift stets strukturierend und ordnend in das Geschehen ein, reguliert das Erzähltempo und / oder unterbricht die lineare Abfolge der Geschehnisse durch Anachronien. Der Autor setzt bewusst eine Sprecher-Origo ein, von der aus die Ereignisse in die jeweilige Vor-Zeit (Vergangenheit), in die Gegenwart und Gleichzeitigkeit des Sprechaktes und in die Nach- Zeit (Zukunft) eingeordnet werden müssen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erzählung "Sechsundvierzig Heiligabende" von Erich Kästner, die eine sehr komplexe und elaborierte Zeitgestaltung aufweist. Der Autor lässt die zeitlichen Ebenen ganz bewusst verschwimmen, so dass zwischen Gegenwart und Zukunft keine klaren Grenzen gezogen werden können, genauso wenig wie zwischen den unterschiedlichen Perspektiven der Hauptpersonen (Ich-Erzähler, Mutter). Es gelingt ihm, anhand der Zeitstruktur die Aussageintention seiner Erzählung zu unterstreichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Zeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Sprachliche Mittel der Zeitgestaltung
- 2.2. Erzähltempo
- 2.3. Zeitdualität
- 2.4. Chronologie und Anachronie
- 3. Zeitgestaltung in Erich Kästners Erzählung Sechsundvierzig Heiligabende
- 3.1. Struktur der Zeitgestaltung
- 3.1.1. Grobstruktur der zeitlichen Ebenen
- 3.1.2. Konkrete Zeitreferenz der Erzählung
- 3.1.3. Einleitung der Erzählung
- 3.1.4. Geschichtenzeit
- 3.1.5. Zeitdualität
- 3.2. Thematischer Bezug
- 3.2.1. Emotionale Bindung zwischen Mutter und Sohn
- 3.2.2. Verschwimmen von Gegenwart und Zukunft
- 3.2.3. Gegenwart des Erzählers
- 3.2.4. Vergangenheit des Erzählers und seiner Mutter
- 3.3. Zusammenfassende Bermerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gestaltung von Zeit in erzählenden Texten, anhand von Erich Kästners "Sechsundvierzig Heiligabende". Das Hauptziel ist die Analyse der sprachlichen Mittel und narrativen Strategien, die Kästner zur Darstellung und Manipulation der Zeit in seiner Erzählung einsetzt. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Zeitgestaltung auf die Rezeption und das Verständnis der Geschichte.
- Sprachliche Mittel der Zeitgestaltung (Tempus, Adverbien etc.)
- Erzähltempo und seine Wirkung
- Zeitdualität und die subjektive Wahrnehmung von Zeit
- Chronologie und Anachronien in der Erzählung
- Der thematische Bezug der Zeitgestaltung zur emotionalen Bindung zwischen Mutter und Sohn.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Zeit: Dieses einleitende Kapitel definiert das scheinbar einfache, aber komplexe Phänomen der Zeit. Es stellt die Paradoxie heraus: Zeit ist objektiv messbar (Kalender, Uhren), aber gleichzeitig subjektiv erlebbar, abhängig von individuellen Erfahrungen. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende Analyse, indem sie die Vielschichtigkeit des Themas Zeit und deren Relevanz für die Literatur hervorhebt. Die subjektive Wahrnehmung der Zeit wird als zentraler Aspekt eingeführt, der im weiteren Verlauf der Arbeit im Detail untersucht wird.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel bildet die theoretische Basis für die Analyse von Kästners Erzählung. Es befasst sich mit verschiedenen sprachlichen Mitteln der Zeitgestaltung in narrativen Texten, wie z.B. Tempusformen, lexikalischen Mitteln und der Gestaltung des Erzähltempos. Konzepte wie Zeitdualität, Chronologie und Anachronie werden erläutert und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Zeit in der Erzählung herausgestellt. Das Kapitel liefert das notwendige Handwerkszeug für die anschließende textanalytische Auseinandersetzung.
3. Zeitgestaltung in Erich Kästners Erzählung Sechsundvierzig Heiligabende: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und analysiert die spezifische Zeitgestaltung in Kästners Erzählung. Es untersucht die Struktur der Zeitgestaltung, sowohl die grobe Struktur der zeitlichen Ebenen als auch die konkrete Zeitreferenz. Die Analyse konzentriert sich auf den thematischen Bezug der Zeitgestaltung, insbesondere auf die emotionale Bindung zwischen Mutter und Sohn und das Verschwimmen von Gegenwart und Zukunft. Durch die Verbindung von theoretischen Grundlagen und Textanalyse wird ein umfassendes Verständnis der Zeitgestaltung in der Erzählung erreicht.
Schlüsselwörter
Zeitgestaltung, Erzähltext, Erich Kästner, Sechsundvierzig Heiligabende, Tempus, Erzähltempo, Zeitdualität, Chronologie, Anachronie, subjektive Zeitwahrnehmung, emotionale Bindung, Mutter-Sohn-Beziehung.
Erich Kästners "Sechsundvierzig Heiligabende": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Zeitgestaltung in Erich Kästners Erzählung "Sechsundvierzig Heiligabende". Sie untersucht, wie Kästner sprachliche Mittel und narrative Strategien einsetzt, um die Zeit darzustellen und zu manipulieren, und welchen Einfluss dies auf die Rezeption und das Verständnis der Geschichte hat.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: sprachliche Mittel der Zeitgestaltung (Tempus, Adverbien etc.), Erzähltempo und seine Wirkung, Zeitdualität und die subjektive Wahrnehmung von Zeit, Chronologie und Anachronien in der Erzählung, sowie den thematischen Bezug der Zeitgestaltung zur emotionalen Bindung zwischen Mutter und Sohn.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel 1 ("Einleitung: Die Zeit") definiert den Begriff der Zeit und deren Relevanz für die Literatur. Kapitel 2 ("Theoretische Grundlagen") legt die theoretischen Grundlagen der Zeitgestaltung in narrativen Texten dar. Kapitel 3 ("Zeitgestaltung in Erich Kästners Erzählung Sechsundvierzig Heiligabende") analysiert die spezifische Zeitgestaltung in Kästners Erzählung, insbesondere im Hinblick auf die Struktur, die Zeitreferenz und den thematischen Bezug zur emotionalen Bindung zwischen Mutter und Sohn.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet textanalytische Methoden, um die sprachlichen Mittel und narrativen Strategien der Zeitgestaltung in Kästners Erzählung zu untersuchen. Sie verbindet theoretische Grundlagen mit der konkreten Analyse des Textes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Zeitgestaltung, Erzähltext, Erich Kästner, Sechsundvierzig Heiligabende, Tempus, Erzähltempo, Zeitdualität, Chronologie, Anachronie, subjektive Zeitwahrnehmung, emotionale Bindung, Mutter-Sohn-Beziehung.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der sprachlichen Mittel und narrativen Strategien, die Kästner zur Darstellung und Manipulation der Zeit in seiner Erzählung einsetzt und die Untersuchung des Einflusses der Zeitgestaltung auf die Rezeption und das Verständnis der Geschichte.
Wie ist die Struktur der Zeitgestaltung in der Erzählung aufgebaut?
Die Analyse untersucht die Grobstruktur der zeitlichen Ebenen, die konkrete Zeitreferenz, die Einleitung der Erzählung, die Geschichtenzeit und die Zeitdualität in Kästners Erzählung.
Welchen thematischen Bezug hat die Zeitgestaltung?
Die Zeitgestaltung steht im thematischen Bezug zur emotionalen Bindung zwischen Mutter und Sohn, dem Verschwimmen von Gegenwart und Zukunft, der Gegenwart des Erzählers und der Vergangenheit des Erzählers und seiner Mutter.
Wie wird die subjektive Zeitwahrnehmung in der Analyse berücksichtigt?
Die subjektive Zeitwahrnehmung wird als zentraler Aspekt betrachtet und im Detail untersucht, insbesondere im Kontext der emotionalen Bindung und des Verschwimmens von Gegenwart und Zukunft.
- Quote paper
- Sarai Jung (Author), 2003, Zeit und Zeitgestaltung in erzählenden Texten am Beispiel von Erich Kästners - Sechsundvierzig Heiligabende -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11544