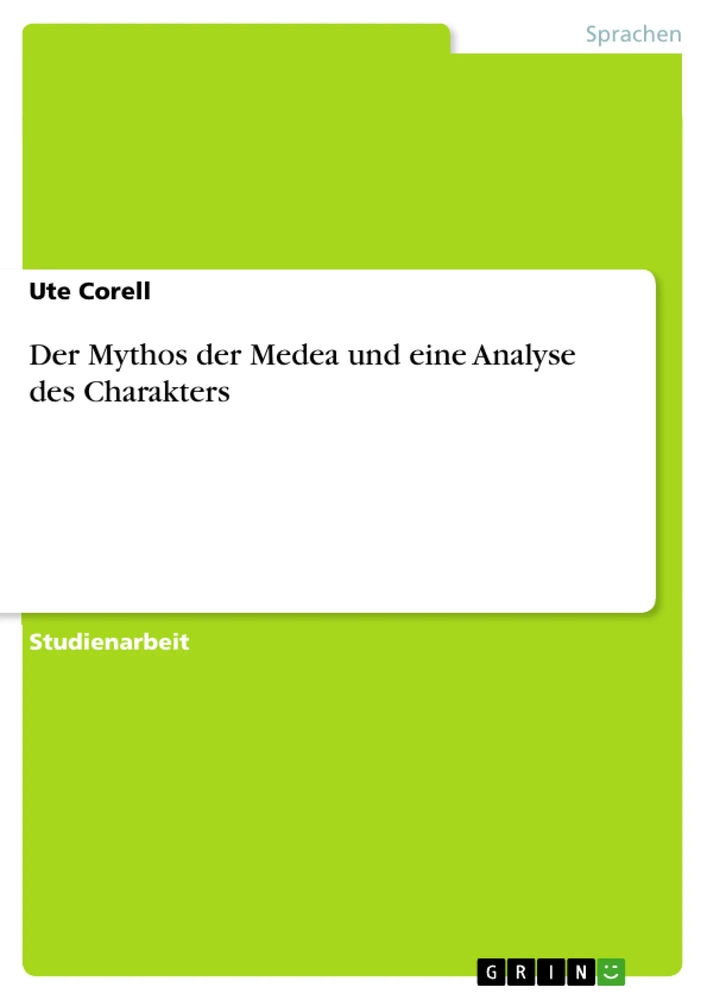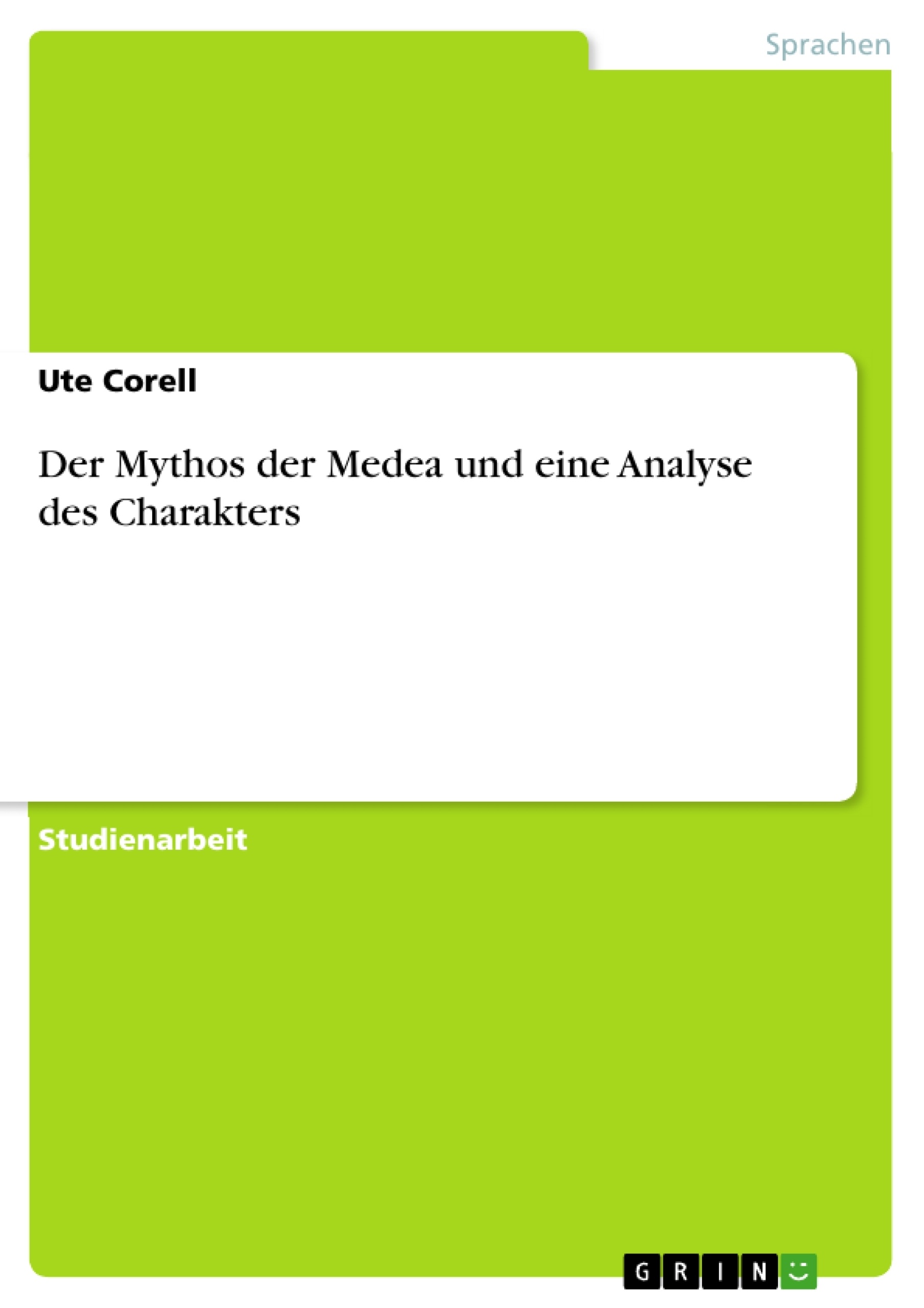In dieser Hausarbeit werde ich zunächst den Mythosbegriff unter Einbezug der Darlegung durch Aristoteles näher untersuchen, um ihn daraufhin an dem Medea-Drama in seiner Ursprungsversion von Euripides sowie in seiner Rezeption von Gotter anzuwenden.
Ein kontinuierliches "Interesse an den Stoffen der Antike" ist dafür verantwortlich, dass Autoren aller Zeitepochen "auf mythische Namen zurück[greifen], auch wenn sie eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen wollen."
Von großem Interesse gilt die Erzählung um Medea, die viele Anknüpfungspunkte für unterschiedlichste Rezeptionen bietet. Ihrer Urfassung von Euripides hat sich im 18. Jahrhundert Gotter angenommen, um den Charakter der Medea auf individuelle Art zu beleuchten. Besonders Aristoteles betrachtet Rezeptionen mythischer Stoffe kritisch und definiert anhand der resultierenden Tragödien seinen eigenen Mythosbegriff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythos des Medea-Stoffes
- Mythosbegriff nach Aristoteles
- Charakteranalyse: Medea
- Tragische Charaktere nach Aristoteles
- Darstellung der Medea nach Euripides
- Darstellung der Medea nach Gotter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Mythos der Medea und seine Rezeption durch verschiedene Autoren, insbesondere Euripides und Gotter. Dabei wird der Fokus auf die Entwicklung des Mythosbegriffs, die Charakteranalyse der Medea und die Unterschiede in der Darstellung der Figur in verschiedenen Adaptionen gelegt.
- Die Entwicklung des Mythosbegriffs im Laufe der Zeit, insbesondere unter Einbezug der Gedankenführung von Aristoteles
- Die Analyse der Figur der Medea in der ursprünglichen Version des Mythos nach Euripides
- Die Rezeption des Medea-Stoffes durch Gotter und die Unterschiede in der Darstellung der Figur
- Die Rolle der Tragödie im Kontext antiker Mythen
- Die Bedeutung von Mythen für die Literatur und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Rezeption antiker Mythen und den Mythosbegriff ein, wobei die Bedeutung des Wissenschaftsglaubens im Vergleich zum Mythos und seine Entwicklung im Laufe der Zeit betrachtet wird. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Mythos des Medea-Stoffes und seiner verschiedenen Überlieferungen, die von Euripides in ein „übersichtliche[ ]“ Handlungsgeflecht zusammengefasst wurden.
Das dritte Kapitel behandelt den Mythosbegriff nach Aristoteles, dessen Kritik an der Dichtung und dessen eigene Definition des Begriffs im Rahmen seines Hauptwerks „Poetik“ dargestellt werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Charakteranalyse der Medea in ihrer ursprünglichen Version von Euripides und deren Rezeption durch Gotter, wobei die Unterschiede in der Darstellung der Figur im Vordergrund stehen. Das Kapitel „Fazit“ beinhaltet eine Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse und eine kritische Betrachtung der untersuchten Aspekte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe wie Mythos, Medea, Euripides, Gotter, Tragödie, Charakteranalyse, Rezeption, Mythosbegriff, Aristoteles und die Bedeutung von Mythen in der Literatur und Kultur.
- Quote paper
- Ute Corell (Author), 2014, Der Mythos der Medea und eine Analyse des Charakters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153879