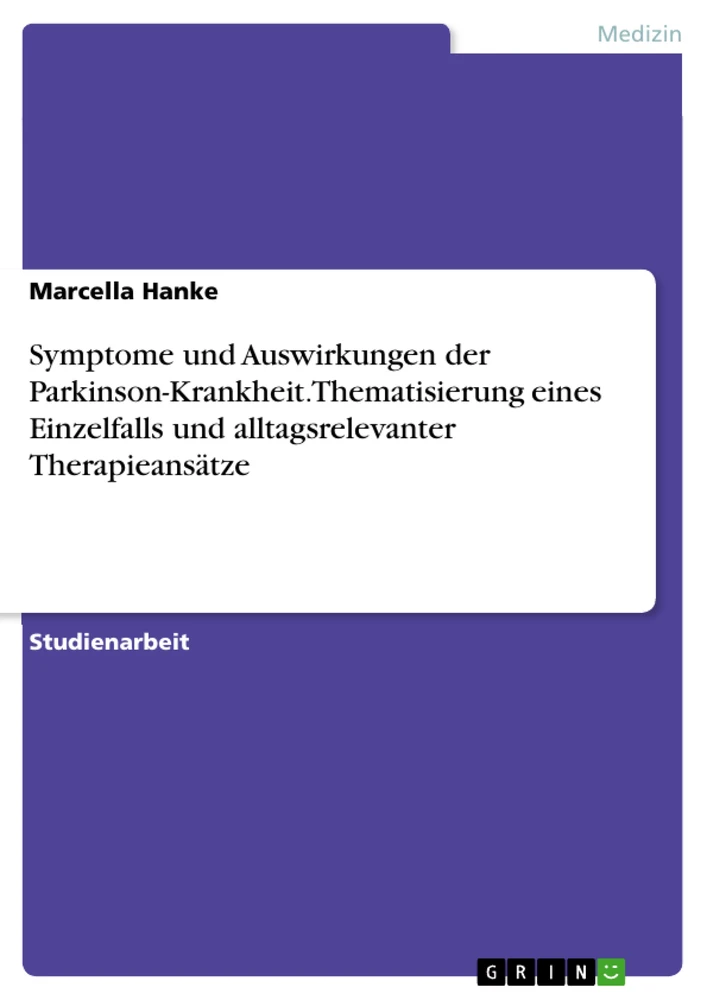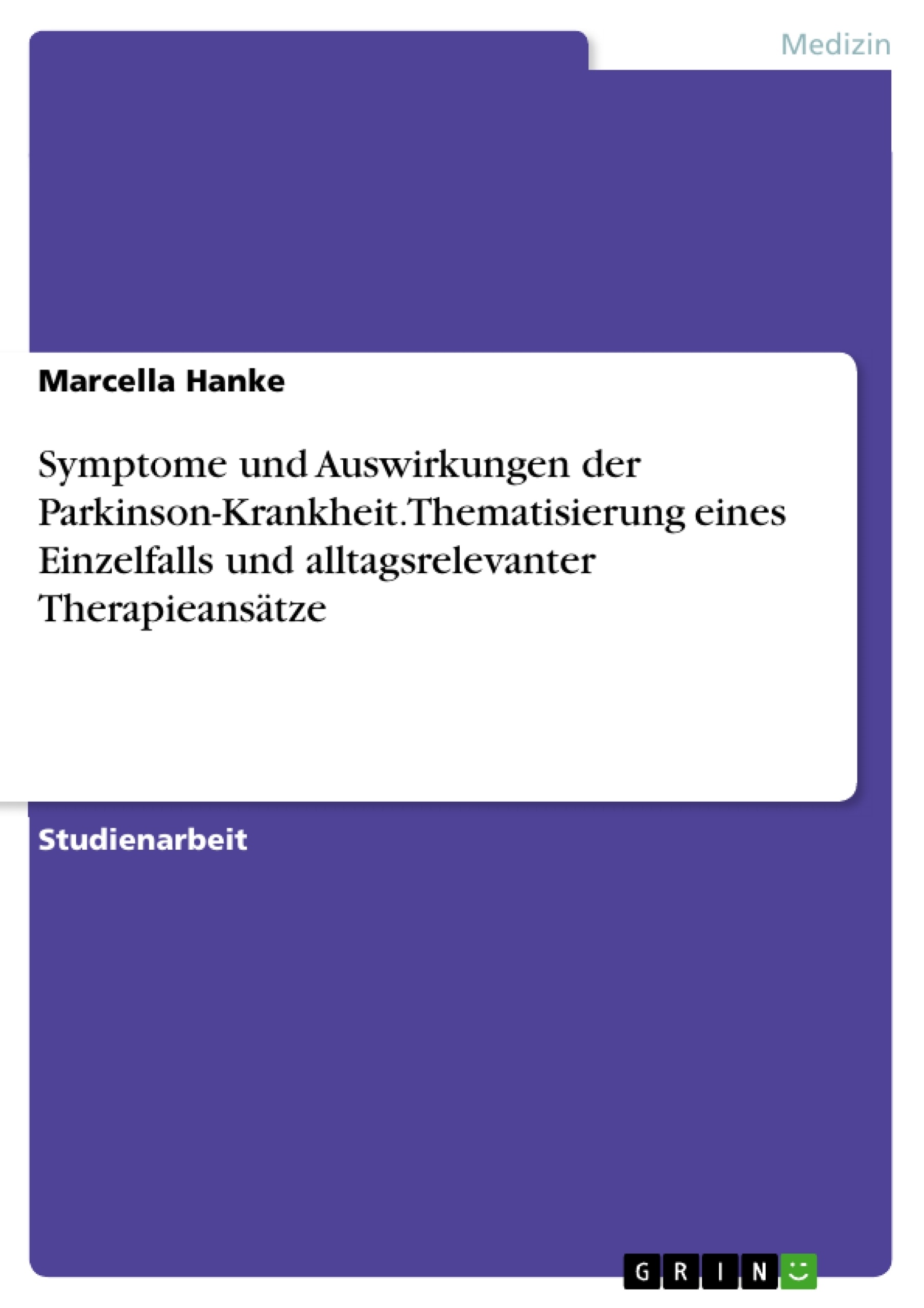Diese Hausarbeit möchte den Leser für das heterogene Erscheinungsbild des Parkinson-Syndroms sensibilisieren und einen Einblick in die Symptome und Auswirkungen dieser neurologisch-degenerativen Erkrankung geben. Im Verlauf der Hausarbeit wird ein gegebener Einzelfall näher dargestellt und analysiert. Dabei wird, laut Aufgabenstellung, die Problematik des "Nicht-Telefonierens" sowie die Möglichkeiten alltagsrelevanter Therapieansätze thematisiert.
Das heterogene klinische Bild des Morbus Parkinson wirft 200 Jahre nach der Entdeckung als "Schüttellähmung" ("shaking palsy") durch James Parkinson immer noch viele physiologische, neuropsychologische und wissenschaftliche Fragen auf. Auch die Pathomechanismen sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Innerhalb der Parkinsonerkrankung treten unterschiedliche Symptomausprägungen auf, so dass die Erkrankung auch idiopathisches Parkinson-Syndrom genannt wird. Salvador Dalí, Muhammad Ali, Papst Johannes Paul II., Michael J. Fox und Frank Elstner haben alle die Diagnose Morbus Parkinson erhalten.
Morbus Parkinson ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung hinter Alzheimer. In Deutschland sind aktuell etwa 400.000 Personen an Parkinson erkrankt bei 100 bis 200 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Weltweit hat sich die Zahl der Parkinson-Patienten von 2,5 Millionen im Jahr 1990 auf 6,1 Millionen im Jahr 2016 erhöht. Der demografische Wandel hat einen großen Einfluss auf die erhebliche Zunahme von Morbus Parkinson, aber auch von anderen neurologischen Erkrankungen. Nach Einschätzungen von Experten soll sich die Zahl der Parkinsonerkrankten im Jahr 2040 auf ca. 13 bis 14 Millionen Menschen erhöhen. Besonders häufig tritt die Parkinsonkrankheit in Westeuropa, Nordamerika und anderen Industrienationen auf. Die Erkrankungsrate liegt bei Männer etwas höher als bei Frauen. Die Mehrzahl der Betroffenen erkranken jenseits des 40. Lebensjahres. Laut Angaben der Techniker Krankenkasse sind in Deutschland aktuell etwa 1% - 1,5% der über 60-jährigen betroffen. Bei den über 80-jährigen sind es bereits 4%. Nur ca. 10% der Betroffenen erkranken früher.
Die Ätiologie der Parkinsonerkrankung ist bis heute ungeklärt. In den letzten Jahrzehnten wurden immer wieder verschiedene medizinische Ansätze diskutiert. Neben der Ursachenforschung ist auch die Diagnosestellung der Erkrankung, insbesondere bei jüngeren Personen, nicht immer eindeutig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau
- 2. Theoretische Grundlagen – Parkinson-Syndrom
- 2.1 Ausprägungsformen und Klassifikationen
- 2.2 Pathophysiologie
- 2.3 Symptome und Diagnosestellung
- 3. Fallbeschreibung
- 4. Fallanalyse
- 4.1 Die Problematik des „Nicht-Telefonierens“
- 4.1.1 Haltetremor
- 4.1.2 Rigor
- 4.1.3 Sprechstörungen
- 4.2 Therapieansätze
- 4.2.1 Medikamentöse Maßnahmen
- 4.2.2 Physiotherapeutische Maßnahmen
- 4.2.3 Psychologische und Verhaltenstherapeutische Maßnahmen
- 4.2.4 Alltagsrelevante Therapiemaßnahmen bezogen auf das Fallbeispiel
- 4.1 Die Problematik des „Nicht-Telefonierens“
- 5. Diskussion
- 5.1 Fazit
- 5.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, das heterogene Erscheinungsbild des Parkinson-Syndroms zu beleuchten und die Symptome sowie Auswirkungen dieser neurodegenerativen Erkrankung zu verdeutlichen. Anhand einer Fallstudie wird die Problematik des „Nicht-Telefonierens“ bei einem früh an Parkinson erkrankten Patienten analysiert und alltagsrelevante Therapieansätze diskutiert.
- Epidemiologie und Ausprägungsformen des Morbus Parkinson
- Pathophysiologie und diagnostische Herausforderungen
- Symptomatologie und deren Auswirkungen auf den Alltag
- Analyse eines Fallbeispiels mit Fokus auf die Problematik des Telefonierens
- Multidisziplinäre Therapieansätze und deren Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die epidemiologische Situation des Morbus Parkinson dar, hebt die Komplexität des Krankheitsbildes hervor und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Hausarbeit. Der Fokus liegt auf der Problematik der frühen Diagnose und der noch ungeklärten Ätiologie der Erkrankung, insbesondere bei jungen Patienten. Die Hausarbeit wird als Fallstudie eines 39-jährigen Patienten mit früh beginnendem Parkinson-Syndrom vorgestellt.
2. Theoretische Grundlagen – Parkinson-Syndrom: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Parkinson-Syndrom. Es werden verschiedene Ausprägungsformen und Klassifikationen, einschließlich idiopathischer, genetischer und sekundärer Parkinson-Syndrome, detailliert beschrieben und anhand von Tabellen veranschaulicht. Die Pathophysiologie wird erklärt, wobei der Dopaminmangel im Mittelhirn und die Rolle der Basalganglien im Mittelpunkt stehen. Schließlich werden die vielseitigen Symptome und die diagnostischen Herausforderungen, die von unspezifischen Frühsymptomen bis hin zu komplexen bildgebenden Verfahren reichen, erörtert.
3. Fallbeschreibung: Dieses Kapitel präsentiert den Fall eines 39-jährigen Mannes (Herr N.) mit früh beginnendem Morbus Parkinson, der das Telefonieren vermeidet aufgrund von Sturzängsten und Kommunikationsschwierigkeiten. Die medikamentöse Therapie und die wöchentliche Physiotherapie werden als Bestandteile seiner Behandlung genannt.
4. Fallanalyse: Die Fallanalyse konzentriert sich auf die Problematik des „Nicht-Telefonierens“ bei Herrn N., wodurch die Auswirkungen von Haltetremor, Rigor und Sprechstörungen auf seine Fähigkeit zur Telefonnutzung verdeutlicht werden. Es werden verschiedene Therapieansätze diskutiert, darunter medikamentöse, physiotherapeutische, psychologische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Die Bedeutung einer ganzheitlichen und multidisziplinären Therapie wird betont, wobei die Notwendigkeit einer differenzialdiagnostischen Abklärung weiterer Erkrankungen, wie etwa einer Depression, herausgestellt wird.
Schlüsselwörter
Morbus Parkinson, Parkinson-Syndrom, Idiopathisches Parkinson-Syndrom, Pathophysiologie, Dopaminmangel, Basalganglien, Symptome, Diagnostik, Therapie, Levodopa, Tiefe Hirnstimulation (THS), Bewegungsstörungen, Bradykinese, Rigor, Tremor, Sprechstörungen (Dysarthrie), Depression, Fallstudie, Lebensqualität, multidisziplinäre Therapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Parkinson-Syndrom - Fallstudie "Nicht-Telefonieren"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Parkinson-Syndrom anhand einer Fallstudie eines 39-jährigen Patienten, der aufgrund von Symptomen wie Haltetremor, Rigor und Sprechstörungen das Telefonieren vermeidet. Die Arbeit beleuchtet die heterogene Erscheinungsform der Erkrankung, deren Auswirkungen auf den Alltag und diskutiert verschiedene Therapieansätze.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die epidemiologischen Aspekte des Morbus Parkinson, die Pathophysiologie, verschiedene Ausprägungsformen und Klassifikationen, die Symptomatologie, diagnostische Herausforderungen und multidisziplinäre Therapieansätze. Ein besonderer Fokus liegt auf der Fallanalyse des Patienten und der Problematik seines „Nicht-Telefonierens“.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist gegliedert in eine Einleitung, einen theoretischen Teil zum Parkinson-Syndrom, eine Fallbeschreibung, eine Fallanalyse mit Fokus auf das „Nicht-Telefonieren“, sowie eine Diskussion mit Fazit und Ausblick. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, das heterogene Erscheinungsbild des Parkinson-Syndroms zu verdeutlichen und die Auswirkungen der Erkrankung auf den Alltag zu zeigen. Anhand der Fallstudie soll die Problematik des „Nicht-Telefonierens“ analysiert und alltagsrelevante Therapieansätze diskutiert werden.
Welche Symptome des Parkinson-Syndroms werden im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel betrachtet?
Im Fokus stehen der Haltetremor, der Rigor und Sprechstörungen (Dysarthrie) des Patienten, die seine Fähigkeit zum Telefonieren beeinträchtigen. Die Auswirkungen dieser Symptome auf die Lebensqualität werden analysiert.
Welche Therapieansätze werden in der Hausarbeit diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert medikamentöse Maßnahmen, physiotherapeutische Maßnahmen, psychologische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen sowie alltagsrelevante Therapiemaßnahmen, die speziell auf den Fall des Patienten zugeschnitten sind. Die Bedeutung einer ganzheitlichen und multidisziplinären Therapie wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Morbus Parkinson, Parkinson-Syndrom, Idiopathisches Parkinson-Syndrom, Pathophysiologie, Dopaminmangel, Basalganglien, Symptome, Diagnostik, Therapie, Levodopa, Tiefe Hirnstimulation (THS), Bewegungsstörungen, Bradykinese, Rigor, Tremor, Sprechstörungen (Dysarthrie), Depression, Fallstudie, Lebensqualität, multidisziplinäre Therapie.
Wer ist der Proband in der Fallstudie?
Die Fallstudie beschreibt einen 39-jährigen Mann (Herr N.) mit früh beginnendem Morbus Parkinson.
Was ist die zentrale Problematik der Fallstudie?
Die zentrale Problematik ist die Vermeidung des Telefonierens durch Herrn N. aufgrund seiner Parkinson-Symptome (Haltetremor, Rigor, Sprechstörungen) und der daraus resultierenden Sturzängste und Kommunikationsschwierigkeiten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Das Fazit und der Ausblick der Hausarbeit werden im Kapitel 5 detailliert dargelegt und fassen die Ergebnisse der Fallanalyse und die daraus abgeleiteten Implikationen für die Therapie und weitere Forschung zusammen.
- Quote paper
- Marcella Hanke (Author), 2019, Symptome und Auswirkungen der Parkinson-Krankheit. Thematisierung eines Einzelfalls und alltagsrelevanter Therapieansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153815