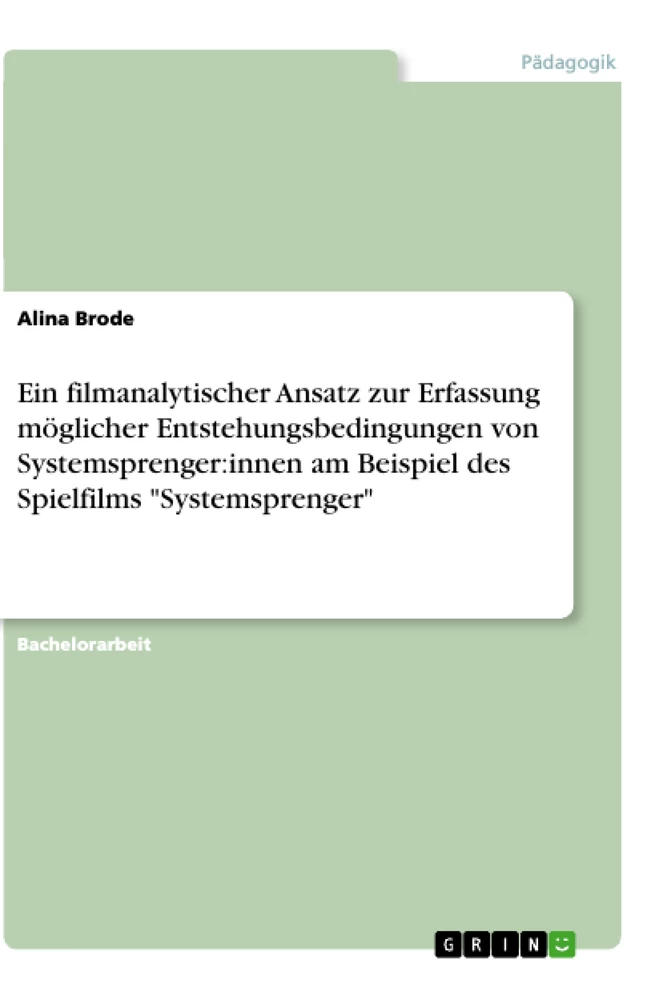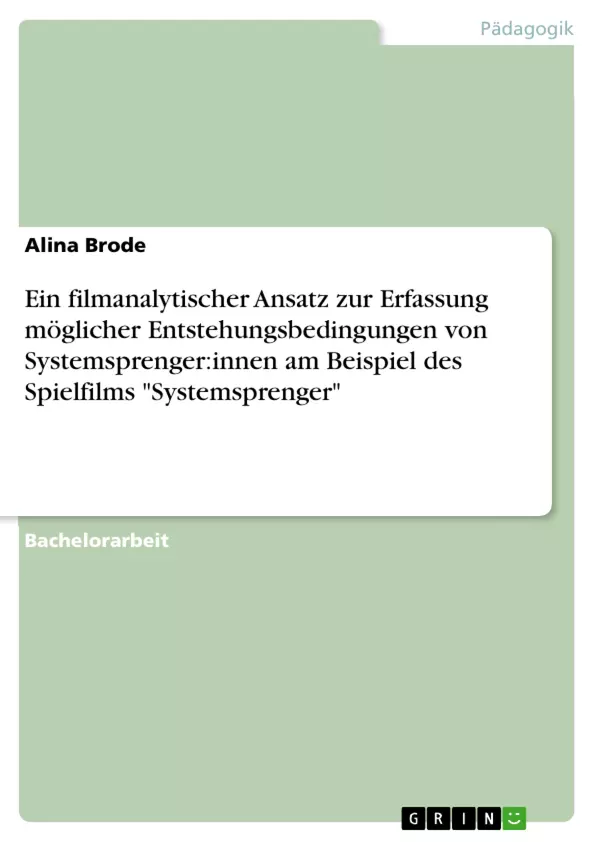Diese Arbeit behandelt das Thema nicht greifender Hilfesysteme. Die Bezeichnung "Systemsprenger:in" beschreibt vor allem Kinder und Jugendliche mit komplexen Hilfeverläufen und das dadurch resultierende antisoziale Verhalten, welches für das System Kinder- und Jugendhilfe eine große Herausforderung darstellt. Kennzeichnend für die "sprengende" Attribution sind rasche Wechsel zwischen Erziehungsmaßnahmen oder die Beendigung dieser.
Im Zuge dieser Arbeit werden verschiedene psychosoziale und psychologische Risikofaktoren vorgestellt und untersucht, welche die Entstehung des Systemsprenger:innenphänomens begünstigen könnten. Dies geschieht mittels einer qualitativen/interpretativen Analyse des Spielfilms "Systemsprenger" aus dem Jahr 2019 von Nora Fingscheidt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Kontext
- 2.1. Der systemische Ansatz
- 2.2. Biografiearbeit
- 2.3. Lebensweltorientierung
- 2.4. Lebensbewältigung
- 3. Das System: Hilfen zur Erziehung
- 3.1. Das Herausfallen aus dem System
- 3.2. Der Versuch einer Definition: Systemsprenger:in
- 4. Hilfesysteme für Familien
- 4.1. Jugendamt
- 4.2. Ambulante und (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung
- 4.2.1. Heimerziehung
- 4.2.2. Geschlossene Unterbringung
- 4.2.3. Vollzeitpflege
- 4.2.4. Eingliederungshilfe
- 4.2.5. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 4.3. Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
- 4.4. (Scheiternde) Kooperationen
- 5. Mögliche Entstehungsfaktoren von Systemsprenger:innen
- 5.1. Vulnerabilitäts-Stress-Modell
- 5.2. Psychosoziale Risikofaktoren
- 5.2.1. Ständige Wechsel und Abbrüche von Hilfsmaßnahmen
- 5.2.2. Kinder psychisch kranker Eltern
- 5.2.3. Kindeswohlgefährdung
- 5.2.4. Alleinerziehende Eltern
- 5.2.5. Kinderarmut
- 5.3. Psychische Störungen
- 5.3.1. (Frühkindliches) Trauma
- 5.3.2. Bindungsstörung (mit Enthemmung)
- 5.3.3. ADHS
- 5.3.4. Störung des Sozialverhaltens
- 5.4. Statistische Zusammenhänge
- 6. Forschungsdesign
- 6.1. Erhebungsinstrument: Soziologische Film- und Fernsehanalyse
- 6.2. Auswertungsinstrument: Grounded Theory
- 7. Inhaltliche Analyse des Spielfilms „Systemsprenger“
- 7.1. Inhaltsangabe des Spielfilms „Systemsprenger“
- 7.2. Datenauswertung
- 7.2.1. Schnelle Wechsel und Abbrüche zwischen Einrichtungen oder Maßnahmen
- 7.2.2. Dissoziales Verhalten
- 7.2.3. Bindungsverhalten
- 7.2.4. Wiedererleben des Traumas
- 7.2.5. Familiäre Umstände
- 7.3. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Entstehungsbedingungen von sog. Systemsprenger:innen anhand einer filmanalytischen Untersuchung des Spielfilms "Systemsprenger". Das Ziel ist es, die multifaktoriellen Bedingungen zu identifizieren, die zur Entstehung dieses Phänomens beitragen.
- Analyse des Hilfesystems und dessen Grenzen
- Identifizierung psychosozialer Risikofaktoren
- Untersuchung relevanter psychischer Störungsbilder
- Erörterung des Zusammenspiels verschiedener Faktoren
- Filmanalytischer Ansatz zur Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Entstehungsbedingungen von Systemsprenger:innen am Beispiel des Films "Systemsprenger". Der Begriff "Systemsprenger:in" beschreibt Kinder und Jugendliche mit komplexen Hilfeplänen und antisozialem Verhalten, das das Hilfesystem überfordert. Die Arbeit analysiert verschiedene psychosoziale und psychologische Risikofaktoren mithilfe einer qualitativen Analyse des Films.
2. Theoretischer Kontext: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Systemsprenger:innen. Er beleuchtet den systemischen Ansatz, die Biografiearbeit, die Lebensweltorientierung nach Thiersch und das Konzept der Lebensbewältigung nach Böhnisch. Diese Ansätze betonen die ganzheitliche Betrachtung der Lebenswelt und der individuellen Bewältigungsstrategien der Betroffenen.
3. Das System: Hilfen zur Erziehung: Hier wird das deutsche Hilfesystem zur Erziehung vorgestellt, einschließlich seiner Ziele und Maßnahmen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen des Systems im Umgang mit Systemsprenger:innen und dem Versuch, den Begriff "Systemsprenger:in" zu definieren, wobei die Problematik der Stigmatisierung und der Systemkritik hervorgehoben wird.
4. Hilfesysteme für Familien: Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Hilfesysteme für Familien, darunter das Jugendamt, ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung, geschlossene Unterbringung, Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung), sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Die (oftmals scheiternden) Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren werden kritisch beleuchtet.
5. Mögliche Entstehungsfaktoren von Systemsprenger:innen: Dieser Abschnitt präsentiert das Vulnerabilitäts-Stress-Modell und untersucht verschiedene psychosoziale Risikofaktoren (ständige Wechsel von Maßnahmen, Kinder psychisch kranker Eltern, Kindeswohlgefährdung, alleinerziehende Eltern, Kinderarmut) sowie psychische Störungen (frühkindliches Trauma, Bindungsstörung, ADHS, Störung des Sozialverhaltens) die zur Entstehung des Phänomens beitragen können. Statistische Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Faktoren werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Systemsprenger:in, Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe, psychosoziale Risikofaktoren, psychische Störungen, Trauma, Bindungsstörung, ADHS, Störung des Sozialverhaltens, Film-analyse, qualitative Forschung, multifaktorielle Bedingungsanalyse, Lebensbewältigung, Resilienz, Vulnerabilität.
Häufig gestellte Fragen zu der Bachelorarbeit: "Systemsprenger:innen - Eine filmanalytische Untersuchung"
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Entstehungsbedingungen von sogenannten "Systemsprenger:innen" anhand einer filmanalytischen Untersuchung des Spielfilms "Systemsprenger". Der Fokus liegt auf der Identifizierung multifaktorieller Bedingungen, die zur Entstehung dieses Phänomens beitragen.
Was sind "Systemsprenger:innen"?
Der Begriff "Systemsprenger:in" beschreibt Kinder und Jugendliche mit komplexen Hilfeplänen und antisozialem Verhalten, das das Hilfesystem überfordert. Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Stigmatisierung und der Systemkritik im Zusammenhang mit diesem Begriff.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode: die soziologische Film- und Fernsehanalyse des Spielfilms "Systemsprenger". Die Auswertung erfolgt mittels Grounded Theory.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den systemischen Ansatz, die Biografiearbeit, die Lebensweltorientierung nach Thiersch und das Konzept der Lebensbewältigung nach Böhnisch. Diese Ansätze ermöglichen eine ganzheitliche Betrachtung der Lebenswelt und der individuellen Bewältigungsstrategien der Betroffenen.
Welche Aspekte des Hilfesystems werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das deutsche Hilfesystem zur Erziehung, einschließlich Jugendamt, ambulanter und stationärer Hilfen (Heimerziehung, geschlossene Unterbringung, Vollzeitpflege etc.), Kinder- und Jugendpsychiatrie und die oftmals scheiternden Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren. Die Grenzen des Systems im Umgang mit Systemsprenger:innen werden kritisch beleuchtet.
Welche Risikofaktoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht psychosoziale Risikofaktoren wie ständige Wechsel von Maßnahmen, Kinder psychisch kranker Eltern, Kindeswohlgefährdung, alleinerziehende Eltern und Kinderarmut. Zusätzlich werden psychische Störungen wie frühkindliches Trauma, Bindungsstörung, ADHS und Störung des Sozialverhaltens als mögliche Entstehungsfaktoren betrachtet. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell dient als theoretischer Rahmen.
Wie wird der Film "Systemsprenger" in die Analyse eingebunden?
Der Film "Systemsprenger" dient als Fallstudie. Die Analyse konzentriert sich auf Aspekte wie schnelle Wechsel und Abbrüche zwischen Einrichtungen, dissoziales Verhalten, Bindungsverhalten, das Wiedererleben von Trauma und familiäre Umstände, um die im theoretischen Teil beschriebenen Faktoren zu illustrieren und zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Systemsprenger:in, Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe, psychosoziale Risikofaktoren, psychische Störungen, Trauma, Bindungsstörung, ADHS, Störung des Sozialverhaltens, Filmanalyse, qualitative Forschung, multifaktorielle Bedingungsanalyse, Lebensbewältigung, Resilienz, Vulnerabilität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretischer Kontext, Das System: Hilfen zur Erziehung, Hilfesysteme für Familien, Mögliche Entstehungsfaktoren von Systemsprenger:innen, Forschungsdesign und Inhaltliche Analyse des Spielfilms "Systemsprenger". Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Identifizierung der multifaktoriellen Bedingungen, die zur Entstehung des Phänomens "Systemsprenger:in" beitragen. Die Arbeit analysiert das Hilfesystem, identifiziert psychosoziale Risikofaktoren und relevante psychische Störungsbilder und erörtert deren Zusammenspiel.
- Quote paper
- Alina Brode (Author), 2021, Ein filmanalytischer Ansatz zur Erfassung möglicher Entstehungsbedingungen von Systemsprenger:innen am Beispiel des Spielfilms "Systemsprenger", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1153697