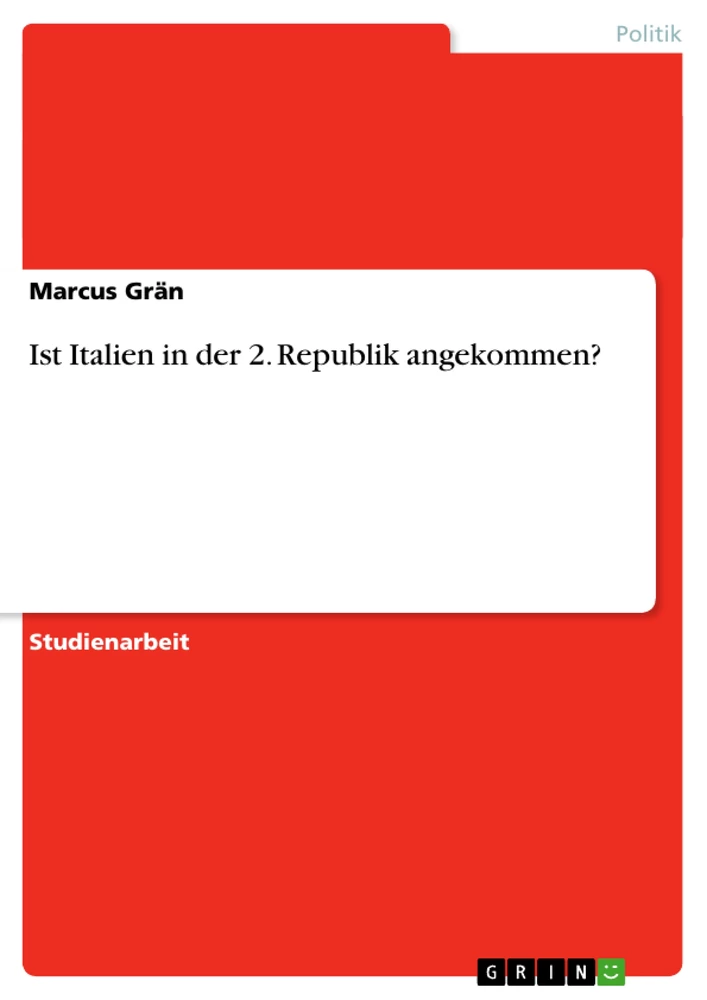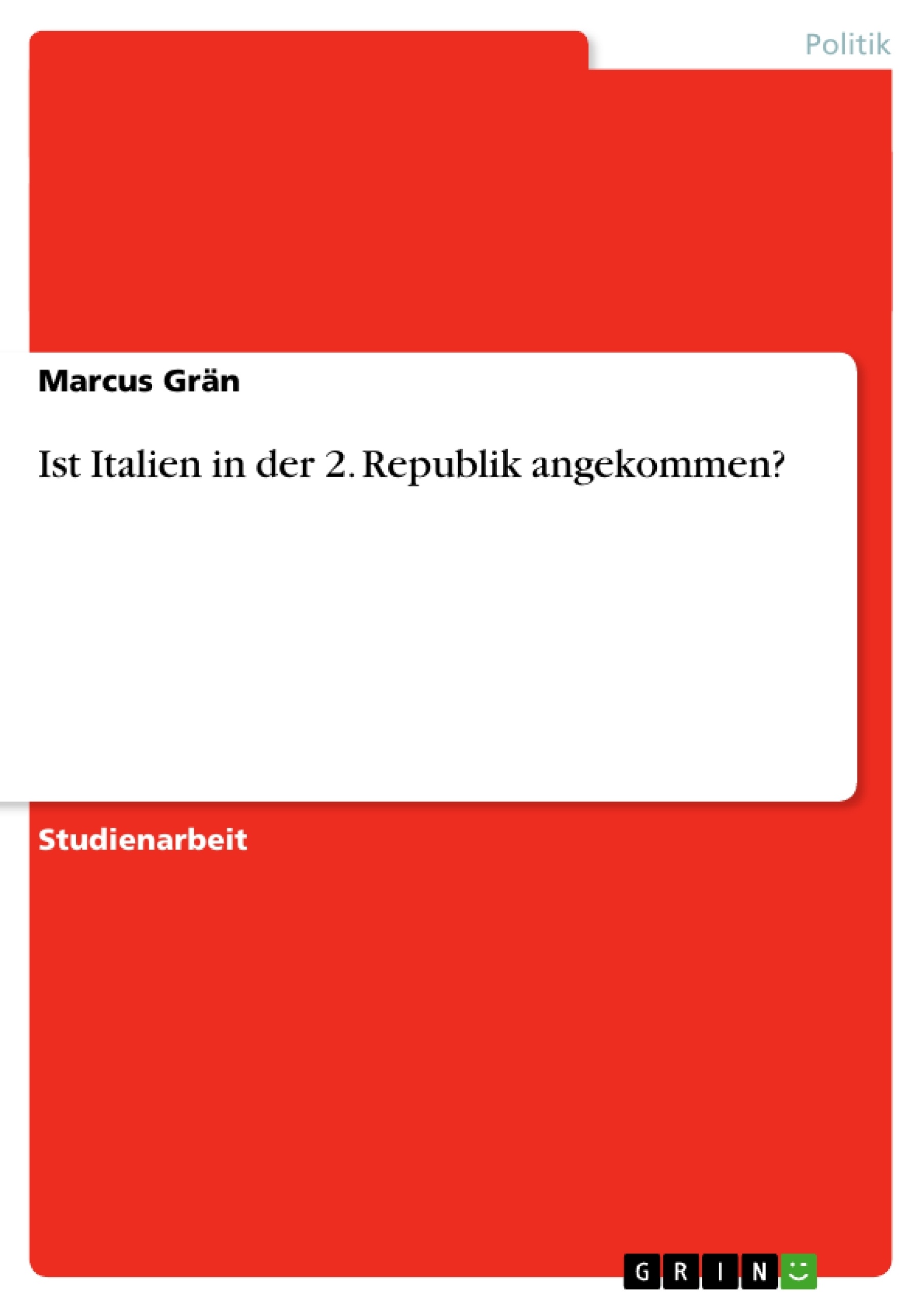In Zusammenhang mit dem politischen System Italiens, wird man im Regelfall zuerst an die hohe Anzahl an Regierungskrisen und wechselnden Ministerpräsidenten denken, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg regiert haben.
Das verwundert den Betrachter umso mehr, als dass eine Partei, die Democrazia Cristiana (DC), an allen Regierungen zwischen 1946 und 1994 beteiligt gewesen ist und bis auf wenige Ausnahmen den Regierungschef gestellt hat.
Diese Serie ging jedoch zu Beginn der 90er Jahre zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt deckten Richter in Mailand in großem Umfang illegale Parteienfinanzierungen auf und fanden heraus, dass sich dabei Politiker fast aller Parteien persönlich bereichert hatten (Trautmann, 1999:534f). Über Jahrzehnte hatte sich in Italien eine Parteienfinanzierung etabliert, die in Europa einzigartig war. Meist zahlten Unternehmen hohe Beträge, so genannte “Abgaben“ (tangenti), unter anderem an Beamte, Parlamentarier, Minister und Parteipolitiker, um so die Erteilung öffentlicher Aufträge durch Gemeinden, Regionen und den Staat sicher zu stellen. (ebd.)
In der Folge führte dies zu einem Zusammenbruch des etablierten Parteiensystems. Viele Parteien kamen ihrem Verbot zuvor und lösten sich auf oder gingen in anderen Parteien auf. So auch die Democrazia Cristiana. Es entstanden neue Parteien und Gruppierungen und viele Stimmen in der politischen Wissenschaft sprechen seit dem von der Existenz der zweiten italienischen Republik.
Diese Hausarbeit versucht anhand des Umbruchs im italienischen Parteiensystems zu ermitteln, ob in diesem Zusammenhang tatsächlich von einer zweiten Republik, als Abgrenzung zur ersten Republik, gesprochen werden kann oder ob möglicherweise Zweifel angebracht sind, weil bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Als Basistexte dienen hierzu “Das politische System Italiens“ von Günter Trautmann, aus der 1999 erschienenen 2. Auflage von “Die politischen Systeme Westeuropas“ und “Auf dem Weg in die Zweite Republik: Die neuen Akteure Lega Nord, Forza Italia und La Rete im Vergleich“ von Elisabeth Fix, erschienen 1999.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die italienischen Institutionen
- Der Italienische Staatspräsident
- Parlament und Senat
- Die Regierung
- Regionen
- Die italienischen Parteien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, ob der Umbruch im italienischen Parteiensystem zu Beginn der 1990er Jahre die Entstehung einer „zweiten Republik“ rechtfertigt. Die Arbeit analysiert, ob sich die zentralen politischen Institutionen Italiens – Staatspräsident, Parlament, Regierung – ausreichend von der „ersten Republik“ unterscheiden, um von einem Systemwechsel zu sprechen.
- Der Wandel des italienischen Parteiensystems nach dem Zusammenbruch der Democrazia Cristiana.
- Vergleich der italienischen Institutionen der „ersten“ und der vermeintlichen „zweiten“ Republik.
- Analyse der Stabilität und Regierungsfähigkeit Italiens im Kontext der Regierungswechsel.
- Bewertung der Rolle des Staatspräsidenten und des Parlaments im politischen System.
- Auswirkungen von Wahlrechtsreformen auf die Fragmentierung des Parteiensystems.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Existenz einer zweiten italienischen Republik im Kontext der zahlreichen Regierungswechsel und des Zusammenbruchs des alten Parteiensystems dar. Sie führt in die Thematik ein und benennt die verwendeten Quellen, insbesondere das Werk von Günter Trautmann über das politische System Italiens und die Arbeit von Elisabeth Fix zu den neuen politischen Akteuren. Die illegale Parteienfinanzierung der 90er Jahre wird als Katalysator des Systemwandels identifiziert.
Die italienischen Institutionen: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen der zentralen staatlichen Institutionen Italiens, um festzustellen, ob diese einen Systemwandel belegen. Es untersucht die Rolle des Staatspräsidenten, dessen Kompetenzen zwar verfassungsrechtlich definiert sind, aber im Vergleich zu anderen Ländern begrenzt bleiben. Die Kapitel befasst sich auch mit dem Parlament, bestehend aus Abgeordnetenkammer und Senat, deren Zusammensetzung und Befugnisse seit der Verfassung von 1948 im Wesentlichen unverändert blieben. Trotz Wahlrechtsreformen bleibt die Fragmentierung des Parteiensystems bestehen, was die Regierungsbildung erschwert. Die häufige Abfolge von Regierungswechseln wird ebenfalls im Kontext der institutionellen Strukturen analysiert, wobei die historische Perspektive auf die Regierungswechsel vor der Republik beleuchtet wird. Die Kapitel beschreibt, dass Mehrparteienkoalitionen oft notwendig sind um eine Regierung zu bilden.
Schlüsselwörter
Zweite Italienische Republik, Parteiensystem, Regierungswechsel, Staatspräsident, Parlament, Senat, Wahlrecht, Regierungsbildung, Koalitionen, Democrazia Cristiana, illegale Parteienfinanzierung, institutioneller Wandel.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Die Zweite Italienische Republik?"
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht, ob der tiefgreifende Wandel im italienischen Parteiensystem Anfang der 1990er Jahre die Entstehung einer "zweiten Republik" rechtfertigt. Sie analysiert dazu die Veränderungen zentraler politischer Institutionen und deren Auswirkungen auf die Regierungsstabilität und -fähigkeit Italiens.
Welche Institutionen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert die Veränderungen des italienischen Staatspräsidenten, des Parlaments (Abgeordnetenkammer und Senat), der Regierung und der Regionen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich dieser Institutionen in der "ersten" und der vermeintlichen "zweiten" Republik.
Welche Aspekte des italienischen Parteiensystems werden betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht den Wandel des italienischen Parteiensystems nach dem Zusammenbruch der Democrazia Cristiana, die Fragmentierung des Parteiensystems nach Wahlrechtsreformen und die Auswirkungen auf die Regierungsbildung (häufige Regierungswechsel und die Notwendigkeit von Mehrparteienkoalitionen).
Welche Rolle spielt der Staatspräsident in der Analyse?
Die Rolle des Staatspräsidenten wird im Kontext seiner verfassungsrechtlich definierten, aber im internationalen Vergleich begrenzten Kompetenzen analysiert. Die Arbeit untersucht, ob sich seine Rolle im Vergleich zur "ersten Republik" signifikant verändert hat.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hausarbeit bezieht sich insbesondere auf das Werk von Günter Trautmann über das politische System Italiens und die Arbeit von Elisabeth Fix zu den neuen politischen Akteuren. Die illegale Parteienfinanzierung der 90er Jahre wird als wichtiger Katalysator des Systemwandels identifiziert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der "zweiten Republik"?
Die Arbeit kommt zu keiner expliziten Schlussfolgerung in Bezug auf die Existenz einer "zweiten Republik". Sie analysiert jedoch umfassend die Veränderungen der Institutionen und des Parteiensystems, um diese Frage zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zweite Italienische Republik, Parteiensystem, Regierungswechsel, Staatspräsident, Parlament, Senat, Wahlrecht, Regierungsbildung, Koalitionen, Democrazia Cristiana, illegale Parteienfinanzierung, institutioneller Wandel.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu den italienischen Institutionen (Staatspräsident, Parlament, Regierung, Regionen), ein Kapitel zu den italienischen Parteien und ein Fazit.
Wie wird die Regierungsbildung in Italien im Kontext der Arbeit betrachtet?
Die häufige Abfolge von Regierungswechseln und die Notwendigkeit von Mehrparteienkoalitionen zur Regierungsbildung werden im Kontext der institutionellen Strukturen und der Fragmentierung des Parteiensystems analysiert. Die historische Perspektive auf Regierungswechsel vor der Republik wird ebenfalls beleuchtet.
- Quote paper
- Marcus Grän (Author), 2008, Ist Italien in der 2. Republik angekommen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115325