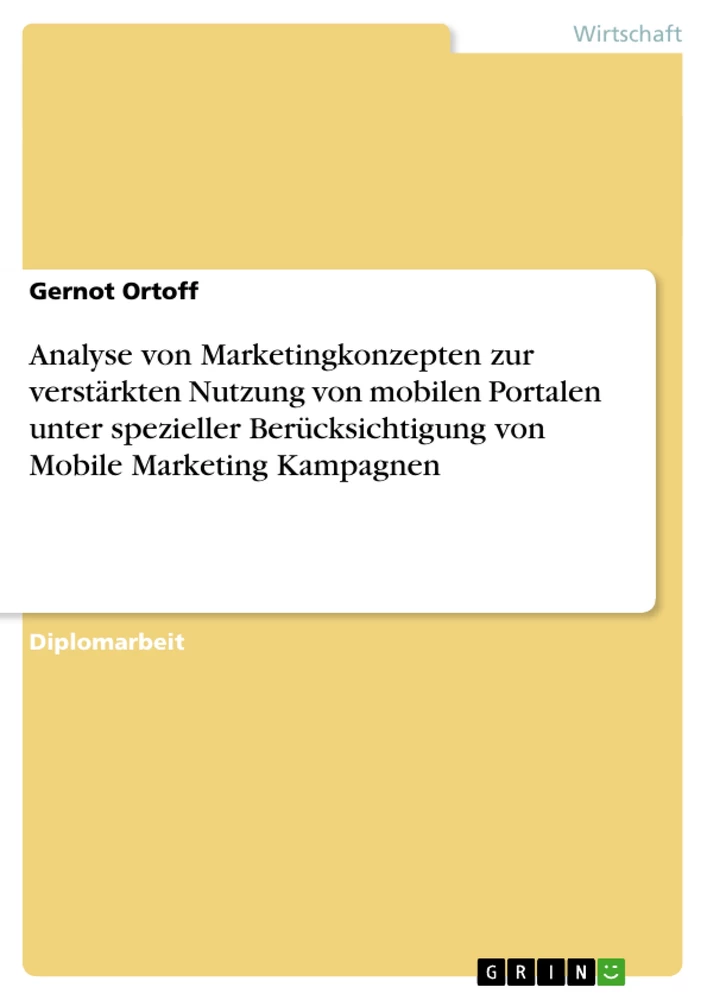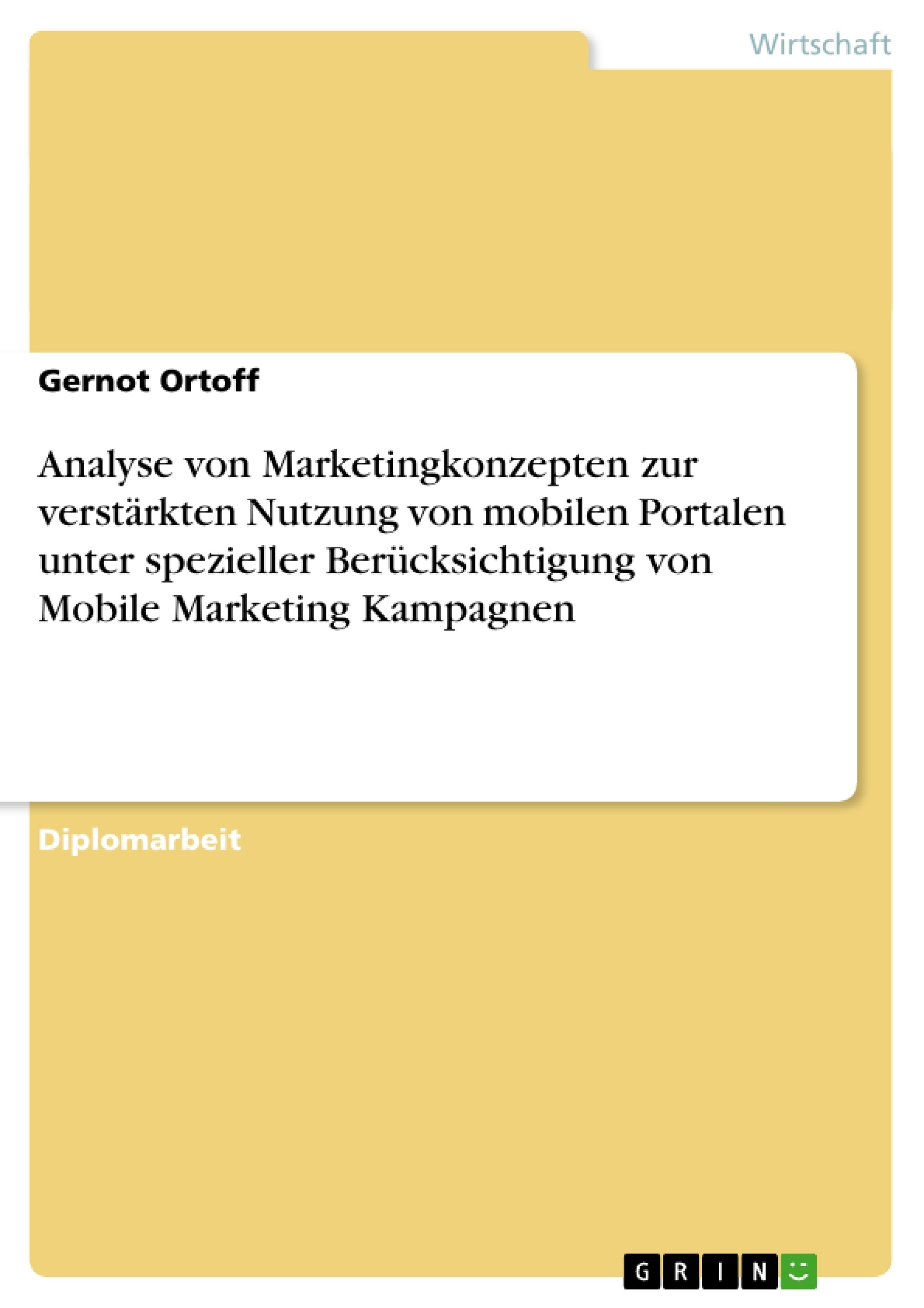Das Mobiltelefon zählt in Österreich mittlerweile zu den Dingen des täglichen
Gebrauchs und ermöglicht es ubiquitär mobile Sprach- und Datendienste sowie
mobile Unterhaltung zu nutzen. Bisher wurde jedoch ein Großteil der Mobilfunkumsätze
nur mittels reiner Sprachdienste erzielt. Aufgrund aber der immer besser
werdenden Endgeräte sowie der leistungsfähigeren Technologien soll zukünftig der
Anteil an Datendiensten und an mobilen Unterhaltungsmöglichkeiten gesteigert
werden, um die Marktpotenziale noch besser ausschöpfen zu können. Dass solch
eine verstärkte mobile Portalnutzung bereits möglich ist, zeigt das in Japan sehr
erfolgreiche mobile Portal i-mode von NTT DoCoMo.
Um jedoch eine verstärkte Inanspruchnahme mobiler Dienste auch in Österreich zu
ermöglichen, bedarf es einerseits umfangreicher Kenntnisse des österreichischen
Mobilfunkmarktes und der Akzeptanzfaktoren mobiler Services, sowie andererseits
Portalinhalten die für die Mobilfunknutzer einen Nutzen und eine hohe Relevanz
darstellen. Neben diesen Kernfaktoren stellen jedoch auch ausgeklügelte
Marketingkonzepte für den Erfolg eine zentrale Rolle dar, um diese mobilen Services
auch den Konsumenten richtig kommunizieren zu können.
Der dafür mögliche Einsatz von Mobile Marketing als Kommunikationsinstrument für
werbetreibende Unternehmen bietet die besten Voraussetzungen, um mit den
Konsumenten individualisiert und personalisiert in direkten Kontakt zu treten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Aufbau und Zielsetzung
- 2. Akzeptanzmodelle mobiler Portale
- 2.1. Studie “Journal of the Academy of Marketing Science”
- 2.2. Studie von VTT Information Technologie
- 3. Kritische Nutzungsanalyse
- 3.1. Nutzungsgelegenheiten
- 3.2. Bevorzugter Content
- 3.2.1. Nutzung nicht transaktionsorientierter Dienste
- 3.2.2. Nutzung transaktionsorientierter Dienste
- 3.3. Positive Beurteilung mobiler Dienste
- 3.4. Negative Beurteilung mobiler Dienste
- 3.5. Handlungsempfehlungen
- 3.6. Mobile Portale in Österreich
- 3.6.1. Soziodemographische Nutzertypologien
- 3.6.2. Psychographische Nutzertypologien
- 3.6.3. Meteorotroper Nutzungseinfluss
- 3.6.4. Content-Analyse
- 4. Vergleichsmarkt Japan
- 4.1. Kulturelle Unterschiede
- 4.2. Serviceorientierte Unterschiede
- 4.3. Content-Kategorien von i-mode
- 4.4. Best Practise: Girlswalker
- 4.5. Handlungsempfehlungen
- 5. Mobile Marketing
- 5.1. Rahmenbedingungen
- 5.1.1. Permission Marketing
- 5.1.2. Kampagnenmechaniken
- 5.1.2.1. Push-Mechanik
- 5.1.2.2. Pull-Mechanik
- 5.1.2.3. Vergleichsanalyse Push – Pull
- 5.1.2.4. Virales Marketing
- 5.1.2.4.1. Best Practise: WELLA – Virtual Kiss
- 5.1.3. Formen des Mobile Marketing
- 5.1.4. Ziele des Mobile Marketing
- 5.1.5. Akzeptanzfaktoren Mobile Marketing
- 5.2. Crossmediale Integration von Mobile Marketing
- 5.2.1. Crossmedia-Effekt
- 5.2.2. Crossmedia-Response
- 5.3. Akzeptanz Direktmarketing – Österreich
- 5.1. Rahmenbedingungen
- 6. Best Practises
- 6.1. BMW
- 6.1.1. BMW 1er
- 6.1.1.1. Kommunikationspolitik
- 6.1.1.2. Mediaplanung
- 6.1.1.2.1. Internet
- 6.1.1.2.2. Mobiles Portal
- 6.1.1.2.3. PDA
- 6.1.1.2.4. Print
- 6.1.1.2.5. TV Spot
- 6.1.1.2.6. Zusätzliche Verkaufsförderung
- 6.1.1.3. Response
- 6.1.2. BMW 3er
- 6.1.2.1. Mediaplanung
- 6.1.2.1.1. Print
- 6.1.2.1.2. TV-Spot
- 6.1.2.1.3. Internet
- 6.1.2.1.4. Mobiles Portal
- 6.1.2.1.5. Zusätzliche Verkaufsförderung
- 6.1.2.2. Response
- 6.1.2.1. Mediaplanung
- 6.1.3. Handlungsempfehlungen
- 6.1.1. BMW 1er
- 6.2. Mc Donald’s
- 6.2.1. Mc Donald’s „Text a Monster“
- 6.2.1.1. Kampagnenausgestaltung
- 6.2.1.2. Handlungsempfehlungen
- 6.2.2. Findet Nemo
- 6.2.2.1. Mobile Kampagne
- 6.2.2.2. Response
- 6.2.2.3. Handlungsempfehlungen
- 6.2.1. Mc Donald’s „Text a Monster“
- 6.3. Coca-Cola
- 6.3.1. Cokefridge
- 6.3.1.1. Funktionsweise - Cokefridge
- 6.3.1.2. Mobile Marketing „Shoot & Enter“
- 6.3.1.3. Response
- 6.3.1.4. Handlungsempfehlungen
- 6.3.2. Fanta - Flaschenpost
- 6.3.2.1. Kampagnenmechanik
- 6.3.2.2. Mediaplanung
- 6.3.2.3. Response
- 6.3.3. Cool Summer - Lucky Star
- 6.3.4. Handlungsempfehlungen
- 6.3.1. Cokefridge
- 6.1. BMW
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert Marketingkonzepte zur Steigerung der Nutzung mobiler Portale, insbesondere im Kontext von Mobile-Marketing-Kampagnen. Die Arbeit untersucht Akzeptanzmodelle, kritische Nutzungsaspekte des österreichischen und japanischen Marktes, und präsentiert Best-Practice-Beispiele von Mobile-Marketing-Kampagnen.
- Akzeptanzfaktoren mobiler Portale und Services
- Nutzungsverhalten und -motive im österreichischen Mobilfunkmarkt
- Vergleichende Analyse des japanischen i-mode-Marktes
- Ausgestaltung und Erfolgsfaktoren von Mobile-Marketing-Kampagnen
- Crossmediale Integration von Mobile Marketing
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der verstärkten Nutzung mobiler Portale in Österreich ein und stellt die zentrale Problematik dar: Die erfolgreiche Implementierung mobiler Dienste und Mobile-Marketing-Kampagnen erfordert ein tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse. Die Arbeit skizziert die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
2. Akzeptanzmodelle mobiler Portale: Dieses Kapitel untersucht zwei empirische Studien, um die Kernfaktoren für die verstärkte Nutzung mobiler Dienste zu identifizieren. Die Studie aus dem "Journal of the Academy of Marketing Science" hebt die Bedeutung von wahrgenommenem Vergnügen ("perceived enjoyment") und Nutzen ("perceived usefulness") hervor. Die VTT-Studie erweitert das Technology Acceptance Model und betont den "perceived value" des Angebots, die einfache Adaption und Benutzerfreundlichkeit sowie das Vertrauen in den Anbieter.
3. Kritische Nutzungsanalyse: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Studien, um die Nutzungsgelegenheiten, den bevorzugten Content und die Akzeptanzfaktoren mobiler Dienste zu ergründen. Es zeigt, dass mobile Dienste oft in kurzen Zeitfenstern genutzt werden und daher schnell zugängliche, nutzenstiftende Inhalte wichtig sind. Positive Aspekte sind Aktualität, Zeitersparnis und Preisvorteile, während negative Aspekte Kosten, Schnelligkeit und Usability betreffen. Der österreichische Markt wird im Detail betrachtet, einschließlich soziodemografischer und psychografischer Nutzertypologien sowie des Einflusses des Wetters auf die Portalnutzung.
4. Vergleichsmarkt Japan: Das Kapitel vergleicht den österreichischen Markt mit dem japanischen i-mode-Markt. Der Erfolg von i-mode wird auf kulturelle Faktoren und die serviceorientierte Gestaltung des Portals zurückgeführt. Die Analyse konzentriert sich auf kulturelle Unterschiede, serviceorientierte Aspekte, die Content-Kategorien von i-mode und das Best-Practice-Beispiel Girlswalker, das virales Marketing erfolgreich einsetzt.
5. Mobile Marketing: Dieses Kapitel definiert Mobile Marketing und erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen (Permission Marketing). Es werden verschiedene Kampagnenmechaniken (Push, Pull, virales Marketing) vorgestellt und anhand von Studien deren Akzeptanzfaktoren untersucht. Die Bedeutung von Mehrwert, Personalisierung und Vertrauen wird hervorgehoben. Crossmediale Integration wird als Schlüssel zum Erfolg betont.
6. Best Practises: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Analysen erfolgreicher Mobile-Marketing-Kampagnen von BMW, McDonald's und Coca-Cola. Die Fallstudien zeigen die erfolgreiche Anwendung verschiedener Strategien und Kommunikationsmittel und liefern wertvolle Einblicke in die Gestaltung und Umsetzung von Mobile-Marketing-Kampagnen.
Schlüsselwörter
Mobile Portale, Mobile Marketing, Akzeptanz, Nutzerverhalten, Content-Analyse, Japanischer Markt (i-mode), Crossmediale Integration, Kundenbindung, Kampagnenmechaniken (Push, Pull, Viral), Best Practices (BMW, McDonald's, Coca-Cola), Permission Marketing, User Experience (UX), Usability.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Marketingkonzepte zur Steigerung der Nutzung mobiler Portale
Was ist das zentrale Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert Marketingkonzepte zur Steigerung der Nutzung mobiler Portale, insbesondere im Kontext von Mobile-Marketing-Kampagnen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung von Akzeptanzmodellen, kritischen Nutzungsaspekten des österreichischen und japanischen Marktes und der Präsentation von Best-Practice-Beispielen erfolgreicher Mobile-Marketing-Kampagnen.
Welche Akzeptanzmodelle mobiler Portale werden untersucht?
Die Arbeit untersucht zwei empirische Studien: Eine Studie aus dem "Journal of the Academy of Marketing Science", die die Bedeutung von wahrgenommenem Vergnügen und Nutzen hervorhebt, und eine VTT-Studie, welche das Technology Acceptance Model erweitert und den "perceived value", die einfache Adaption, Benutzerfreundlichkeit und das Vertrauen in den Anbieter betont.
Wie wird das Nutzungsverhalten mobiler Portale analysiert?
Die Arbeit analysiert die Nutzungsgelegenheiten, den bevorzugten Content (transaktionsorientierte und nicht-transaktionsorientierte Dienste) und die Akzeptanzfaktoren mobiler Dienste. Dabei werden sowohl positive (Aktualität, Zeitersparnis, Preisvorteile) als auch negative Aspekte (Kosten, Schnelligkeit, Usability) beleuchtet. Eine detaillierte Betrachtung des österreichischen Marktes beinhaltet soziodemografische und psychografische Nutzertypologien sowie den Einfluss des Wetters auf die Nutzung.
Wie wird der japanische Markt im Vergleich zum österreichischen Markt betrachtet?
Die Arbeit vergleicht den österreichischen Markt mit dem japanischen i-mode-Markt. Der Erfolg von i-mode wird auf kulturelle Faktoren und die serviceorientierte Gestaltung des Portals zurückgeführt. Die Analyse konzentriert sich auf kulturelle Unterschiede, serviceorientierte Aspekte, die Content-Kategorien von i-mode und das Best-Practice-Beispiel Girlswalker, welches virales Marketing erfolgreich einsetzt.
Welche Aspekte des Mobile Marketings werden behandelt?
Die Arbeit definiert Mobile Marketing, erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen (Permission Marketing) und stellt verschiedene Kampagnenmechaniken (Push, Pull, virales Marketing) vor. Die Akzeptanzfaktoren werden anhand von Studien untersucht, wobei die Bedeutung von Mehrwert, Personalisierung und Vertrauen hervorgehoben wird. Die crossmediale Integration wird als Schlüssel zum Erfolg betont.
Welche Best-Practice-Beispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert detaillierte Analysen erfolgreicher Mobile-Marketing-Kampagnen von BMW (BMW 1er und 3er), McDonald's ("Text a Monster" und "Findet Nemo") und Coca-Cola (Cokefridge, Fanta - Flaschenpost und Cool Summer - Lucky Star). Die Fallstudien zeigen die erfolgreiche Anwendung verschiedener Strategien und Kommunikationsmittel.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die zentralen Schlüsselwörter sind: Mobile Portale, Mobile Marketing, Akzeptanz, Nutzerverhalten, Content-Analyse, Japanischer Markt (i-mode), Crossmediale Integration, Kundenbindung, Kampagnenmechaniken (Push, Pull, Viral), Best Practices (BMW, McDonald's, Coca-Cola), Permission Marketing, User Experience (UX), Usability.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit untersucht, welche Akzeptanzfaktoren für die Nutzung mobiler Portale entscheidend sind, wie das Nutzungsverhalten im österreichischen Mobilfunkmarkt aussieht, wie sich der österreichische Markt vom japanischen i-mode-Markt unterscheidet, welche Faktoren den Erfolg von Mobile-Marketing-Kampagnen bestimmen und wie Mobile Marketing crossmedial integriert werden kann.
- Quote paper
- Magister Gernot Ortoff (Author), 2006, Analyse von Marketingkonzepten zur verstärkten Nutzung von mobilen Portalen unter spezieller Berücksichtigung von Mobile Marketing Kampagnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115229