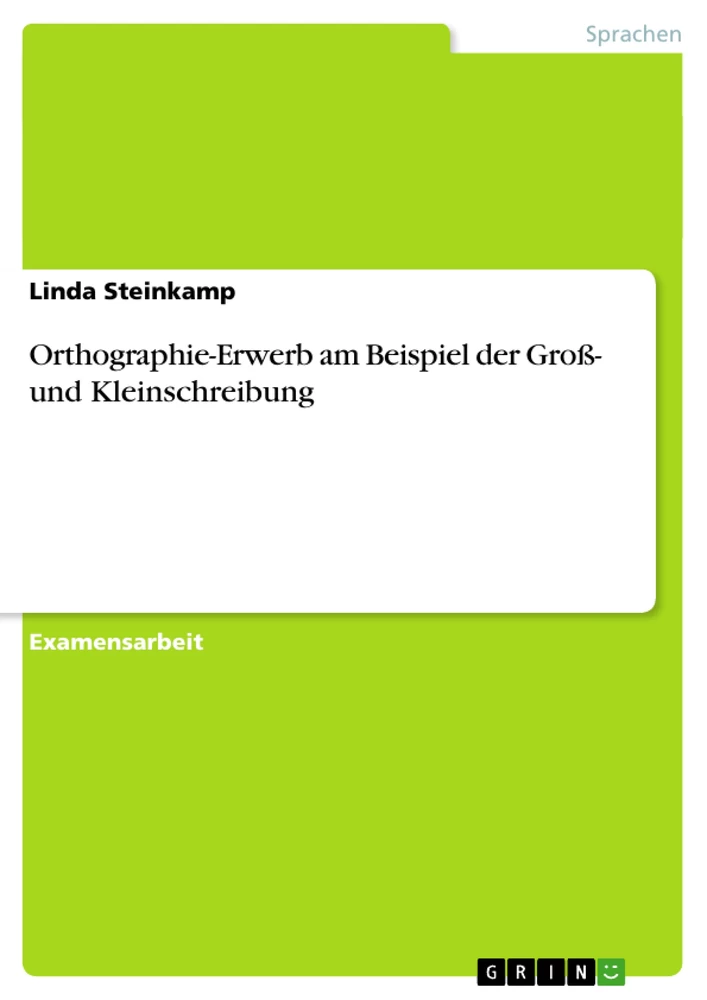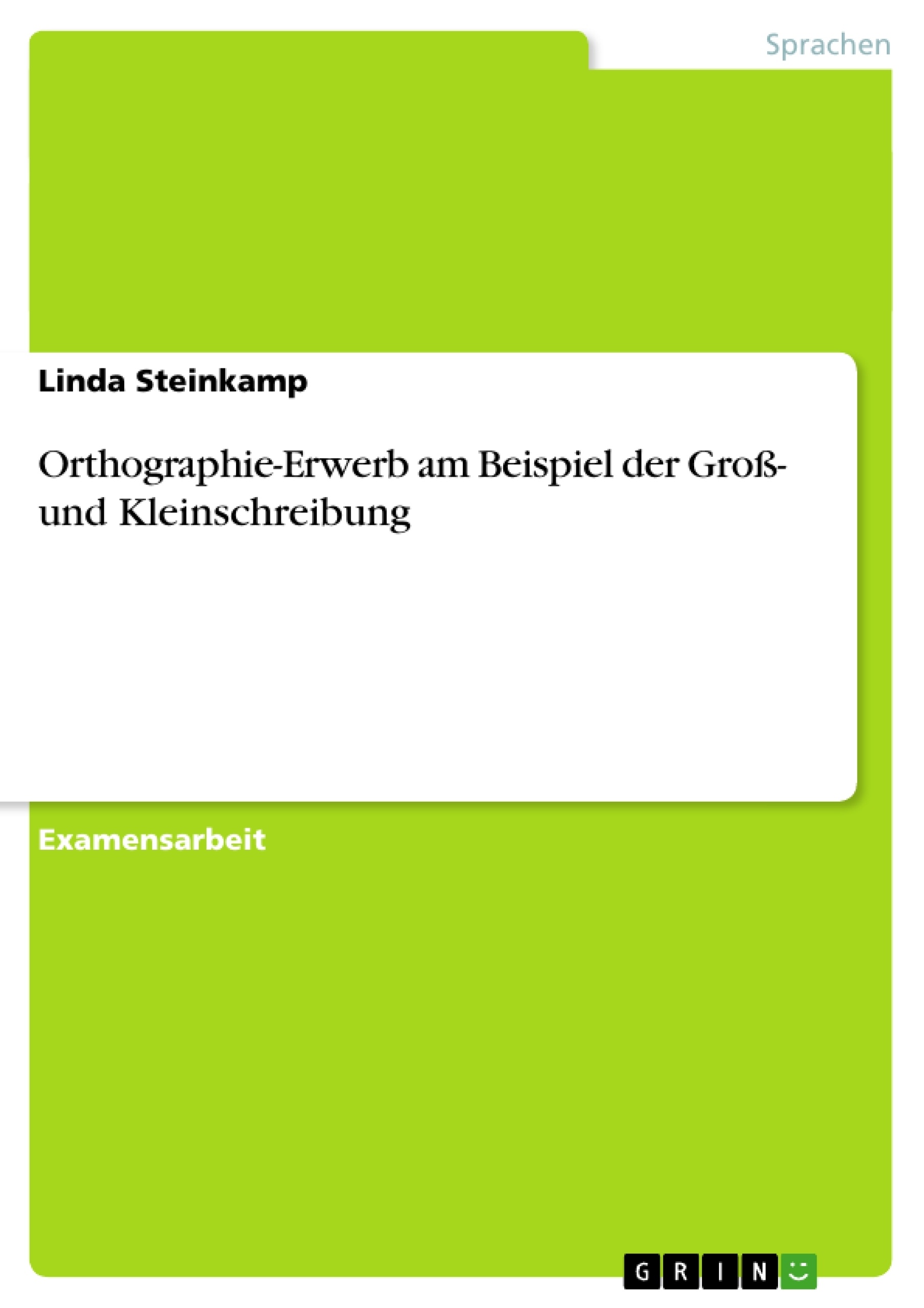„Ein Hauptgrund für abgelehnte Bewerbungen sind die mangelnden Rechtschreibkenntnisse der Schulabgänger.“ Das liest und hört man immer wieder und meistens lastet die Schuldzuweisung auf den Schultern der Lehrer. Keine Frage, „die Vermittlung von sicheren Rechtschreibfähigkeiten ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe des Deutschunterrichts“1. Doch woher rühren all die Mängel? Sind wirklich nur die Lehrer schuld? Verunsichert nicht auch die Rechtschreibreform und die Reform der Reform Schüler, Lehrer und alle mit Sprache agierenden Wesen? Ist es die Didaktik, der die Lehrer die Schuld zuweisen können? Oder trägt die Sprache allein die Last? Kann es einen Weg geben dem Mangel ein Ende zu bereiten, einen Weg hinaus aus dem Dschungel deutscher Rechtschreibung?
Sicher können all diese Fragen nicht beantwortet werden. Aber es lohnt sich allemal einen Blick auf dieses weite Feld der Orthographie und dessen Erwerb zu werfen. Es stellt sich die Frage, wie Kinder eigentlich rechtschreiben lernen und ob die vermittelten Regeln und das Wissen ausreichend sind, um erfolgreich schreiben zu können. Wenn die Rechtschreibkenntnisse der Schulabgänger bemängelt werden, so ist auch ein „Nachdenken über eine Optimierung des Schrifterwerbs höchst aktuell“ und unbedingt notwendig.
Als eines der wichtigsten und zugleich problematischsten Felder im Bereich des Orthographie-Erwerbs gilt die Groß- und Kleinschreibung (im Folgenden auch GKS). Bemerkenswert ist, „dass am Ende der Primarstufe ungefähr jeder vierte Orthographie-Fehler die GKS betrifft“ . Allein schon aus diesem Grund scheint eine nähere Betrachtung und Erforschung dieses problematischen Feldes lohnenswert und sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Regeln der satzinternen Groß- und Kleinschreibung als Wissensbasis für Schüler und Lehrer
- Die traditionelle Didaktik
- Ein neuer Ansatz als Alternative
- Erhebung von Orthographie-Kenntnissen im Bereich der Groß- und Kleinschreibung am Ende der Grundschulzeit
- Das Diktat
- Die Schülertexte und erste Eindrücke
- Die „Artikelprobe“ und „das schreibt man immer so“ oder wie Schüler ihre Schreibungen begründen
- Die Nomen
- Die Nominalisierungen
- Die Denominalisierungen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Erwerb der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen am Beispiel der satzinternen Regeln. Sie analysiert die traditionelle didaktische Praxis der wortartenbezogenen Vermittlung im Vergleich zu einem neuen Ansatz, der sich auf syntaktische Eigenschaften von Wörtern konzentriert. Die Arbeit untersucht anhand einer Erhebung an Grundschülern, wie Kinder das erlernte Wissen anwenden und welche Probleme dabei auftreten.
- Vermittlung der Groß- und Kleinschreibung in der traditionellen Didaktik
- Ein neuer Ansatz zur Groß- und Kleinschreibung basierend auf syntaktischen Eigenschaften
- Erhebung von Orthographie-Kenntnissen bei Grundschülern am Ende der Grundschulzeit
- Analyse der Begründungen von Schülern für ihre Groß- und Kleinschreibung
- Bewertung der Wirksamkeit traditioneller und neuer didaktischer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Orthographie, insbesondere die Schwierigkeiten im Bereich der Groß- und Kleinschreibung, und führt in das Thema der Arbeit ein. Kapitel 2 untersucht die traditionelle Didaktik der Groß- und Kleinschreibung, die auf Wortarten basiert, und zeigt ihre Stärken und Schwächen auf. Im Fokus steht dabei die wortartenbezogene Vermittlung in aktuellen Schulbüchern. Anschließend präsentiert Kapitel 2 einen alternativen didaktischen Ansatz, der die Groß- und Kleinschreibung als syntaktische Markierung betrachtet.
In Kapitel 3 wird eine Erhebung von Orthographie-Kenntnissen im Bereich der Groß- und Kleinschreibung am Ende der Grundschulzeit beschrieben. Das Kapitel erläutert die Methodik der Erhebung, die auf einem Diktat und anschließenden Interviews mit Schülern basiert. Anschließend präsentiert Kapitel 3 erste Eindrücke aus den Schülertexten und zeigt die Schwierigkeiten der Schüler mit der Groß- und Kleinschreibung auf.
Kapitel 4 analysiert die Begründungen der Schüler für ihre Schreibungen in Bezug auf Nomen, Nominalisierungen und Denominalisierungen. Das Kapitel zeigt auf, wie die Kinder das ihnen vermittelte Regelwissen anwenden und welche Probleme dabei auftreten. Es beleuchtet die Rolle der Artikelprobe als Kontrollmöglichkeit und diskutiert die Grenzen der traditionellen Wortartenlehre.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Orthographie, Groß- und Kleinschreibung (GKS), satzinterne Großschreibung, traditionelle Didaktik, wortartenbezogene Vermittlung, neuer Ansatz, syntaktische Markierung, Nominalisierung, Denominalisierung, Artikelprobe, Erhebung, Schülertexte, Begründungen.
- Quote paper
- Linda Steinkamp (Author), 2007, Orthographie-Erwerb am Beispiel der Groß- und Kleinschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115206