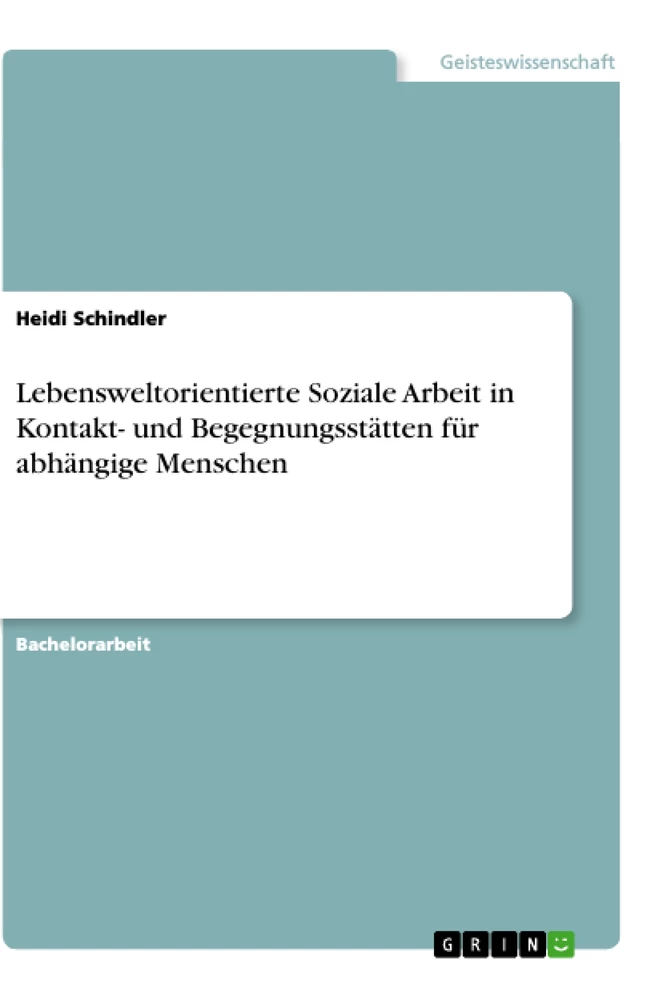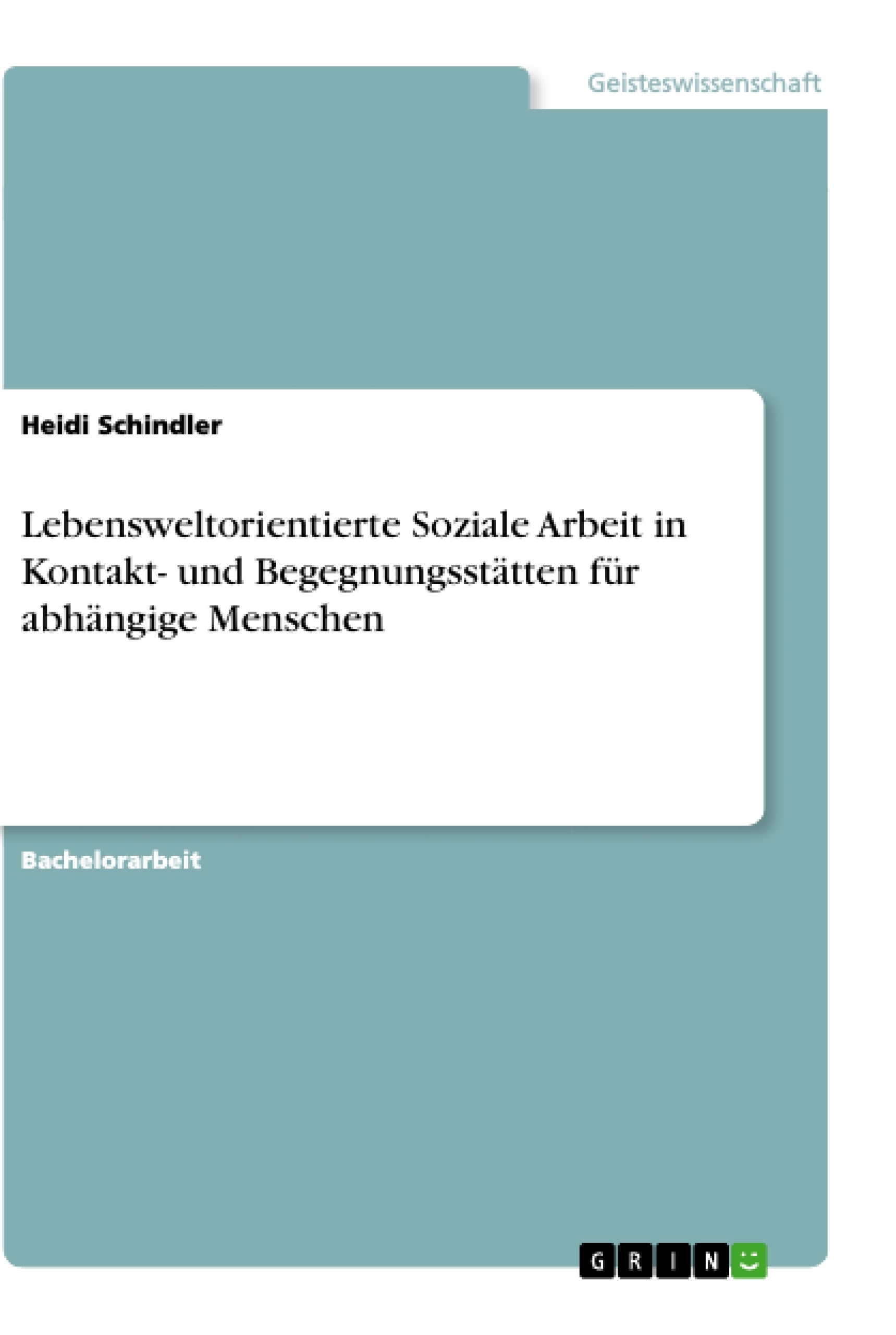Im Mittelpunkt dieser Bachelorthesis steht die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Die Motivation, sich mit einer Theorie der Sozialen Arbeit auseinander zu setzen, entstand während des täglichen Handelns und Wirken im Praxisfeld mit konsumierenden Adressat*innen psychoaktiver Substanzen. Im Suchthilfesystem arbeiten unterschiedliche Professionen zusammen. Innerhalb dieser Konstellation ist das Bedürfnis gewachsen mit einer Theorie der Profession der Sozialen Arbeit, das Handeln und Wirken, fachlich begründen zu können.
Die Arbeit beantwortet die Forschungsfrage: Kann mit der aktuellen Richtlinie des Bezirks Oberbayern für Kontakt- und Begegnungsstätten für konsumierende Adressat*innen psychoaktiver Substanzen, eine Lebensweltorientierte Soziale Arbeit umgesetzt werden? Der Aufbau der Kapitel folgt dem wissenschaftlichen verstehen. Dazu wird vorab die Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch erörtert. Die Theorie der Sozialen Arbeit und die Aufträge die Thiersch an die Profession der Sozialen Arbeit stellt. Die theoriegeleiteten Zugänge sind mit einem weiteren Kapitel verankert. Die Zugänge, die Dimensionen und die Struktur- und Handlungsmaxime folgen. Aus dem Handlungsmaximen werden die Erkennungsmerkmale erarbeitet, dieses dienen im weiteren Verlauf der Arbeit zur Bewertung der Richtlinie. Thiersch benennt die Handlungs- und Strukturmaxime als Merkmal Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsbestimmung
- 2. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
- 2.1 Theoriebezüge der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 2.2 Lebenswelt als Handlungsfeld für Sozialarbeiter*innen
- 2.3 Dimensionen des Alltags
- 2.4 Struktur- und Handlungsmaxime der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 2.4.1 Prävention auf zwei Ebenen
- 2.4.1.1 Erkennungsmerkmale - Allgemeine Prävention
- 2.4.2 Alltagsnähe
- 2.4.2.1 Erkennungsmerkmale - Alltagsnähe
- 2.4.3 Dezentralisierung
- 2.4.3.1 Erkennungsmerkmale – Dezentralisierung
- 2.4.4 Integration
- 2.4.4.1 Erkennungsmerkmale – Integration
- 2.4.5 Partizipation
- 2.4.5.1 Erkennungsmerkmale – Partizipation
- 3. „Abhängigkeit“ Im Kontext von Medizin und Lebensweltorientierung
- 3.1 Medizinische Wahrnehmung auf „Abhängigkeit“
- 3.1.1 Bio-psycho-soziale Wahrnehmung auf „Abhängigkeit“ als Krankheit
- 3.1.2 Der salutogenetische Wahrnehmung von „Abhängigkeit“
- 3.1.3 Diagnose „Abhängigkeit“ als psychiatrische Erkrankung
- 3.1.4 Symptome von „Abhängigkeit“
- 3.1.5 Konsum psychoaktiver Substanzen als Medikament
- 3.1.6 Trauma und „Abhängigkeit“
- 3.2 Lebensweltorientierte Wahrnehmung zum Konsum von Substanzen
- 3.2.1 Konsumverhalten in der Lebenswelt der Adressat*innen
- 3.2.2 Normativ - kritische Wahrnehmung auf Konsum von Substanzen
- 3.2.3 Akzeptierende Haltung zu Konsumverhalten
- 4. Soziale Arbeit im „Suchthilfesystem“
- 4.1 Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe
- 4.2 Beratung und Behandlung an Suchtberatungsstellen
- 4.3 Niederschwellige Angebote für zieloffene Unterstützung
- 4.4 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit im „Suchthilfesystem“
- 4.4.1 Zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen als Merkmal einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 4.5 Der normative Rahmen des „Suchthilfesystems“
- 5. Sozialstaatliche Leistungen für seelisch Behinderte Adressat*innen
- 5.1 Gesetzliche Grundlage der Richtlinie
- 5.2 Unterstützungsangebote des Bezirks Oberbayern
- 5.3 Kontakt- und Begegnungsstätten für „suchtkranke Menschen“
- 6. Qualitätsmanagement und Sozialstaatlicher Leistungen
- 6.1 Qualität“ und „Qualitätssicherung
- 6.2 Die Richtlinie des Bezirks Oberbayern
- 7. Auswertung der Richtlinie nach Handlung- und Strukturmaxime der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 7.1 Allgemeine Prävention
- 7.1.1 Gesamtbewertung - Allgemeine Prävention
- 7.2 Alltagsnähe
- 7.2.1 Gesamtbewertung - Alltagsnähe
- 7.3 Dezentralisierung
- 7.3.1 Gesamtbewertung - Dezentralisierung
- 7.4 Integration
- 7.4.1 Gesamtbewertung - Integration
- 7.5 Partizipation
- 7.5.1 Gesamtbewertung Partizipation
- 8. Auswertung der Richtlinie mit Zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 8.1 Gesamtbewertung - zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen
- 9. Gesamtergebnis zu Struktur-, Handlungsmaxime und Zieloffene Hilfen einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 10. Folgerungen in Bezug Konzeptentwicklung und kritischer Reflektion
- 10.1 Folgerung in Bezug Konzeptentwicklung
- 10.2 Kritische Reflektion
- 11. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Anwendung lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in Kontakt- und Begegnungsstätten für abhängige Menschen. Ziel ist der Vergleich mit den Richtlinien des Kostenträgers und die Ableitung von Folgerungen für die Konzeptentwicklung.
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch
- „Abhängigkeit“ im medizinischen und lebensweltorientierten Kontext
- Soziale Arbeit im Suchthilfesystem
- Sozialstaatliche Leistungen für seelisch behinderte Adressat*innen
- Qualitätsmanagement und dessen Übereinstimmung mit den Prinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in Kontakt- und Begegnungsstätten für abhängige Menschen ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs mit den Richtlinien des Kostenträgers.
2. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch: Dieses Kapitel erläutert die Theorie der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch. Es werden die zentralen Theoriebezüge, die Lebenswelt als Handlungsfeld, die Dimensionen des Alltags und die Struktur- und Handlungsmaxime (Prävention, Alltagsnähe, Dezentralisierung, Integration, Partizipation) detailliert dargestellt und anhand von Beispielen veranschaulicht. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Prinzipien, die für die spätere Analyse der Richtlinien des Kostenträgers essentiell sind.
3. „Abhängigkeit“ Im Kontext von Medizin und Lebensweltorientierung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der „Abhängigkeit“. Es vergleicht die medizinische Sichtweise (bio-psycho-soziales Modell, salutogenetischer Ansatz, psychiatrische Diagnostik, Symptome) mit einer lebensweltorientierten Perspektive. Die unterschiedlichen Auffassungen von Konsumverhalten, normative und akzeptierende Haltungen werden diskutiert. Der Zusammenhang von Trauma und Abhängigkeit wird ebenfalls beleuchtet, um ein umfassendes Bild der Problematik zu liefern.
4. Soziale Arbeit im „Suchthilfesystem“: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit innerhalb des Suchthilfesystems. Es werden Beratungsstellen, niederschwellige Angebote und die spezifischen Merkmale lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in diesem Kontext erläutert. Der normative Rahmen des Suchthilfesystems wird ebenfalls beleuchtet, um den Kontext der späteren Analyse zu schaffen.
5. Sozialstaatliche Leistungen für seelisch Behinderte Adressat*innen: Dieses Kapitel untersucht die gesetzlichen Grundlagen und Unterstützungsangebote des Bezirks Oberbayern für seelisch behinderte Menschen, insbesondere im Kontext von Sucht. Es beleuchtet die Rolle von Kontakt- und Begegnungsstätten und deren Angebote.
6. Qualitätsmanagement und Sozialstaatlicher Leistungen: Dieses Kapitel analysiert den Begriff der Qualität und Qualitätssicherung im Kontext sozialstaatlicher Leistungen. Die Richtlinien des Bezirks Oberbayern werden als Grundlage für die weitere Analyse vorgestellt und eingeordnet.
7. Auswertung der Richtlinie nach Handlung- und Strukturmaxime der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit: In diesem Kapitel wird eine detaillierte Auswertung der Richtlinien des Bezirks Oberbayern anhand der im Kapitel 2 dargestellten Struktur- und Handlungsmaxime der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit vorgenommen. Jede Maxime wird einzeln bewertet und mit Beispielen aus den Richtlinien belegt.
8. Auswertung der Richtlinie mit Zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswertung der Richtlinien im Bezug auf zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen im Rahmen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
9. Gesamtergebnis zu Struktur-, Handlungsmaxime und Zieloffene Hilfen einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit: Kapitel 9 fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und bietet eine umfassende Bewertung der Übereinstimmung zwischen den Richtlinien und den Prinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
10. Folgerungen in Bezug Konzeptentwicklung und kritischer Reflektion: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus der durchgeführten Analyse und gibt Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Konzepten lebensweltorientierter Sozialer Arbeit im Bereich der Sucht.
Schlüsselwörter
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Hans Thiersch, Abhängigkeit, Suchthilfe, Kontakt- und Begegnungsstätten, Qualitätsmanagement, Sozialstaatliche Leistungen, Bezirk Oberbayern, Richtlinien, Prävention, Integration, Partizipation, Alltagsnähe, Dezentralisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in Kontakt- und Begegnungsstätten für abhängige Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Anwendung lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in Kontakt- und Begegnungsstätten für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Sie vergleicht die praktische Umsetzung mit den Richtlinien des Kostenträgers (Bezirk Oberbayern) und leitet daraus Folgerungen für die Konzeptentwicklung ab.
Welche Theorie steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die Arbeit basiert auf dem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch. Zentrale Aspekte sind dessen Struktur- und Handlungsmaximen: Prävention, Alltagsnähe, Dezentralisierung, Integration und Partizipation.
Wie wird der Begriff „Abhängigkeit“ behandelt?
Die Arbeit vergleicht die medizinische (bio-psycho-soziale Perspektive, salutogenetischer Ansatz) und die lebensweltorientierte Sichtweise auf Abhängigkeit. Es werden unterschiedliche Auffassungen von Konsumverhalten, normative und akzeptierende Haltungen sowie der Zusammenhang von Trauma und Abhängigkeit diskutiert.
Welche Aspekte des Suchthilfesystems werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit im Suchthilfesystem, wie Beratungsstellen und niederschwellige Angebote. Sie beleuchtet die spezifischen Merkmale lebensweltorientierter Sozialer Arbeit in diesem Kontext und den normativen Rahmen des Systems.
Welche sozialstaatlichen Leistungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die gesetzlichen Grundlagen und Unterstützungsangebote des Bezirks Oberbayern für seelisch behinderte Menschen mit Suchtproblemen, insbesondere die Rolle von Kontakt- und Begegnungsstätten.
Wie wird das Qualitätsmanagement bewertet?
Die Arbeit analysiert den Begriff der Qualität und Qualitätssicherung im Kontext sozialstaatlicher Leistungen. Die Richtlinien des Bezirks Oberbayern werden auf ihre Übereinstimmung mit den Prinzipien der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit hin untersucht.
Wie erfolgt die Auswertung der Richtlinien?
Die Richtlinien des Bezirks Oberbayern werden detailliert anhand der Struktur- und Handlungsmaximen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit ausgewertet. Jede Maxime (Prävention, Alltagsnähe, Dezentralisierung, Integration, Partizipation) wird einzeln bewertet und mit Beispielen aus den Richtlinien belegt. Zusätzlich wird die Ausrichtung auf zieloffene Hilfen für konsumierende Adressat*innen analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse und gibt Empfehlungen für die Weiterentwicklung von Konzepten lebensweltorientierter Sozialer Arbeit im Bereich der Sucht. Es wird eine kritische Reflexion der Ergebnisse vorgenommen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, Hans Thiersch, Abhängigkeit, Suchthilfe, Kontakt- und Begegnungsstätten, Qualitätsmanagement, Sozialstaatliche Leistungen, Bezirk Oberbayern, Richtlinien, Prävention, Integration, Partizipation, Alltagsnähe, Dezentralisierung.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Der vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich im oberen Teil des ursprünglichen Dokuments. Er umfasst alle Kapitel und Unterkapitel der Arbeit.
- Citar trabajo
- Heidi Schindler (Autor), 2021, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in Kontakt- und Begegnungsstätten für abhängige Menschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151796