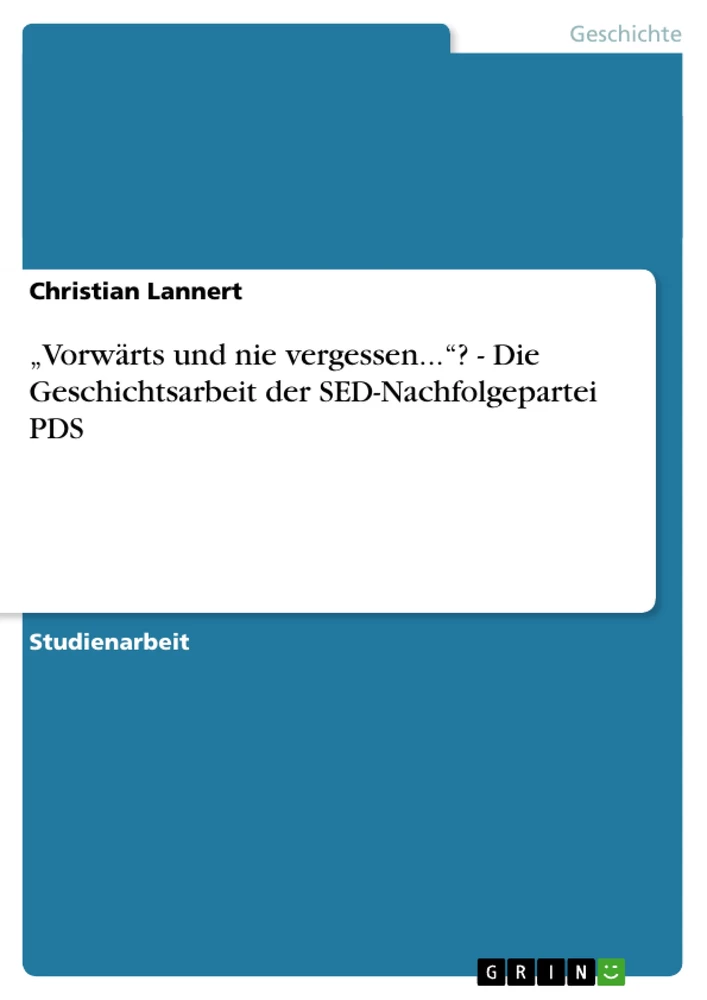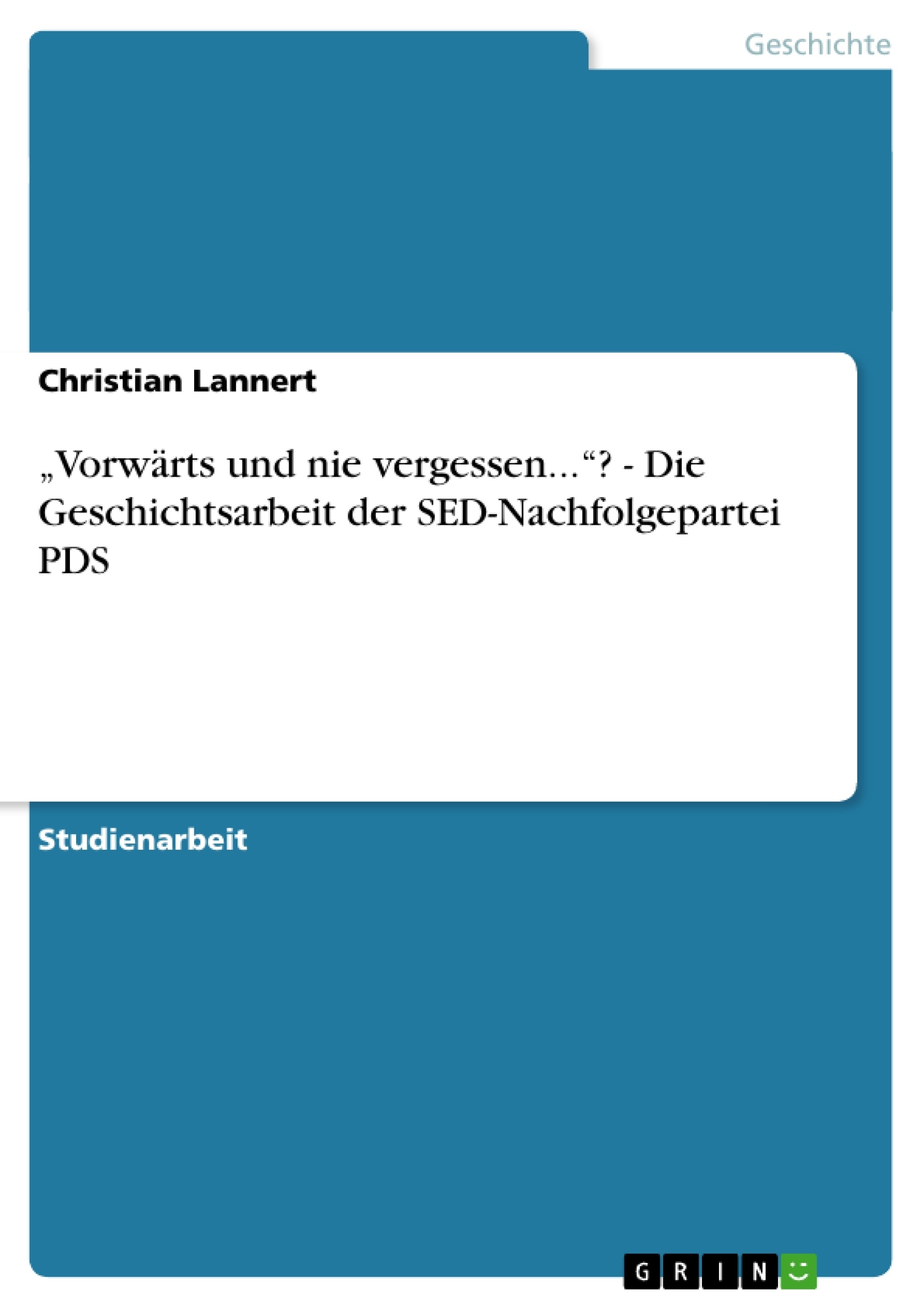Gegenstand vorliegender Hausarbeit ist eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte und umstrittene Organisation: Die „Partei des Demokratischen Sozialismus“ (PDS).1 Als sich die „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands “ (SED) zur Jahreswende 1989/90 unter dem Druck der Öffentlichkeit in SED/PDS und schließlich in PDS umbenannte, war ihr gerade die Allmacht als Staatspartei der abgewirtschafteten DDR abhanden gekommen.2 Gleichsam als „Hypothek der deutschen Wiedervereinigung“3 etablierte sie sich in den darauf folgenden Jahren zu einer unübersehbaren Größe im deutschen Parteienspektrum und ihre hohen Wahlerfolge, die im Osten Deutschlands teilweise die der SPD und CDU übertreffen, scheinen jenen Recht zu geben, die sie als „Volkspartei des Ostens“ bezeichnen. Gleichwohl liefert dieser „Geburtsfehler“4, Erbin der totalitären kommunistischen SED zu sein, Kritikern aller Couleur immer wieder Munition und die Meinungen darüber, wie sie dieses Erbe verwaltet, streuen nicht nur in der Forschung, breit. Diese Arbeit widmet sich der PDS im Hinblick auf ihre Geschichtsarbeit. Sie misst ihre Resultate an den Maßstäben, welche sich die PDS mit ihrer Weigerung, die SED aufzulösen, selbst gesetzt
hat: Den Bruch mit Stalinismus und Diktatur, eine Abkehr vom unmenschlichen
Staatssozialismus der DDR und das beharrliche und aufrichtige Streben, das im Namen der SED begangene Unrecht anzuerkennen, es aufzuarbeiten und schließlich zu überwinden, um demokratische Kraft in einem pluralistischen Rechtsstaat zu sein.5 Gerade wegen ihrer großen Popularität im Osten und der Biographien vieler ihrer Mitglieder, die in den Organisationen des „Arbeiter- und Bauernstaates“ sozialisiert wurden, könnte sie so einen wertvollen Beitrag zur Einheit und zum inneren Frieden des deutschen Volkes leisten. Allerdings kommt man bei genauerer Betrachtung nicht umhin, ihr hierbei beträchtliche Defizite
zu unterstellen, so dass der Schluss zu ziehen ist, dass die geschichtliche Aufarbeitung des DDR-Unrechts durch die PDS im Wesentlichen ihr Ziel verfehlt hat. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Sie sollen im Folgenden, um die These zu erhärten, ebenso untersucht und analysiert werden, wie die gebräuchlichsten Denk- und Argumentationsmuster. Dies bildet den Hauptteil der Untersuchung. Ihm voraus gehen einige Bemerkungen zu den Binnenverhältnissen der PDS und
den Akteuren ihrer Geschichtsarbeit, sowie ein kurzer Überblick über Quellenlage und Forschungsstand.
Gliederung
I. Einleitung
I. 1. Untersuchungsgegenstand und Fragestellung
I. 2. Die PDS – Binnenlandschaft und Akteure der Geschichtsarbeit
I. 3. Quellenlage und Forschungsstand
II. Themen und Muster der PDS Geschichtsarbeit
II. 1. Personalisierung des DDR-Unrechts
II. 2. Zum Werteverständnis der PDS
II. 3. „Welthistorische Niederlage“: Der dialektische Tunnelblick
II. 4. Verklärung des Ursprunges und Brückenschlag zur Nostalgie
II. 5. Auseinandersetzungen um den Mauerbau
II. 6. „Unwiderruflich“? Der Umgang mit dem Stalinismus
II. 7. „Schild und Schwert“ ? Der Umgang mit der Stasi-Vergangenheit
II. 8. „Vereinigungsunrecht“ und „Siegerjustiz“
III. Fazit
IV. Bibliographie und Abkürzungsverzeichnis
IV. 1 Abkürzungsverzeichnis
IV. 2 Quellen
IV. 2. 1 Periodika
IV. 2. 2. Einzelpublikationen
IV. 3. Sekundärliteratur
I. Einleitung
I. 1. Untersuchungsgegenstand und Fragestellung
Gegenstand vorliegender Hausarbeit ist eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte und umstrittene Organisation: Die „Partei des Demokratischen Sozialismus“ (PDS).[1]
Als sich die „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands “ (SED) zur Jahreswende 1989/90 unter dem Druck der Öffentlichkeit in SED/PDS und schließlich in PDS umbenannte, war ihr gerade die Allmacht als Staatspartei der abgewirtschafteten DDR abhanden gekommen.[2] Gleichsam als „ Hypothek der deutschen Wiedervereinigung “[3] etablierte sie sich in den darauf folgenden Jahren zu einer unübersehbaren Größe im deutschen Parteienspektrum und ihre hohen Wahlerfolge, die im Osten Deutschlands teilweise die der SPD und CDU übertreffen, scheinen jenen Recht zu geben, die sie als „Volkspartei des Ostens“ bezeichnen.
Gleichwohl liefert dieser „ Geburtsfehler “[4], Erbin der totalitären kommunistischen SED zu sein, Kritikern aller Couleur immer wieder Munition und die Meinungen darüber, wie sie dieses Erbe verwaltet, streuen nicht nur in der Forschung, breit.
Diese Arbeit widmet sich der PDS im Hinblick auf ihre Geschichtsarbeit. Sie misst ihre Resultate an den Maßstäben, welche sich die PDS mit ihrer Weigerung, die SED aufzulösen, selbst gesetzt hat: Den Bruch mit Stalinismus und Diktatur, eine Abkehr vom unmenschlichen Staatssozialismus der DDR und das beharrliche und aufrichtige Streben, das im Namen der SED begangene Unrecht anzuerkennen, es aufzuarbeiten und schließlich zu überwinden, um demokratische Kraft in einem pluralistischen Rechtsstaat zu sein.[5] Gerade wegen ihrer großen Popularität im Osten und der Biographien vieler ihrer Mitglieder, die in den Organisationen des „Arbeiter- und Bauernstaates“ sozialisiert wurden, könnte sie so einen wertvollen Beitrag zur Einheit und zum inneren Frieden des deutschen Volkes leisten.
Allerdings kommt man bei genauerer Betrachtung nicht umhin, ihr hierbei beträchtliche Defizite zu unterstellen, so dass der Schluss zu ziehen ist, dass die geschichtliche Aufarbeitung des DDR- Unrechts durch die PDS im Wesentlichen ihr Ziel verfehlt hat. Dies hat unterschiedliche Ursachen. Sie sollen im Folgenden, um die These zu erhärten, ebenso untersucht und analysiert werden, wie die gebräuchlichsten Denk- und Argumentationsmuster. Dies bildet den Hauptteil der Untersuchung. Ihm voraus gehen einige Bemerkungen zu den Binnenverhältnissen der PDS und den Akteuren ihrer Geschichtsarbeit, sowie ein kurzer Überblick über Quellenlage und Forschungsstand.
I. 2. Die PDS – Binnenlandschaft und Akteure der Geschichtsarbeit
Nach der Wende konnten die autoritären und selbstherrlichen Mechanismen der Machtausübung durch die SED nicht mehr funktionieren. Die zur PDS umbenannte Partei stand angesichts der politischen Gegebenheiten unter enormen Anpassungsdruck. Sie musste sich unter den veränderten Umständen als eine politische Kraft von vielen im wiedervereinigten Deutschland behaupten. Mehr oder minder unbelastete Köpfe, wie etwa Gregor Gysi[6], Andrè[7] und Michael Brie[8], rückten an die Spitze der von inneren Krisen und drastischen Mitgliederverlusten gebeutelten Partei und bewirkten eine allmähliche Konsolidierung.
Sie verkörperten am ehesten die Abkehr vom dogmatischen Marxismus-Leninismus der alten DDR und traten für einen demokratischen Umbau des Sozialismus ein.[9]
Die FAZ etablierte für diese Denkrichtung innerhalb der Partei Ende 1989 den Ausdruck „Reformer“. Jürgen P. Lang und andere Autoren nutzen ihn als Sammelbegriff jener Kräfte der PDS, die ausgehend von einer fundamentalen Kritik am System der DDR eine Demokratisierung der Partei anstreben. Ihnen gegenüber stehen vielfältige Gruppierungen, die diesem Ziel aus den unterschiedlichsten Gründen kritisch oder ablehnend gegenüberstehen. Lang bezeichnet diese verschiedentlich als „Orthodoxe“.[10]
Charakteristisch für das Innenleben der PDS ist, dass sie sich „ durch einen besonders widersprüchlichen und antagonistischen Pluralismus auszeichnet.“[11] Führende PDS-Politiker sahen dadurch die Handlungsfähigkeit der Partei gefährdet.[12]
Dies führt nicht zuletzt dazu, dass parteioffizielle programmatische Schriften, welche die divergierenden Strömungen zu berücksichtigen haben, in ihren Aussagen für „Reformer“ und „Orthodoxe“ oft gleichermaßen inakzeptabel und für die Außenwirkung wenig positiv sind.
Die PDS misst ihrer Geschichtsarbeit zentrale Bedeutung bei, denn die mentale, personelle und politische Auseinandersetzung mit der Erblast der SED ist für die PDS auch ein dauernder Kampf um Erhalt und Festigung ihrer sozialistischen Identität. Sie benutzt die parteinahe Forschung, um die „globale Delegitimierung der DDR“ und der Biographien ihrer Mitglieder zu verhindern.[13] Geschichtsarbeit sei Voraussetzung und Bedingung „ politischen Wirkens in Gegenwart und Zukunft “. Für die Partei gehe es dabei um die Herstellung der „ ideologischen Hegemonie “.[14] Durch den Rückgriff auf das „ Erbe sozialistischer und kommunistischer, sowie anderer demokratischer Bewegungen und Persönlichkeiten “ soll sich die PDS profilieren und positionieren. Sie betont, dass es keine offizielle Parteigeschichtsschreibung gäbe, warnt aber vor „ Beliebigkeit “ in der Interpretation der Geschichte, da sie in einer besonderen Verantwortung für
das Erbe ihrer Vorgängerorganisationen stehe.[15]
Dementsprechend widersprüchlich sind die unterschiedlichen Publikationen hierzu.[16]
An der Geschichtsarbeit der PDS wirken verschiedene Akteure mit. Die wichtigsten sind die „Historische Kommission der PDS“, die dem Parteivorstand direkt angegliedert ist. Sie entstand am symbolträchtigen 17. Juni 1990 und ist vor allem mit ehemaligen DDR-Historikern besetzt.[17] Ihre Aufgabe ist, wie in einer Erklärung anlässlich des 3. Parteitages vom 18. 1. 1993 beschrieben, „ die Halbheiten und Erbärmlichkeiten “ des sozialistischen Versuchs DDR zu untersuchen.[18] Auf Länderebene existieren zu diesem Zweck parteinahe Bildungsvereine, von denen „Hella Planke“ (Berlin), „Rosa Luxemburg“ (Brandenburg) und „Rosa-Luxemburg-Verein“ (Leipzig) zu den aktivsten gehören.[19]
I. 3. Quellenlage und Forschungsstand
Die PDS und ihre Geschichtsarbeit ist in umfangreichem Maß Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten. Die Urteile der Autoren fallen je nach Provenienz und politischem Hintergrund erwartungsgemäß höchst unterschiedlich aus und sind durchaus nicht frei von Polemik und Subjektivität.[20]
Manfred Gerner hat in einer umfangreichen Studie die Unterschiede zwischen PDS und SED herausgearbeitet.[21] Ähnliche Arbeiten legten auch Patrick Moreau[22] und Heinrich Bordtfeld[23] vor. Diesen Studien ist gemeinsam, dass sie die PDS auf dem Wege in die politische Bedeutungslosigkeit sahen. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet.
Gerade Moreau arbeitete umfangreich zur Geschichte der Partei und ihrer ideologischen Ausrichtung.[24] Jürgen Lang analysierte die programmatischen Auseinandersetzungen innerhalb der PDS und setzte die Positionen von „Reformern“ und „Orthodoxen“ zur Geschichtsarbeit der Partei in Bezug zueinander.[25] Viola Neu bekräftigte in ihrer 2004 erschienenen Untersuchung noch einmal die Behauptung, die Geschichtsarbeit der PDS sei durch Stillstand zu charakterisieren, die von Moreau und Schorpp-Grabiak 2002 formuliert wurde und eine Reihe von Autoren beeinflusst hat.[26]
Als Quellen fließen in diese Hausarbeit verschiedene Texte ein. Zum Einen die programmatischen Schlüsseltexte, wie etwa das Parteiprogramm von 1993[27], zum Anderen die Veröffentlichungen der historischen Gremien der PDS, Stellungnahmen oder Verlautbarungen prominenter PDS- Mitglieder und die Schriften der parteinahen Publizistik.
All diese Texte markieren einen gewissen Konsens innerhalb der Partei, oder teilen zumindest eine gemeinsame Grundlage, welche den Ausgangspunkt für Kontroversen mit anderen Strömungen der Partei bildet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Veröffentlichungen programmatischen und ideologischen Aspekten ebenso verpflichtet sind wie taktischen, da durch sie ein gewünschtes Bild nach Außen und in die Wählerschaft projiziert werden soll.
Die meisten dieser Texte sind über das Onlinearchiv der PDS[28] oder der ihr nahestehenden Organisationen jedermann zugänglich einsehbar. Jedoch waren einige, vor allem ältere Veröffentlichungen, für den Autor nicht erreichbar, weshalb an gekennzeichneten Stellen indirekt zitiert werden muss.[29]
[...]
[1] Seit der Vereinigung mit der WASG am 16. Juni 2007 und der damit verbundenen Neugründung der Partei „Die Linke“, ist die PDS als eigenständige Partei rechtlich nicht mehr existent.
[2] Vgl.: Meining, Stefan, Die leichte Last der Vergangenheit. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte durch die PDS, Onlinefassung des Aufsatzes in: Die PDS. Zustand und Perspektiven, hrsg. von Gerhard Hirscher und Peter Christian Segall, München 2000, S. 139-161, in: URL [http://www.extremismus.com/ texte/pdsddr.htm](22. 6. 2007).
[3] Vgl.: Lang, Jürgen P., Ist die PDS eine demokratische Partei? Eine extremismustheoretische Untersuchung (Extremismus und Demokratie 7), Baden-Baden 2003, S. 15.
[4] Vgl.: Lang, PDS, S. 29.
[5] So heißt es im Programm der Partei von 1993: „ Uns eint das Streben nach einer Welt des Friedens, der Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit und der Demokratie.“ Und weiter: „ Betroffen und nachdenklich angesichts der Irrtümer, Fehler und Verbrechen, die im Namen des Sozialismus begangen wurden, befragen
wir kritisch im Bewusstsein unserer eigenen Verantwortung für die Entstellung der sozialistischen Idee unsere geistige und politische Tradition.“, Programm der Partei des demokratischen Sozialismus, beschlossen von der 1. Tagung des 3. Parteitages der PDS, 29. bis 31. Januar 1993, S. 1-2.
[6] Gregor Gysi (geb. 1948) war von 1989 bis 1993 Parteichef der SED/PDS und später der PDS, von 1990 bis 1998 Vorsitzender der PDS Bundestagsgruppe und ist seit 2005 einer der zwei Fraktionschefs der Linkspartei.
[7] André Brie war von 1990 bis 1999 Leiter des zentralen Wahlbüros der PDS. Daneben war er von 1990 bis 1992 stellvertretender Bundesvorsitzender der PDS. Von seinen Ämtern trat er nach dem Bekanntwerden seiner inoffiziellen Tätigkeit für das MfS zurück. Seit 1999 ist er Mitglied des Europaparlamentes.
[8] Michael Brie (geb. 1954) ist stellvertretender Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung und gilt als einer der Vordenker der PDS.
[9] Vgl.: Lang, PDS, S. 16.
[10] Aus der Sicht der „Reformer“ gestaltet sich der Sozialismus als offenes Projekt, das ständig in Bewegung ist. Anders als die „Orthodoxen“ betrachten sie den Sozialismus nicht als fertiges eschatologisches Staatsprodukt, das dem Kapitalismus grundsätzlich und feindlich gegenübersteht., Vgl.: Lang, PDS, S. 57.
[11] Neugebauer, Gero; Stöss, Richard, Die PDS. Geschichte- Organisation- Wähler- Konkurrenten, Opladen 1996, S. 31.
[12] „Die Pluralisierung der PDS ist bis zu jenem Punkte fortgeschritten, wo sie das notwendige Mindestmaß an Konsistenz und Handlungsfähigkeit in Frage stellt und in eine organisatorische Verbindung völlig disparater Elemente übergeht.“, Brie, Michael, Das politische Projekt PDS – Eine unmögliche Möglichkeit. Die ambivalenten Früchte eines Erfolgs, in: Die PDS. Postkommunistische Kaderorganisation, ostdeutscher Traditionsverein oder linke Volkspartei? Empirische Befunde und kontroverse Analysen, hrsg. von Michael Brie, Martin Herzig und Thomas Koch, Köln 1995, S. 9-39, S. 11.
[13] Die Rede von der Delegitimierung der DDR und ihrer Bürger und Funktionäre ist ein immer wiederkehrender Topos im Sprachgebrauch der PDS. Vgl.: Moreau, Patrick; Schorpp-Grabiak, Rita, „Man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit“- Die PDS: Eine Bilanz (Extremismus und Demokratie 4), Baden-Baden 2002, S. 257.
[14] „ Geschichte wirkt über vielfältige Hinterlassenschaften nachhaltig auf Voraussetzungen und Bedingungen politischen Wirkens in Gegenwart und Zukunft. Das Bild von Geschichte und die Bewertung von Ereignissen, Personen und Prozessen sind Teil der Auseinandersetzung um die geistige Kultur der Gesellschaft und damit um ideologische Hegemonie. “, in: Die weitere Gestaltung der Arbeit der Historischen Kommission beim Parteivorstand. Beschluss des Parteivorstandes vom 2. Juli 2001, in: URL [http://archiv2007.sozialisten.de/partei/parteivorstand/vorstand2000/beschluesse/view_html?zid=12596] (8. 8. 2007).
[15] „ Zur Profilierung der PDS als sozialistische Partei links von der SPD gehört, sich zum Erbe sozialistischer und kommunistischer sowie anderer demokratischer Bewegungen und Persönlichkeiten zu bekennen und zu positionieren. Die erstrebte Öffnung in die Gesellschaft verlangt nach einem entsprechend breiten Erbe- und Traditionsverständnis. Die Fixierung auf ein verbindliches Bild von Geschichte stünde dem entgegen. Vielfalt von Interpretationen kann in einer linken sozialistischen Partei jedoch nicht mit Beliebigkeit gleichgesetzt werden. Die PDS steht in einer besonderen Verantwortung für das Erbe der DDR und der SED, aus der sie vor allem hervorging. Darüber hinaus müssen Erfahrungen und Impulse aus der Entwicklung der Bundesrepublik und Europas erschlossen und aufgenommen werden.“, in:
Die weitere Gestaltung der Arbeit der Historischen Kommission beim Parteivorstand. Beschluss des Parteivorstandes vom 2. Juli 2001.
[16] Vgl.: Thierse, Wolfgang, Die Farbe des Chamäleons, in: Halbherziger Revisionismus. Zum postkommunistischen Geschichtsbild, hrsg. von Rainer Eckert, Bernd Faulenbach, München 1996, S. 291-299, S. 294.
[17] Vgl.: Serèn, Egon, Revisionistische Tendenzen und sinnstiftende Publizistik seit 1989 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Organisation, Meinungen und Struktur, in: In guter Verfassung. Erfurter Berichte zum Verfassungsschutz, hrsg. von Fritz-Achim Baumann, Helmut Rannacher, Helmut Roewer, Erfurt 1997, S. 33-108, S. 64.
[18] PID 3/1993, zitiert nach: Moreau, Patrick; Schorpp-Grabiak, Rita, „Man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit“- Die PDS: Eine Bilanz (Extremismus und Demokratie 4), Baden-Baden 2002, S. 255.
Vgl.: Moreau Patrick, Die Partei des Demokratischen Sozialismus, in: Der Kommunismus in Westeuropa. Niedergang oder Mutation?, hrsg. von Patrick Moreau, Marc Lazar, Gerhard Hirscher, Landsberg/Lech 1998, S. 242-332, S. 288-289.
[19] Vgl.: Moreau; Schorpp-Grabiak, Bilanz, S. 255.
[20] In einigen Fällen sind auch Mängel in der Sorgfalt festzustellen. So werden Zitate aus ihrem Kontext herausgenommen, oder es fehlen Belegstellen. Oft wird vereinfachend von „Der PDS“ gesprochen, was die Binnenlandschaft ausklammert. Dem Ziel, der PDS ungenaue und selektive Geschichtsarbeit nachzuweisen, ist dies wenig förderlich.
[21] Gerner, Manfred, Partei ohne Zukunft? Von der SED zur PDS, München 1994.
[22] Moreau, Patrick, PDS. Anatomie einer postkommunistischen Partei, Bonn, Berlin 1992.
[23] Bordtfeldt, Heinrich, Von der SED zur PDS. Wandlung zur Demokratie? Bonn, Berlin 1992.
[24] Wichtig für diese Arbeit war vor allem folgendes Werk: Moreau, Patrick; Schorpp-Grabiak, Rita, „Man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit“- Die PDS: Eine Bilanz (Extremismus und Demokratie 4), Baden-Baden 2002.
[25] Lang, Jürgen P., Ist die PDS eine demokratische Partei? Eine extremismustheoretische Untersuchung (Extremismus und Demokratie 7), Baden-Baden 2003.
[26] Neu, Viola, Das Janusgesicht der PDS. Wähler zwischen Demokratie und Extremismus (Extremismus und Demokratie 9), Baden-Baden 2004.
Vgl.: Moreau; Schorpp-Grabiak, Bilanz, S. 267.
[27] Die PDS betont, dass alle alten programmatischen Schriften der PDS ihre Gültigkeit behalten und bewahren und gemeinsam die ideologische Grundlage der PDS legen. Vgl.: Moreau; Schorpp-Grabiak, Bilanz, S. 251.
[28] Onlinearchiv der PDS, bzw. „Die Linke.PDS“: URL [http://archiv2007.sozialisten.de] (8.8.2007).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit?
Gegenstand dieser Hausarbeit ist die "Partei des Demokratischen Sozialismus" (PDS), ihre Geschichtsarbeit und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der SED.
Welche Fragestellung verfolgt diese Arbeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die PDS ihrer selbstgesetzten Aufgabe gerecht wird, sich kritisch mit dem Stalinismus und der DDR-Diktatur auseinanderzusetzen und das im Namen der SED begangene Unrecht aufzuarbeiten.
Wer sind die wichtigsten Akteure der Geschichtsarbeit der PDS?
Zu den wichtigsten Akteuren gehören die "Historische Kommission der PDS", die dem Parteivorstand angegliedert ist, sowie parteinahe Bildungsvereine wie "Hella Planke" (Berlin), "Rosa Luxemburg" (Brandenburg) und "Rosa-Luxemburg-Verein" (Leipzig).
Welche Quellen werden in dieser Arbeit verwendet?
Als Quellen dienen programmatische Schlüsseltexte der PDS, Veröffentlichungen der historischen Gremien, Stellungnahmen prominenter PDS-Mitglieder und Schriften der parteinahen Publizistik.
Was ist das Ziel der PDS-Geschichtsarbeit laut dem Text?
Laut dem Text misst die PDS ihrer Geschichtsarbeit zentrale Bedeutung bei, um die "globale Delegitimierung der DDR" und der Biographien ihrer Mitglieder zu verhindern. Sie benutzt die parteinahe Forschung um die "ideologische Hegemonie" herzustellen.
Wie wird die innere Struktur der PDS beschrieben?
Die PDS wird als Partei beschrieben, die sich durch einen widersprüchlichen Pluralismus auszeichnet, mit divergierenden Strömungen von "Reformern" und "Orthodoxen".
Wie wird die Bedeutung der Geschichtsarbeit für die PDS eingeschätzt?
Die Geschichtsarbeit wird als zentraler Kampf um Erhalt und Festigung der sozialistischen Identität der PDS betrachtet. Sie soll zur Profilierung und Positionierung der Partei beitragen, wobei betont wird, dass es keine offizielle Parteigeschichtsschreibung gibt, aber Beliebigkeit vermieden werden soll.
- Quote paper
- Christian Lannert (Author), 2007, „Vorwärts und nie vergessen...“? - Die Geschichtsarbeit der SED-Nachfolgepartei PDS , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115132