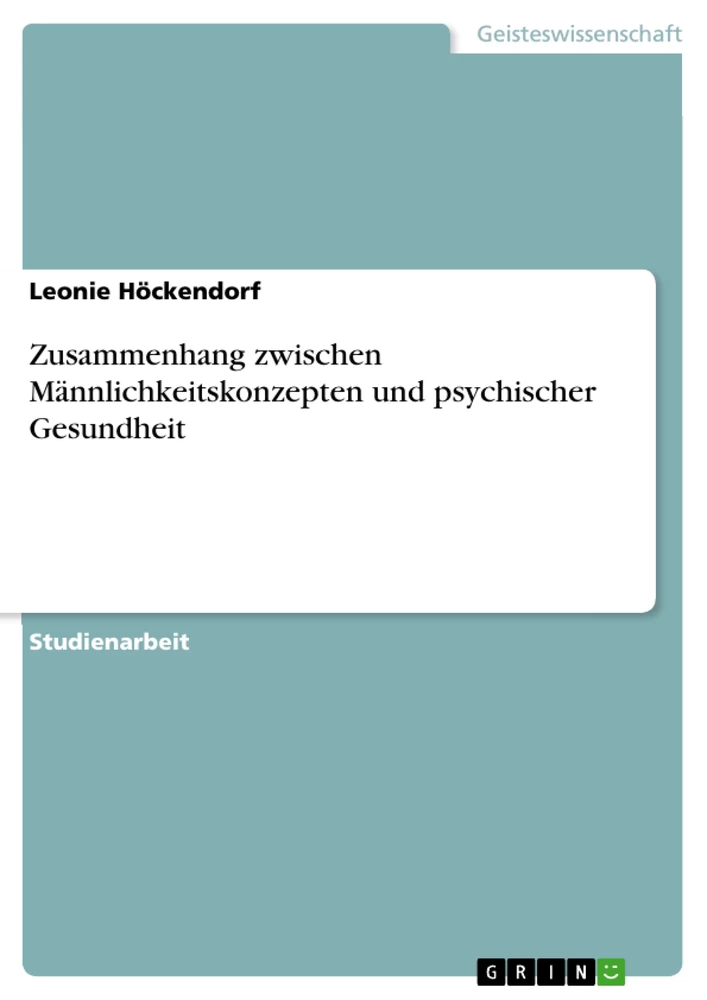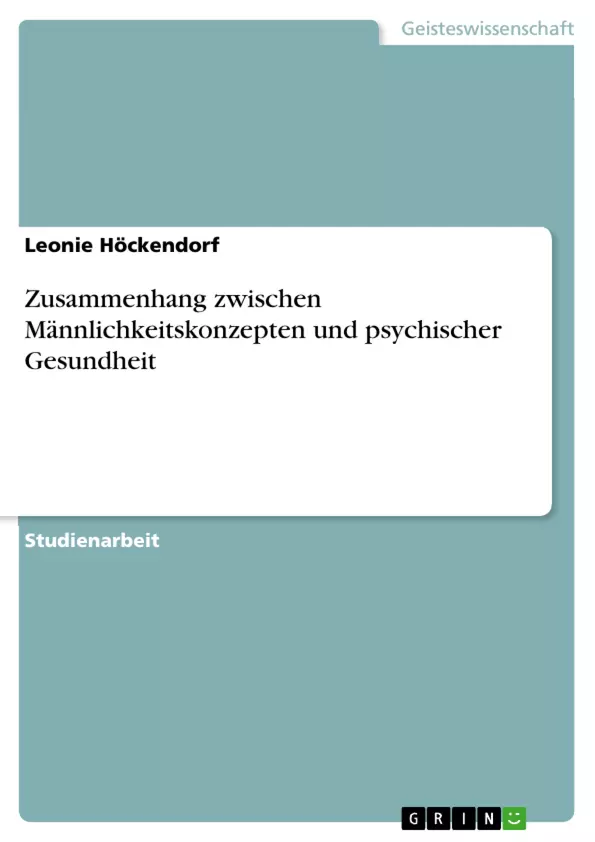Die vorliegende Arbeit erläutert kurz folgende Thesen:
1. Gängige Männlichkeitskonzepte machen Männer psychisch krank.
2. Männer sind nicht resilienter als Frauen.
3. Die Profession der Sozialarbeiter*innen hat einen Handlungsbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Thesenpapier
- Erläuterte Thesen
- Fragebogen
- Hintergrund
- Auswertung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von traditionellen Männlichkeitskonzepten auf die psychische Gesundheit von Männern. Sie stellt die These auf, dass gängige Männlichkeitsbilder Männer psychisch krank machen, indem sie emotionale Ausdrucksfähigkeit einschränken und ein Gefühl der „Entmännlichung“ bei Nichteinhaltung von Leistungsnormen erzeugen.
- Psychische Auswirkungen traditioneller Männlichkeitskonzepte
- Resilienz und Hilfesuchverhalten von Männern
- Handlungsmöglichkeiten für Sozialarbeiter*innen
- Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen bei Männern
- Emotionale Hemmung und die Folgen für die psychische Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thesenpapier
Dieses Kapitel stellt die drei zentralen Thesen der Arbeit vor: 1) Gängige Männlichkeitskonzepte machen Männer psychisch krank, indem sie emotionale Ausdrucksfähigkeit einschränken und Leistungsdruck erzeugen. 2) Männer sind nicht resilienter als Frauen, sondern neigen eher dazu, ihre psychischen Probleme zu ignorieren und mit destruktiven Verhaltensweisen zu kompensieren. 3) Sozialarbeiter*innen haben einen Handlungsbedarf, um binäre Geschlechterrollen zu dekonstruieren und Kindern und Jugendlichen alternative Modelle zu vermitteln.
2. Erläuterte Thesen
In diesem Kapitel werden die drei Thesen anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und empirischer Daten aus Fragebögen und Studien genauer erläutert.
3. Fazit
Das Kapitel „Fazit“ wird in dieser Vorschau nicht behandelt, um keine Spoiler zu verraten.
4. Fragebogen
Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und Ergebnisse eines Fragebogens, der im Rahmen der Arbeit erstellt und an cis-männlichen Bekannten der Autorin ausgegeben wurde. Der Fokus lag dabei auf der Erfassung der Erfahrungen von Männern im Umgang mit Emotionen und gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Männlichkeitskonzepte, psychische Gesundheit, Emotionale Hemmung, Resilienz, Hilfesuchverhalten, Sozialarbeit, Genderrollen, Stereotype, Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, Selbstwahrnehmung, Geschlechterrollen und toxische Männlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Machen traditionelle Männlichkeitskonzepte krank?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Leistungsdruck und die Unterdrückung von Emotionen negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Männern haben.
Sind Männer resilienter als Frauen?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass Männer psychische Probleme oft nur besser ignorieren oder durch destruktives Verhalten kompensieren, statt Hilfe zu suchen.
Was ist emotionale Hemmung bei Männern?
Es beschreibt die Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Gefühle auszudrücken, was oft auf gesellschaftliche Erwartungen an "Männlichkeit" zurückzuführen ist.
Wie können Sozialarbeiter Männer unterstützen?
Soziale Arbeit sollte binäre Geschlechterrollen dekonstruieren und alternative Modelle vermitteln, die einen gesunden Umgang mit Emotionen erlauben.
Warum suchen Männer seltener psychologische Hilfe?
Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen als "Schwäche" steht oft im Widerspruch zum männlichen Selbstbild von Stärke und Autonomie.
- Arbeit zitieren
- Leonie Höckendorf (Autor:in), 2021, Zusammenhang zwischen Männlichkeitskonzepten und psychischer Gesundheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151204