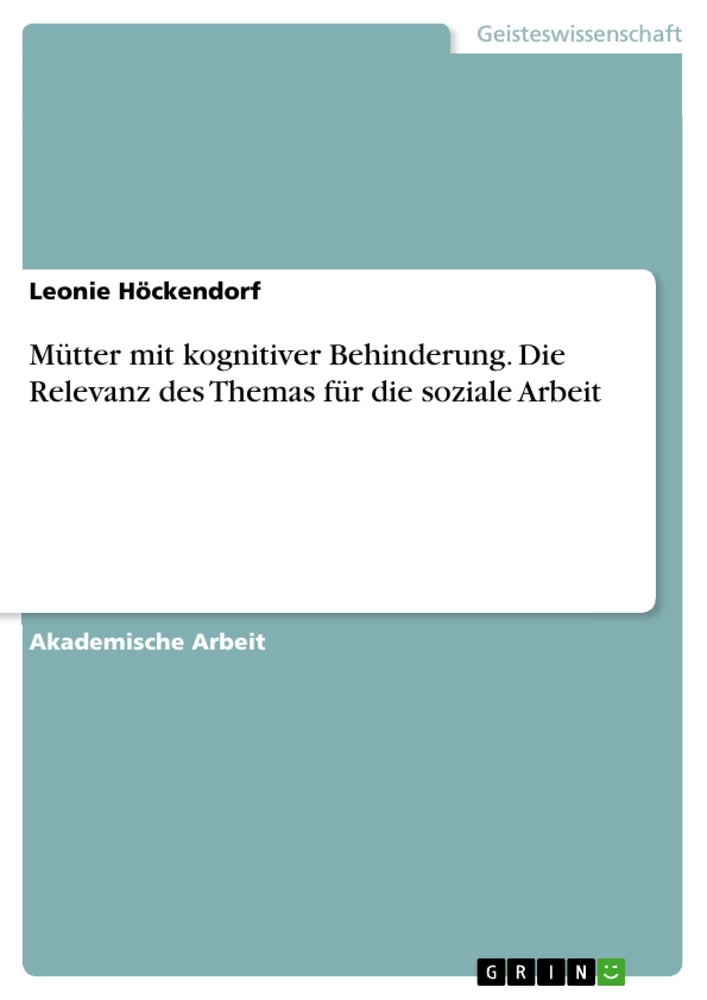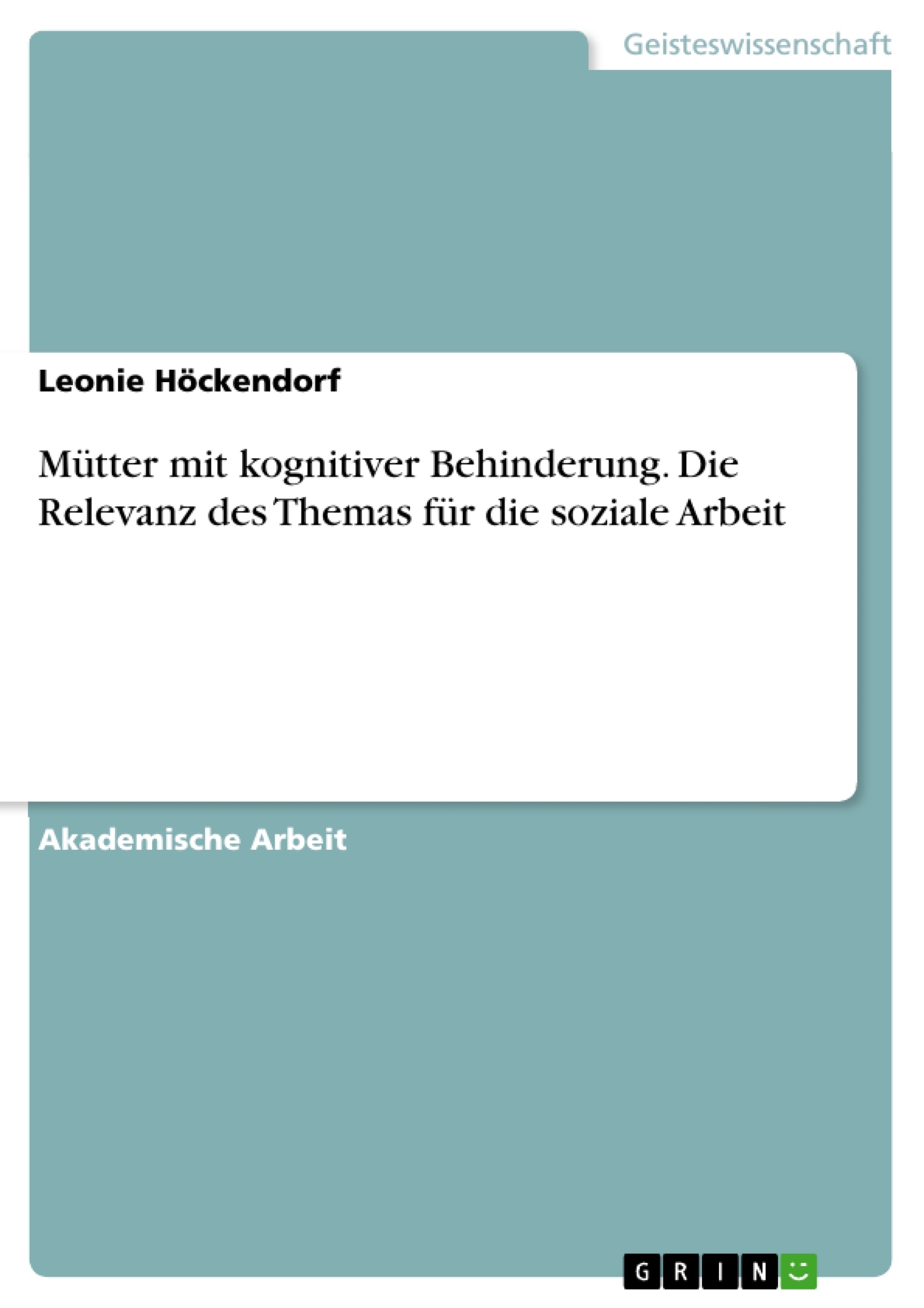In meiner Arbeit wird es darum gehen, welche Lebensgestaltungsmöglichkeiten es für Mütter mit Behinderung derzeit in Deutschland gibt und wie sich daraus eine Relevanz für unserer Arbeit als Sozialarbeiter*innen ergibt.
Dabei gehe ich insbesondere auf Frauen mit kognitiver Behinderung ein, da Frauen mit körperlichen Behinderungen ganz andere Lebenswirklichkeiten und Anforderungen an die Gesamtgesellschaft als Frauen mit kognitiver Behinderung haben.
Viele Kommilitonen, die ich dazu befragte, sind noch nie einer Mutter mit kognitiver Behinderung begegnet, da dieses Thema noch wenig in Arbeitskontexten besprochen wird. Auch ich habe zu dem Thema bisher wenig Berührungspunkte. Nun könnte man annehmen, dass es sich hierbei um ein irrelevantes Nischenthema handeln könnte, jedoch könnte dies ein Trugschluss sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition
- 3 Geschichtlicher Hintergrund
- 4 Derzeitige Hilfen
- 5 Thesen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebensgestaltungsmöglichkeiten von Müttern mit kognitiver Behinderung in Deutschland und die daraus resultierende Relevanz für die soziale Arbeit. Der Fokus liegt auf Frauen mit kognitiver, nicht körperlicher Behinderung, da diese unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Anforderungen mit sich bringen. Die Arbeit beleuchtet den bisherigen Forschungsstand und die aktuellen Hilfesysteme.
- Lebensrealitäten von Müttern mit kognitiver Behinderung in Deutschland
- Vorherrschende gesellschaftliche Stigmatisierungen und Barrieren
- Aktuelle Unterstützungssysteme und deren Wirksamkeit
- Die Rolle der sozialen Arbeit in der Begleitung und Unterstützung
- Vielfalt der Beweggründe für den Kinderwunsch bei Frauen mit kognitiver Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungslücke bezüglich der Lebensgestaltung von Müttern mit kognitiver Behinderung und deren Relevanz für die soziale Arbeit. Die Autorin betont die Notwendigkeit, dieses Thema stärker in den Fokus zu rücken, da es in Arbeitskontexten bisher wenig Beachtung findet.
2 Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der kognitiven Behinderung, indem es auf die Defizite in der Intelligenz und der sozialen Kompetenz eingeht. Es wird betont, dass der Grad der Abhängigkeit von Hilfestellungen je nach Ausprägung der Behinderung variiert und dass Behinderung auch ein sozial konstruiertes Phänomen ist, abhängig von der Inklusion der Gesellschaft.
3 Geschichtlicher Hintergrund: Der historische Kontext beleuchtet die früheren Einstellungen gegenüber Behinderung und Elternschaft. Es werden frühe Publikationen erwähnt, die das Thema Behinderung und romantische Liebe diskutierten, aber Elternschaft ausließen. Der Abschnitt thematisiert die problematische Geschichte von Zwangssterilisationen und hebt die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Elternschaft hervor. Die Gründung des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern im Jahr 1999 wird als wichtiger Schritt in der Selbsthilfebewegung erwähnt.
4 Derzeitige Hilfen: Dieses Kapitel beschreibt die drei wichtigsten Unterstützungsformen für Mütter mit Behinderung in Deutschland: Elternassistenz, begleitete Elternschaft und Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern. Die Unterschiede in Bezug auf Intensität der Betreuung und Selbstbestimmung werden erläutert.
5 Thesen: Dieses Kapitel präsentiert drei Thesen. Die erste These besagt, dass Frauen mit kognitiver Behinderung aus verschiedenen Gründen einen Kinderwunsch haben können, z.B. als Weg zur Erwachsenwerdung, zur Ablösung von den eigenen Eltern oder als Versuch, gesellschaftliche Normen zu erfüllen. Die zweite These befasst sich mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Müttern mit Behinderung und dem mangelnden Vertrauen in deren Mutterqualitäten. Die Autorin kritisiert dabei die oft vereinfachte und klischeehafte Darstellung von Frauen mit Behinderung in der Literatur.
Schlüsselwörter
Kognitive Behinderung, Mütter, soziale Arbeit, Inklusion, Stigmatisierung, Elternschaft, Hilfesysteme, gesellschaftliche Teilhabe, UN-Behindertenrechtskonvention, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lebensgestaltung von Müttern mit kognitiver Behinderung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Lebensgestaltung von Müttern mit kognitiver Behinderung in Deutschland und die Bedeutung dieses Themas für die Soziale Arbeit. Der Fokus liegt auf Frauen mit kognitiver, nicht körperlicher Behinderung und beleuchtet den Forschungsstand sowie aktuelle Hilfesysteme.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Lebensrealitäten von Müttern mit kognitiver Behinderung, gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Barrieren, aktuellen Unterstützungssystemen und deren Wirksamkeit, der Rolle der Sozialen Arbeit und der Vielfalt der Beweggründe für den Kinderwunsch dieser Frauen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Begriffsdefinition, einen geschichtlichen Hintergrund, einen Überblick über derzeitige Hilfen, die Präsentation von Thesen und ein Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie wird der Begriff „kognitive Behinderung“ definiert?
Der Begriff „kognitive Behinderung“ wird definiert als Defizite in der Intelligenz und sozialen Kompetenz. Es wird betont, dass der Grad der Abhängigkeit von Hilfestellungen variiert und dass Behinderung auch ein sozial konstruiertes Phänomen ist.
Welchen geschichtlichen Hintergrund beleuchtet die Arbeit?
Der historische Teil behandelt frühere Einstellungen gegenüber Behinderung und Elternschaft, frühe Publikationen zum Thema, die problematische Geschichte von Zwangssterilisationen und die Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Elternschaft. Die Gründung des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern wird als wichtiger Schritt erwähnt.
Welche Hilfesysteme werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt drei wichtige Unterstützungsformen: Elternassistenz, begleitete Elternschaft und Leistungen aus den Sozialgesetzbüchern. Die Unterschiede in Bezug auf Intensität und Selbstbestimmung werden erläutert.
Welche Thesen werden aufgestellt?
Die Arbeit präsentiert drei Thesen: 1. Frauen mit kognitiver Behinderung haben aus verschiedenen Gründen einen Kinderwunsch (z.B. Erwachsenwerdung, Ablösung von den Eltern, gesellschaftliche Normen). 2. Mütter mit Behinderung erfahren gesellschaftliche Stigmatisierung und mangelndes Vertrauen in ihre Mutterqualitäten. 3. (Die dritte These ist im vorliegenden Auszug nicht vollständig wiedergegeben).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kognitive Behinderung, Mütter, soziale Arbeit, Inklusion, Stigmatisierung, Elternschaft, Hilfesysteme, gesellschaftliche Teilhabe, UN-Behindertenrechtskonvention, Selbstbestimmung.
Welche Forschungslücke wird adressiert?
Die Arbeit adressiert die Forschungslücke bezüglich der Lebensgestaltung von Müttern mit kognitiver Behinderung und deren Relevanz für die soziale Arbeit, da dieses Thema in Arbeitskontexten bisher wenig Beachtung findet.
- Quote paper
- Leonie Höckendorf (Author), 2020, Mütter mit kognitiver Behinderung. Die Relevanz des Themas für die soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151196