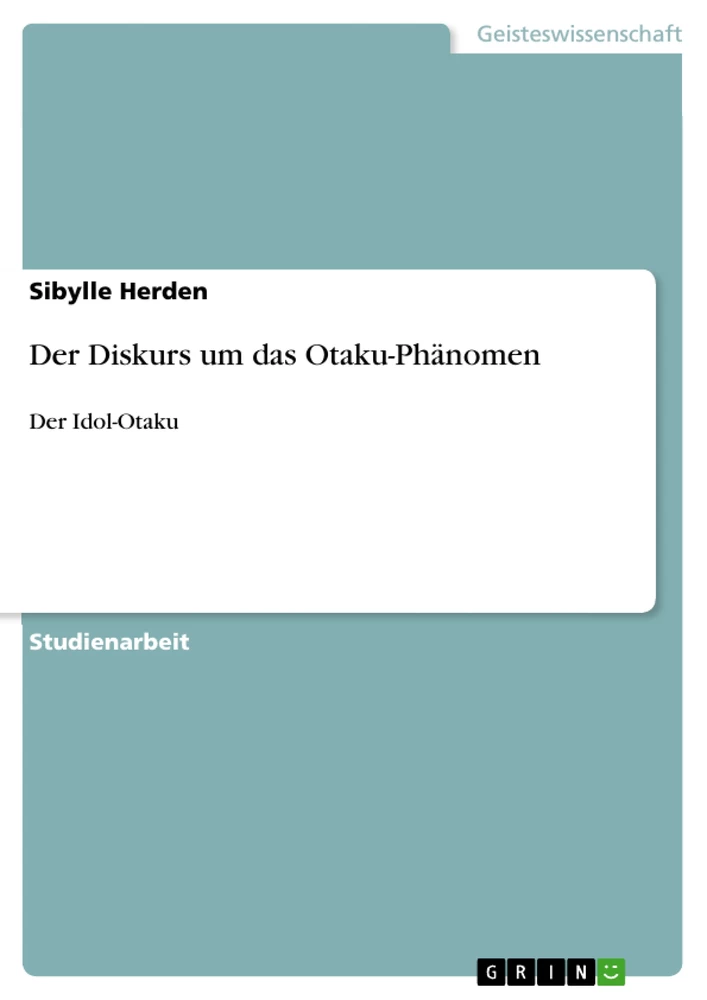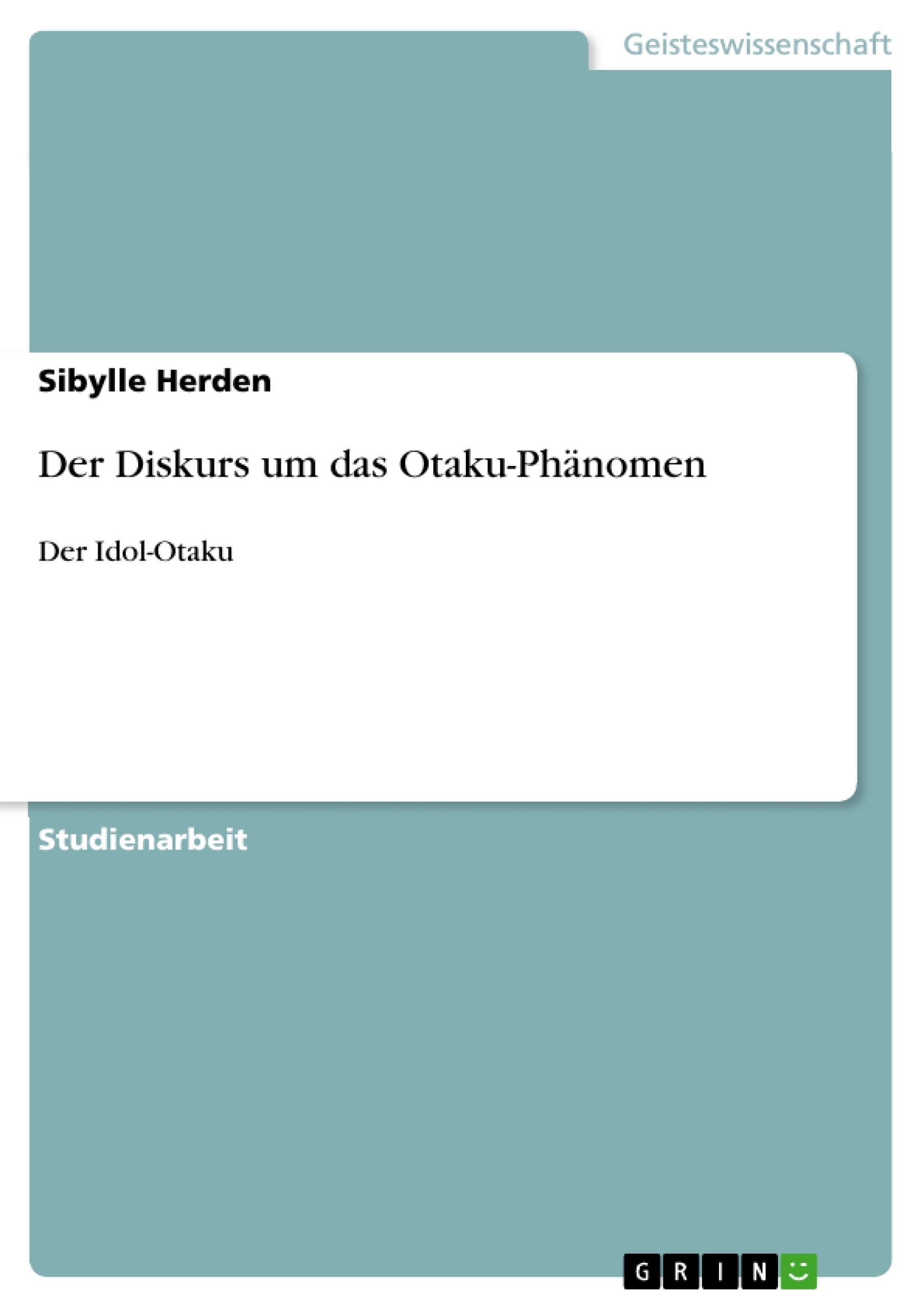Produkte der japanischen Massenkultur prägen das gegenwärtige Japan und erfahren auch im Ausland stetig wachsendes Interesse. Manga (漫画), Anime (アニメ) und japanische Videospiele gehören auch bei uns beinahe wie selbstverständlich zur Jugendkultur. Dabei sind sie nur ein Teil der eigentlichen japanischen Populärkultur. Diese ist gekennzeichnet durch vielfältige Ausprägungen und eine hohe Diversität. Vor allem im Bereich der Musikindustrie ist diese zurück zu finden. Teenie- Sänger und Sängerinnen aus der Retorte prägen das Bild der Musiklandschaft und bieten für jeden Geschmack eine entsprechende Indentifikationsmöglichkeit. In einer derart pluralisierten Populärkultur, die bestimmt wird durch die Konsum und Informationsgesellschaft, finden sich jedoch auch innerhalb der Konsumenten stark divergierende Ausprägungen. Während die einen lediglich konsumieren und Teile der Jugendkultur in ihr Leben integrieren, richten andere ihr Leben ausschließlich auf ihre favorisierte Kategorie der Jugendkultur. Durch ihre Lebensweise distanzieren sie sich von ihren Altersgenossen, ihrem sozialen Umfeld und anderen für sie uninteressanten Kulturgütern.
Dieses Phänomen der japanischen Otakus wurde zu Beginn der 1980er Jahre zum ersten Mal publik und ist heute eines der meist diskutierten Themen im zeitgenössischen Japan. Dabei ergeben sich spezielle Ausprägungen wie etwa den Idol- Otaku (アイドルお宅), der seine Leidenschaft allein auf die schon erwähnten Pop- Sänger und Sängerinnen richtet. Doch was fasziniert beispielsweise den Idol- Otaku an Pop- Sängerinnen, die in der Regel nach einem einzigen Titel wieder vom Markt verschwinden? Was empfinden Otaku, wenn sie auf der Foto- Jagd nach ihren Idolen sind? Was charakterisiert den Otaku neben seiner Leidenschaft und welche gesellschaftliche und soziale Position nimmt er ein? Diese Arbeit widmet sich anhand dieser Fragen dem Diskurs über das Otaku- Phänomen. Dazu muss zunächst eine Begriffsbestimmung erfolgen, um den Terminus Otaku abzugrenzen und für diese Arbeit verfügbar zu machen. Danach wird das Massenphänomen innerhalb der japanischen Gesellschaft eingeordnet und vorgestellt, bevor die Position der japanischen Regierung berücksichtigt wird. Hauptteil dieser Arbeit bildet die Betrachtung des Idol- Otakus anhand der genannten Fragestellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Otaku: Das erwachsene Kind?
- Der Begriff Otaku
- Das Massenphänomen Otaku
- Die Attraktivität des Otakus als Soft Power-Konzept
- Idol-Faszination an synthetischen Stars
- Hamasaki Ayumi, Utada Hikaru, Morning Musume und Co.
- Idolemania – Der obszöne Blick
- Fazit
- Lektüreverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Otaku-Phänomen in Japan, insbesondere den Idol-Otaku. Die Arbeit zielt darauf ab, den Begriff „Otaku“ zu definieren, das Massenphänomen innerhalb der japanischen Gesellschaft einzuordnen und die Faszination des Idol-Otakus für synthetische Popstars zu analysieren. Die gesellschaftliche und soziale Position des Otakus wird ebenfalls beleuchtet.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Begriffs „Otaku“
- Das Massenphänomen Otaku und seine gesellschaftliche Einordnung
- Die Faszination des Idol-Otakus für Popstars
- Soziale und gesellschaftliche Position des Otakus
- Die Rolle der Medien im Kontext des Otaku-Phänomens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Otaku-Phänomens ein und beschreibt die wachsende Bedeutung der japanischen Populärkultur weltweit. Sie hebt die Diversität dieser Kultur hervor und fokussiert auf die stark divergierenden Konsumformen, die von reinem Konsum bis hin zur umfassenden Lebensweise reichen, die durch den Otaku repräsentiert wird. Die Arbeit kündigt die zentrale Fragestellung nach der Faszination des Idol-Otakus an und skizziert den methodischen Ablauf der Untersuchung.
Otaku: Das erwachsene Kind?: Dieses Kapitel beschäftigt sich umfassend mit dem Begriff „Otaku“. Es beleuchtet die Entstehung des Begriffs in den 1980er Jahren im Kontext des „Yamato“-Booms und analysiert dessen semantische Entwicklung von einer neutralen Bezeichnung für Fans zu einem oft negativ konnotierten Begriff. Die Arbeit beschreibt das charakteristische Verhalten von Otaku, ihren Rückzug aus der Gesellschaft und ihre intensive Beschäftigung mit Nischen der Populärkultur. Der soziale Ausschluss und der Widerspruch zur japanischen Gesellschaftsstruktur werden ebenfalls thematisiert, wobei die Bedeutung von Harmonie und Gruppenzusammengehörigkeit im japanischen Kontext herausgestellt wird.
Idol-Faszination an synthetischen Stars: Dieses Kapitel würde sich mit der Faszination des Idol-Otakus für Popstars befassen, indem es die spezifischen Aspekte dieser Beziehung untersucht. Es würde die Charakteristika der Idol-Kultur analysieren und die Gründe für die intensive Anhängerschaft ergründen. Die Rolle der Medien, die Mechanismen der Identifikation und die gesellschaftlichen Implikationen wären zentrale Themen. Der Bezug zu den vorherigen Kapiteln würde hergestellt, indem gezeigt wird, wie die Idol-Beziehung die Charakteristika des Otaku-Verhaltens verdeutlicht und erweitert.
Schlüsselwörter
Otaku, Idol, japanische Populärkultur, Massenphänomen, Jugendkultur, Gesellschaft, Medien, Fan-Kultur, Identifikation, Soft Power, Harmonie, soziale Isolation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Otaku: Das erwachsene Kind?"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Otaku-Phänomen in Japan, mit besonderem Fokus auf den Idol-Otaku und deren Faszination für synthetische Popstars. Es werden der Begriff "Otaku", dessen gesellschaftliche Einordnung und die soziale Position der Otaku analysiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung und Abgrenzung von "Otaku", das Massenphänomen Otaku und dessen gesellschaftliche Einordnung, die Faszination des Idol-Otakus für Popstars, die soziale und gesellschaftliche Position der Otaku und die Rolle der Medien im Kontext des Otaku-Phänomens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu "Otaku: Das erwachsene Kind?", welches die Entstehung und semantische Entwicklung des Begriffs "Otaku" beleuchtet, ein Kapitel zur "Idol-Faszination an synthetischen Stars", welches die Beziehung zwischen Idol-Otaku und Popstars untersucht, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Wie wird der Begriff "Otaku" definiert?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Begriffs "Otaku" von einer neutralen Bezeichnung für Fans hin zu einem oft negativ konnotierten Begriff. Sie beschreibt das charakteristische Verhalten von Otaku, ihren Rückzug aus der Gesellschaft und ihre intensive Beschäftigung mit Nischen der Populärkultur.
Welche Rolle spielen die Medien im Kontext des Otaku-Phänomens?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Medien sowohl im Aufbau der Idol-Kultur als auch im Kontext der allgemeinen Otaku-Kultur. Die Mechanismen der Identifikation und die gesellschaftlichen Implikationen werden thematisiert.
Wie wird die Faszination des Idol-Otakus für Popstars erklärt?
Das Kapitel zur Idol-Faszination analysiert die spezifischen Aspekte der Beziehung zwischen Idol-Otaku und Popstars. Es untersucht die Charakteristika der Idol-Kultur und die Gründe für die intensive Anhängerschaft.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die soziale und gesellschaftliche Position der Otaku, den sozialen Ausschluss und den Widerspruch zur japanischen Gesellschaftsstruktur mit ihrem Fokus auf Harmonie und Gruppenzusammengehörigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Otaku, Idol, japanische Populärkultur, Massenphänomen, Jugendkultur, Gesellschaft, Medien, Fan-Kultur, Identifikation, Soft Power, Harmonie und soziale Isolation.
- Quote paper
- Sibylle Herden (Author), 2008, Der Diskurs um das Otaku-Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115115