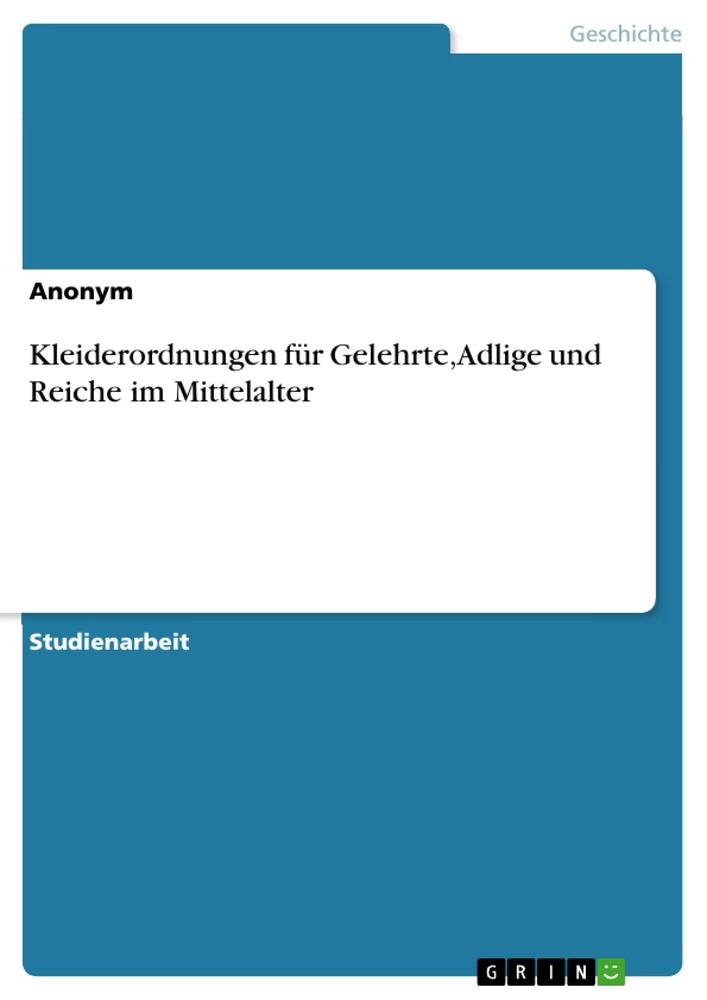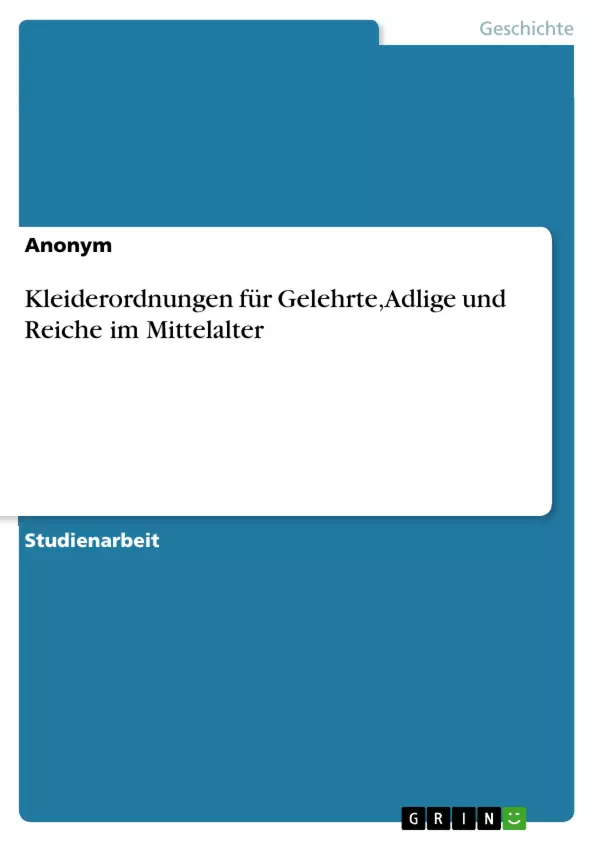Kleiderordnungen können eine „symbolisch repräsentative“ Gruppenzugehörigkeit signalisieren und somit bereits optisch die Zugehörigkeit zu bestimmten Ständen anzeigen. Auch im Mittelalter wurden Kleider als Repräsentationsform genutzt, unter anderen für die Gelehrten. So wurden sie zum Beispiel erst durch das Anlegen bestimmter Kleidung oder Kleidungselemente “gesellschaftsfähig”. Zu den Gelehrten des Mittelalters zählten beispielhaft Professoren, Lehrer, Juristen, Theologen oder Mediziner (oder Kleriker). Adlige gehörten wiederum einem eigenen Stand an und hatten nicht die gleichen Vorschriften wie die Gelehrten, was sich auch in der spezifischen Kleiderordnung des Adels spiegelte. Man ordnete sich also mittels festgelegter Kleidungsstücke einer Gruppe zu, war damit ein Teil dieser Gruppe und hob sich somit gleichermaßen von anderen ab. Die Kleidung diente jedoch nicht nur der äußerlichen Repräsentation, sie stiftete auch Identität, schaffte Werte und war Träger dieser Werte. Es konnten einzelne Kleidungsbestandteile sein, die repräsentativ für die Gelehrten standen, es konnten aber auch ganze Kleidungskombinationen sein.
Es stellt sich nun die Frage, welche Merkmale die Kleidungsstücke der Gelehrtenkleidung hatten? Gab es bestimmte Verzierungen, Aufsätze, Farben oder Zuschnitte, die eine Person zu einer bestimmten Gruppe zugehörig machten? Um dies zu erfahren, muss man Bildquellen und auch schriftliche Quellen analysieren und vergleichen. Eine der wichtigsten schriftlichen Quellen für Gelehrtenkleidung aus dem Mittelalter sind die Statuten der Universitäten. Wenn es Vorschriften für die Gewänder der Gelehrten gab, dann wurden sie in diesen Statuten dargelegt. Merkmale wie Gewandlänge, Farbe, Schnitt, Anlässe, zu denen die Kleidung getragen werden durfte, sowie die Personen, denen es erlaubt war, sie zu tragen .
Im weiteren Verlauf werde ich näher auf die Modeerscheinungen der Adligen und die charakteristische Kleidung der Gelehrten aus dem Mittelalter eingehen. Dabei werde ich Bild- wie auch Textquellen analysieren und aus deren Erkenntnissen Schlüsse über die typischen Kleidungsstile aus dem Mittelalter gewinnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kleiderordnungen für Gelehrte
- 3. Kleiderordnungen für Adlige und Reiche
- 3.1. Venedig
- 3.2. Mittel- und Oberdeutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kleiderordnungen des Mittelalters, indem sie die Vorschriften für Gelehrte und den Adel in Venedig und Deutschland vergleicht. Das Ziel ist es, durch die Analyse von Bild- und Textquellen Erkenntnisse über die Bedeutung von Kleidung als Statussymbol und Gruppenzugehörigkeit im Mittelalter zu gewinnen.
- Kleiderordnungen als Indikatoren sozialer Zugehörigkeit
- Spezifische Merkmale der Gelehrtenkleidung
- Luxus und Kleiderordnungen im venezianischen Adel
- Vergleich der Kleiderordnungen zwischen Deutschland und Venedig
- Die Rolle von Bild- und Schriftquellen in der historischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kleiderordnungen im Mittelalter ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Kleidervorschriften für Gelehrte sowie den Adel in Venedig und Deutschland. Sie betont die Bedeutung Venedigs als Modemetropole und die Absicht, die Kleidungsstile beider Regionen zu vergleichen.
2. Kleiderordnungen für Gelehrte: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Merkmale der Gelehrtenkleidung zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Es analysiert Bildquellen, wie die Darstellung Kaiser Justinians umgeben von Juristen, um typische Kleidungsmerkmale wie bodenlange Obergewänder, Pelzbesätze und Kopfbedeckungen zu identifizieren. Die Bedeutung von Statuten der Universitäten als schriftliche Quellen wird hervorgehoben, welche Vorschriften zu Schnitt, Farbe und Anlässen für das Tragen bestimmter Gewänder enthielten. Der Vergleich zwischen Bild- und Schriftquellen zeigt Abweichungen und interpretiert die Bedeutung von Statussymbolen wie Pelzverzierungen und Kopfbedeckungen, die nicht explizit in den Statuten erwähnt werden. Die Einheitlichkeit der Gelehrtenkleidung in weiten Teilen Europas wird thematisiert und im Kontext des "akademischen Grades" des Gelehrten interpretiert.
3. Kleiderordnungen für Adlige und Reiche: Kapitel 3 beginnt mit der Darstellung Venedigs als Modemetropole des Spätmittelalters, geprägt vom Import luxuriöser Stoffe. Es analysiert päpstliche Verordnungen, die den Luxus im Kleidungsstil einzuschränken versuchten. Die Verordnungen, die vor allem Frauen zunächst betrafen und später auf Männer und Kinder ausgedehnt wurden, geben Einblicke in die extravagante Mode dieser Zeit, wie z.B. Plateauschuhe mit ungewöhnlich hohen Absätzen. Der Widerstand einzelner Frauen gegen diese Verbote und ihre Bereitschaft, Strafen in Kauf zu nehmen, wird hervorgehoben, um den Wert des luxuriösen Kleiderstils in Venedig zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Kleiderordnungen, Mittelalter, Gelehrtenkleidung, Adel, Venedig, Deutschland, Statussymbole, Gruppenzugehörigkeit, Bildquellen, Schriftquellen, Luxus, Mode, päpstliche Verordnungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Kleiderordnungen im Mittelalter
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Kleiderordnungen im Mittelalter. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der Kleiderordnungen für Gelehrte und den Adel in Venedig und Deutschland.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht Kleiderordnungen als Indikatoren sozialer Zugehörigkeit, analysiert die spezifischen Merkmale der Gelehrtenkleidung, beleuchtet den Luxus und die Kleiderordnungen im venezianischen Adel, vergleicht die Kleiderordnungen zwischen Deutschland und Venedig und diskutiert die Rolle von Bild- und Schriftquellen in der historischen Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 behandelt die Kleiderordnungen für Gelehrte, analysiert Bild- und Schriftquellen und interpretiert die Bedeutung von Statussymbolen in der Gelehrtenkleidung. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Kleiderordnungen des Adels und der Reichen, insbesondere in Venedig, und untersucht päpstliche Verordnungen zur Regulierung von Luxuskleidung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Kombination aus Bildquellen (z.B. Darstellungen Kaiser Justinians) und Schriftquellen (z.B. Universitätsstatuten, päpstliche Verordnungen). Der Vergleich beider Quellenarten spielt eine zentrale Rolle in der Analyse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, durch die Analyse von Bild- und Textquellen Erkenntnisse über die Bedeutung von Kleidung als Statussymbol und Gruppenzugehörigkeit im Mittelalter zu gewinnen und dies anhand eines Vergleichs zwischen Gelehrten und Adel in Venedig und Deutschland zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Kleiderordnungen, Mittelalter, Gelehrtenkleidung, Adel, Venedig, Deutschland, Statussymbole, Gruppenzugehörigkeit, Bildquellen, Schriftquellen, Luxus, Mode, päpstliche Verordnungen.
Welche Rolle spielt Venedig in der Arbeit?
Venedig wird als bedeutende Modemetropole des Spätmittelalters dargestellt. Die Arbeit analysiert den venezianischen Adel und dessen luxuriöse Kleidung, inklusive päpstlicher Versuche, diesen Luxus einzuschränken. Der Vergleich mit Deutschland bildet einen zentralen Aspekt der Arbeit.
Wie werden Bild- und Schriftquellen in der Arbeit verwendet?
Bild- und Schriftquellen werden verglichen, um ein umfassendes Bild der Kleiderordnungen zu erhalten. Die Arbeit analysiert, wie diese Quellen einander ergänzen und inwiefern sie unterschiedliche Aspekte der Kleidung und ihrer Bedeutung aufzeigen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Kleiderordnungen für Gelehrte, Adlige und Reiche im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1151016