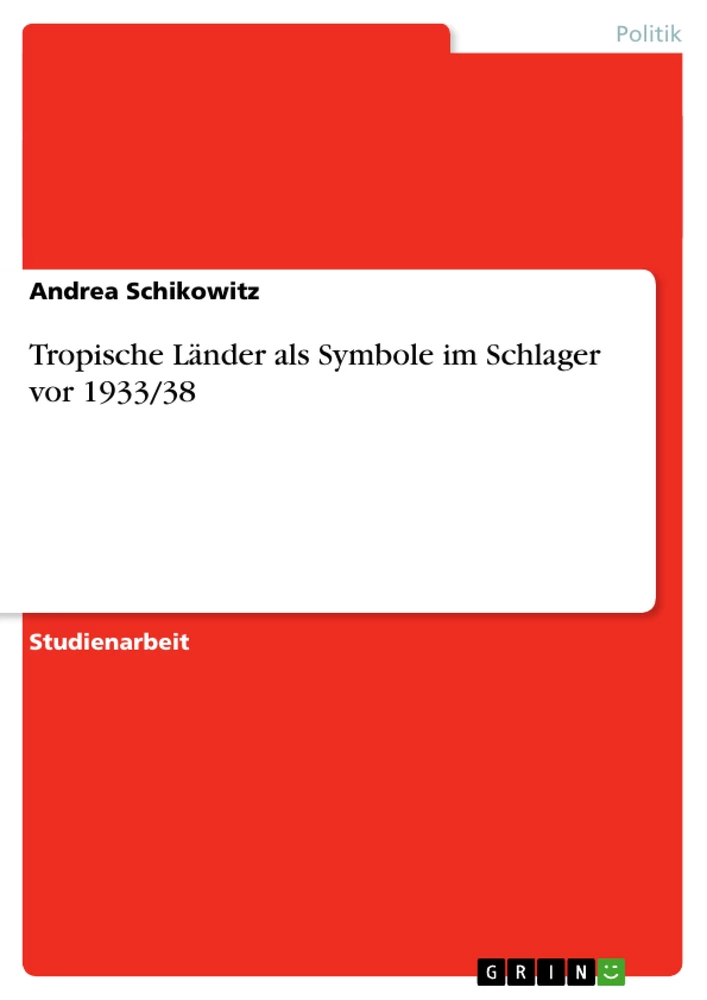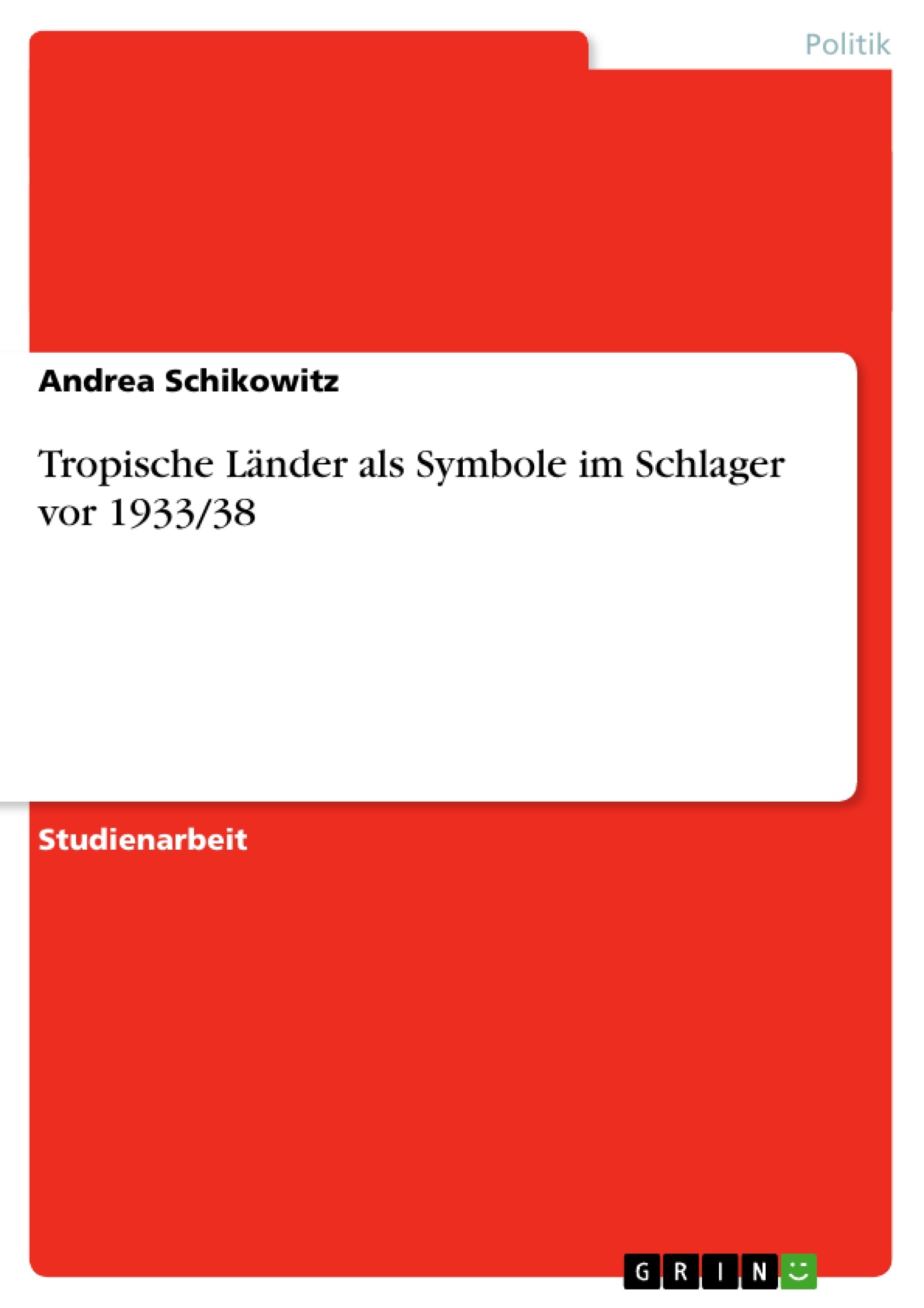Stereotype1 über fremde Menschen und fremde Länder werden uns tagtäglich vermittelt und weiterverbreitet. Sie begegnen uns auf Firmenschildern, in Kinderbüchern und eben auch in Schlagertexten. Eine eingehendere Untersuchung dieses Phänomens ist daher meiner Meinung nach sehr wichtig, um das Bewusstsein dafür zu stärken. Denn nur wenn wir Stereotype bewusst wahrnehmen, sind wir ihrer Wirkung nicht schutzlos ausgesetzt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich daher versuchen zu zeigen, wie und warum in den Schlagern der zwanziger und frühen dreißiger Jahre exotische Länder dargestellt wurden und welche Konsequenzen das nach sich zog.
Dann möchte ich auch auf Kinderlieder eingehen, da diese gerade ob ihrer scheinbaren Harmlosigkeit und Unschuld besondere Aufmerksamkeit verdienen. Darin versteckte Stereotype und Vorurteile können unbewusst auf die Kinder wirken und entziehen sich einen bewussten Reflexion.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Erkenntnisinteresse und Vorgangsweise
- 2. Tropische Länder im präfaschistischen Schlager
- 2.1. Das gesellschaftliche und politische Umfeld
- 2.1.1. Die zwanziger Jahre
- 2.1.2. Die frühen dreißiger Jahre
- 2.2. Exotische Länder als Symbole
- 2.3. Musikalische Zeichen
- 2.3.1. Der Tango
- 2.3.2. Rumba
- 2.3.3. Foxtrott
- 2.4. Akteure
- 2.4.1. Fritz Grünbaum
- 2.4.2. Willy Rosen (1894-1944)
- 2.4.3. Will Meisel (1897-1967)
- 2.4.4. Walter Jurmann (1903 – 1971)
- 2.4.5. Siegfried Arno (1895 – 1975)
- 2.1. Das gesellschaftliche und politische Umfeld
- 3. Kinderlieder
- 3.1. Allgemeines
- 3.2. Fremde Menschen und Länder im Kinderlied
- 3.2.1. „Der Butzemann“
- 3.2.2. „Drei Japanesen“
- 3.2.3. „Zehn kleine Negerlein“
- 4. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung exotischer Länder in deutschen Schlagern der 1920er und frühen 1930er Jahre und in Kinderliedern derselben Epoche. Ziel ist es aufzuzeigen, wie und warum diese Länder symbolisch verwendet wurden und welche Folgen dies hatte. Besondere Aufmerksamkeit gilt den in scheinbar harmlosen Kinderliedern versteckten Stereotypen und Vorurteilen.
- Stereotype von fremden Ländern und Menschen in Schlagern und Kinderliedern
- Der Einfluss des gesellschaftlichen und politischen Umfelds auf die Liedtexte
- Die Funktion exotischer Länder als Symbole für Sehnsüchte und Fluchtträume
- Musikalische Stile und ihre Verbindung zu den thematischen Inhalten
- Die Rolle prominenter Künstler und Komponisten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erkenntnisinteresse und Vorgangsweise: Dieses Kapitel erläutert das Forschungsinteresse der Autorin, Stereotype in Schlagern und Kinderliedern zu untersuchen. Es betont die Wichtigkeit des bewussten Wahrnehmens von Stereotypen, um deren Wirkung zu entgehen. Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung exotischer Länder in Schlagern der zwanziger und frühen dreißiger Jahre und deren Konsequenzen, sowie auf die besondere Bedeutung von Kinderliedern aufgrund ihrer scheinbaren Unschuld.
2. Tropische Länder im präfaschistischen Schlager: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung tropischer Länder in Schlagern vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der 1920er und frühen 1930er Jahre in Deutschland und Österreich. Es beschreibt die Vielfalt und den unromantisch-sachlichen Ton der Schlager der 1920er Jahre, der oft ironisch-zynisch und provokativ war. Die Weltwirtschaftskrise und der Aufstieg des Nationalsozialismus führten zu einer Veränderung hin zu mehr Traumwelten und sentimentaler Sehnsucht nach Flucht aus der Realität, wobei exotische Länder als leere Zeichen dieser Sehnsucht fungierten.
3. Kinderlieder: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung fremder Menschen und Länder in Kinderliedern. Es wird die besondere Bedeutung dieser scheinbar harmlosen Lieder betont, da in ihnen versteckte Stereotype und Vorurteile unbewusst auf Kinder wirken können. Es werden konkrete Beispiele von Kinderliedern analysiert, um die darin enthaltenen Stereotype zu identifizieren und deren Wirkung zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Schlager, Kinderlieder, Stereotype, Exotische Länder, Tropen, 1920er Jahre, 1930er Jahre, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Gesellschaftskritik, Musikgeschichte, Propaganda, Sehnsucht, Flucht, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung exotischer Länder in deutschen Schlagern und Kinderliedern der 1920er und 30er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung exotischer Länder in deutschen Schlagern der 1920er und frühen 1930er Jahre sowie in Kinderliedern derselben Epoche. Im Fokus steht die Analyse, wie und warum diese Länder symbolisch verwendet wurden und welche Folgen dies hatte, insbesondere die in scheinbar harmlosen Kinderliedern versteckten Stereotype und Vorurteile.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die 1920er und frühen 1930er Jahre in Deutschland und Österreich, also die Zeit der Weimarer Republik und den Beginn der NS-Diktatur. Dieser Zeitraum ist relevant, da sich die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse stark auf die Liedtexte auswirkten.
Welche Arten von Liedern werden untersucht?
Die Arbeit analysiert sowohl Schlager der 1920er und frühen 1930er Jahre als auch Kinderlieder aus derselben Zeit. Der Vergleich beider Genres dient dazu, die unterschiedliche Wirkung von Stereotypen auf verschiedene Zielgruppen zu beleuchten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Stereotype von fremden Ländern und Menschen in Schlagern und Kinderliedern; den Einfluss des gesellschaftlichen und politischen Umfelds auf die Liedtexte; die Funktion exotischer Länder als Symbole für Sehnsüchte und Fluchtträume; musikalische Stile und ihre Verbindung zu den thematischen Inhalten; die Rolle prominenter Künstler und Komponisten.
Welche konkreten Beispiele von Liedern werden analysiert?
Die Arbeit nennt und analysiert unter anderem die Kinderlieder „Der Butzemann“, „Drei Japanesen“ und „Zehn kleine Negerlein“, um die darin enthaltenen Stereotype zu identifizieren und deren Wirkung zu beleuchten. Im Bereich der Schlager werden u.a. die Beiträge von Fritz Grünbaum, Willy Rosen, Will Meisel, Walter Jurmann und Siegfried Arno untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 erläutert das Erkenntnisinteresse und die Vorgangsweise; Kapitel 2 analysiert die Darstellung tropischer Länder im präfaschistischen Schlager; Kapitel 3 konzentriert sich auf Kinderlieder; Kapitel 4 enthält Schlussbemerkungen.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die scheinbar harmlose Darstellung exotischer Länder in Schlagern und Kinderliedern oft Stereotype und Vorurteile transportiert, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wahrnehmung anderer Kulturen haben. Die Analyse betont die Bedeutung des bewussten Wahrnehmens dieser Stereotype, um deren Wirkung zu entgehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Analyse von Schlagern und Kinderliedern ein wertvolles Instrument ist, um die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse einer bestimmten Epoche zu verstehen und die langfristigen Folgen von Stereotypisierung zu beleuchten. Die scheinbare Unschuld von Kinderliedern darf dabei nicht übersehen werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Schlager, Kinderlieder, Stereotype, Exotische Länder, Tropen, 1920er Jahre, 1930er Jahre, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Gesellschaftskritik, Musikgeschichte, Propaganda, Sehnsucht, Flucht, Identität.
- Quote paper
- Mag. Andrea Schikowitz (Author), 2004, Tropische Länder als Symbole im Schlager vor 1933/38, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115068