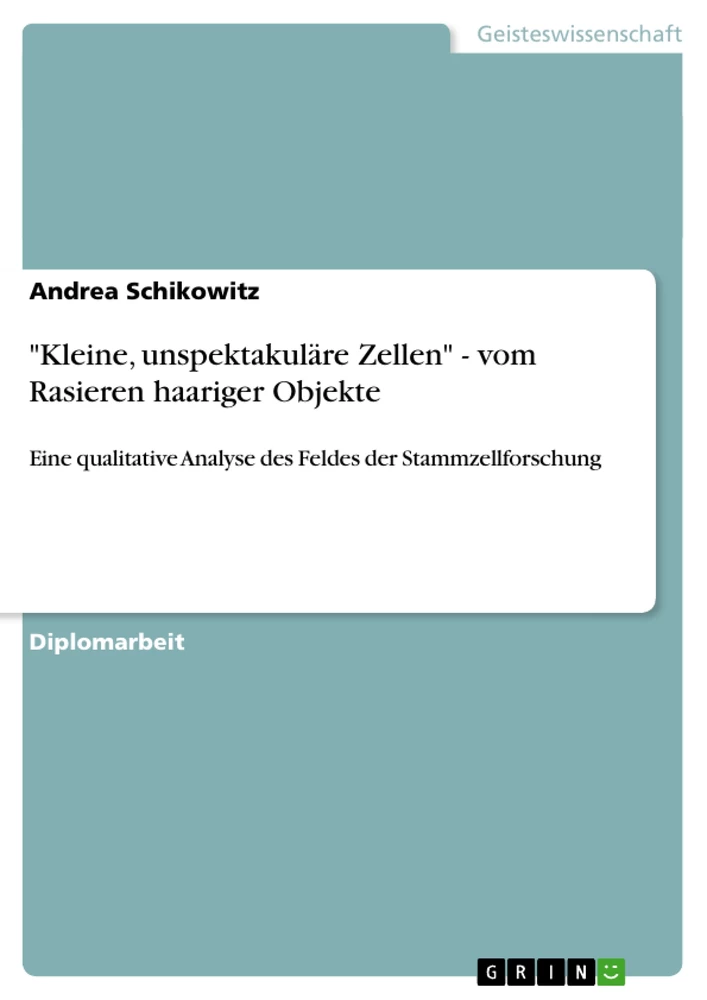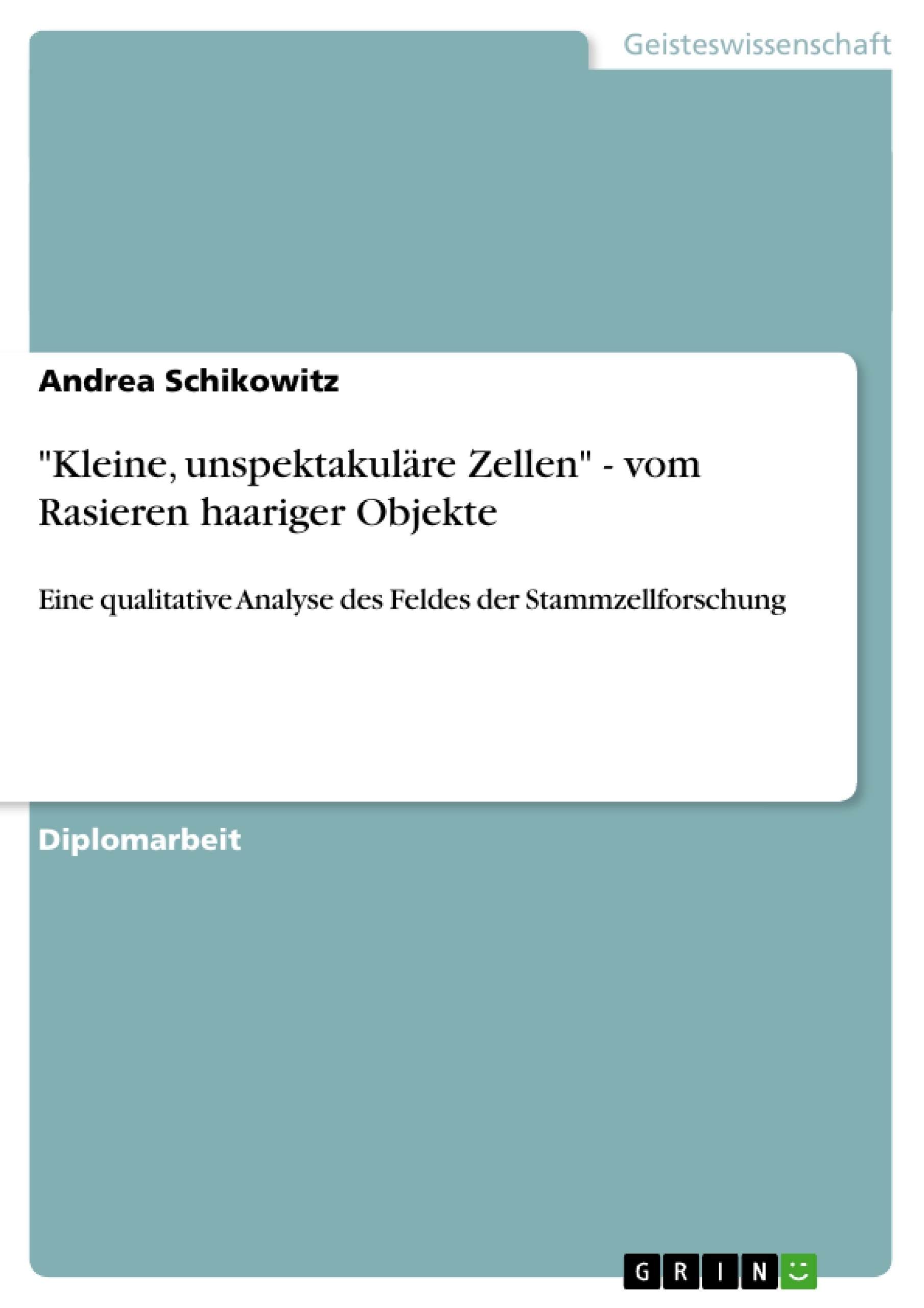Um die Perspektive, aus der ich an meine Fragestellung herangehe, nachvollziehbar zu machen, werde ich meinen fachlichen Hintergrund kurz darstellen. Ich studiere seit dem WS 2000 Soziologie (geisteswissenschaftlicher Zweig) und Politikwissenschaft. Dabei habe ich am Institut für Wissenschaftsforschung einige Lehrveranstaltungen absolviert. Ausgehend von der Beschäftigung mit Biologismus hat sich ein starkes Interesse für biomedizinische Themen herausgebildet. Daher wollte ich mich auch in meiner Diplomarbeit aus wissenssoziologischer Sichtweise mit Biotechnologie beschäftigen. Als Soziologin wollte ich dafür einen Bereich finden, der auch in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion relevant ist. Meine Entscheidung für die Stammzellforschung gründet auf persönlichem Interesse und der subjektiven Wahrnehmung, dass dieses Thema in den Medien und auch in der politischen Diskussion sehr präsent ist. Beim Einlesen in das Thema der Stammzellforschung ist mir aufgefallen, dass selbst das Basiswissen über die Stammzelle und ihre genaue Funktionsweise sehr unsicher ist. Was sie im Körper genau auslöst, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Diese Wahrnehmung hat mein Interesse auf die Stammzelle als Objekt gelenkt. In Anlehnung an Bruno Latour sind solche wissenschaftlichen Objekte weder reine Naturobjekte, die unabhängig von menschlicher Einflussnahme bestehen, noch reine Konstrukte, die erst durch menschliche Konstruktionsarbeit entstanden sind und ohne diese nicht existieren würden. Sie entstehen in ihrer konkreten Form vielmehr durch das Zusammentreffen und die Kommunikation von Menschen und „Naturobjekten“, sie haben eine Geschichte. Sie sind laufender Veränderung unterworfen und wirken auch verändernd auf die sie umgebende Welt ein. Insofern sind sie eben keine starren Objekte mehr, sondern Nicht-menschliche Akteure oder Aktanten. Sie haben durch die Übersetzungsleistung des wissenschaftlichen Instrumentariums die Fähigkeit zu sprechen und durch ihre Wirkung auf die politische und soziale Welt die Fähigkeit zu handeln. In diesem Sinne entfalten sie eine politische Wirkung. Das macht sie zu „haarigen Objekten“ im Sinne Bruno Latours.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Danksagungen
- Geschlechtersensible Schreibweise
- Erkenntnisinteresse und Fragestellung
- Konzeptionelle und theoretische Rahmen
- Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und Vergesellschaftung der Wissenschaft
- Über Stammzellforschung
- Was sind Stammzellen?
- Embryonale Stammzellen
- Somatische Stammzellen
- Wofür werden Stammzellen eingesetzt?
- Einsatz in der Forschung
- Krebstherapie
- Regeneration von Gewebe
- Herzinfarkttherapie
- Tumorbehandlung
- Gesetzliche Regelungen
- Europäische Union
- Österreich
- Zusammenfassende Überlegungen
- Theoretische Perspektive
- Pierre Bourdieu - das wissenschaftliche Feld
- Feld
- Kapital
- Habitus
- Autonomie eines Feldes
- Hierarchisierungsprinzipien
- Die Besondere Bedeutung von sozialem Kapital im medizinischen Feld
- Bruno Latour - Haarige Objekte
- Das Höhlengleichnis - Spaltung von Gesellschaft und Natur
- ,,Die" Wissenschaft
- ,,Die" Natur
- Haarige Objekte
- Tatsachen und Werte
- Eine neue Gewaltenteilung
- Naturschutz
- Der Mensch ist frei
- Menschliche und nicht-menschliche Akteure
- Zusammenfassende Überlegungen
- Ein Koordinatensystem für das Feld der Stammzellforschung
- Naturbegriff
- Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft
- Natur im Labor
- Kybernetisches Naturbild
- DNA - Die einzig wahre Natur
- Zusammenfassende Überlegungen
- Menschenbild
- Der Mensch als „,animal rationale"
- Biologischer Determinismus
- Menschenbild in der Gentechnik-Ära
- Zusammenfassende Überlegungen
- Risikobegriff
- Wissensabhängigkeit von Modernisierungsrisiken
- Soziale Anerkennung von Risiken
- Umgang,,der Öffentlichkeit“ mit Risiken
- Vergesellschaftung der Natur
- Subpolitik der Medizin
- Zusammenfassende Überlegungen
- Wissenschaftliches Selbstverständnis
- Definitionen von Wissenschaft
- Grundlagenforschung und angewandte Forschung
- Wissenschaft und Öffentlichkeit
- Hierarchien
- Implizite Normen
- Objektivität
- Originalität und Innovation
- Wissenschaftliche Praxis
- Zusammenfassende Überlegungen
- Eine qualitative Analyse des Feldes der Stammzellforschung
- Methodische Herangehensweise
- Überlegungen zu qualitativen Methoden
- Vorbereitung auf die Interviews
- Der Leitfaden
- Auswahl der Befragten
- Feldzugang
- Interviewführung
- Auswertung mittels Systemanalyse
- Mechanismen und Vorstellungen im Feld der Stammzellforschung
- ,,Switching" zwischen multiplen Menschenbildern
- Der Körper als „Black Box"
- Ignorieren kritischer Aspekte
- Verteidigung der Autonomie
- Forscherdrang und Fortschritt
- Wahrnehmung der Öffentlichkeit und „Aufklärung“
- Bilder von der Stammzelle als Objekt
- Resumée – Lasst den Stammzellen ihre Haare!
- Leitfaden
- Literatur
- Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und Vergesellschaftung der Wissenschaft
- Die Rolle der Stammzelle als „haariges Objekt“ im Sinne Bruno Latours
- Die Verhandlungsprozesse der Stammzelle als wissenschaftliches Objekt
- Die Folgen der Verhandlungsprozesse für die Forschung, die Gesellschaft und die Politik
- Die Bedeutung von sozialem Kapital im medizinischen Feld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert das Feld der Stammzellforschung aus wissenssoziologischer Perspektive. Ziel ist es, die Strukturen und Mechanismen dieses Feldes zu untersuchen und die Rolle der Stammzelle als „haariges Objekt“ im Sinne Bruno Latours zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie die Stammzelle als wissenschaftliches Objekt in der Forschung, in der Gesellschaft und in der Politik verhandelt wird und welche Folgen diese Verhandlungsprozesse haben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Erkenntnisinteresse und die Fragestellung der Arbeit vor. Sie erläutert den fachlichen Hintergrund der Autorin und die Relevanz des Themas Stammzellforschung. Die Einleitung führt den Begriff des „haarigen Objektes“ im Sinne Bruno Latours ein und erklärt, warum dieser Begriff für die Analyse der Stammzelle als Objekt geeignet ist.
Das zweite Kapitel stellt den konzeptionellen und theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Es werden die Theorien von Pierre Bourdieu und Bruno Latour vorgestellt und auf das Feld der Stammzellforschung angewendet. Der Abschnitt über Bourdieu analysiert die Strukturen des wissenschaftlichen Feldes und die Bedeutung von Kapital und Habitus. Der Abschnitt über Latour untersucht die Rolle von „haarigen Objekten“ in der Wissenschaft und die Folgen ihrer Verhandlungsprozesse für die Gesellschaft.
Das dritte Kapitel beschreibt die methodische Herangehensweise der Arbeit. Es werden die verwendeten qualitativen Methoden, die Auswahl der Befragten und die Interviewführung erläutert. Der Abschnitt beschreibt auch die Auswertung der Interviews mittels Systemanalyse.
Das vierte Kapitel analysiert die Mechanismen und Vorstellungen im Feld der Stammzellforschung. Es werden die verschiedenen Menschenbilder, die im Feld der Stammzellforschung verwendet werden, untersucht. Der Abschnitt analysiert auch die Rolle des Körpers als „Black Box“ und die Folgen des Ignorierens kritischer Aspekte. Das Kapitel untersucht auch die Verteidigung der Autonomie des Feldes und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Stammzellforschung, die Wissenschaftssoziologie, das wissenschaftliche Feld, „haarige Objekte“, Bruno Latour, Pierre Bourdieu, Kapital, Habitus, Verwissenschaftlichung der Gesellschaft, Vergesellschaftung der Wissenschaft, Menschenbild, Naturbegriff, Risikobegriff, wissenschaftliches Selbstverständnis, qualitative Methoden, Systemanalyse, Interviews, Forschung, Gesellschaft, Politik, Verhandlungsprozesse, Folgen, Autonomie, Öffentlichkeit, „Black Box“, kritischer Aspekt.
- Quote paper
- Mag. Andrea Schikowitz (Author), 2006, "Kleine, unspektakuläre Zellen" - vom Rasieren haariger Objekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115009