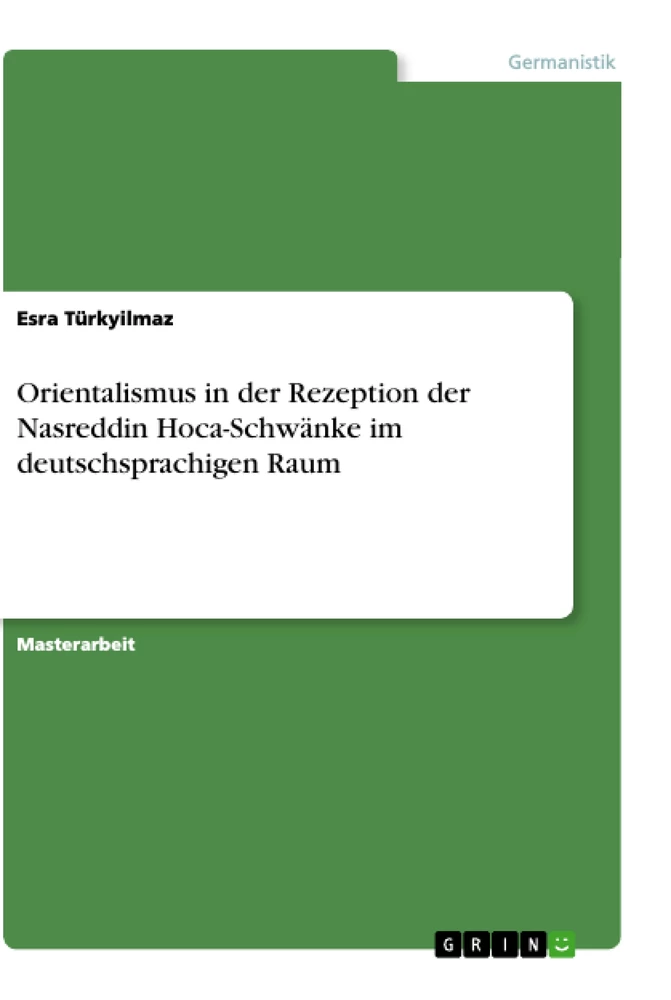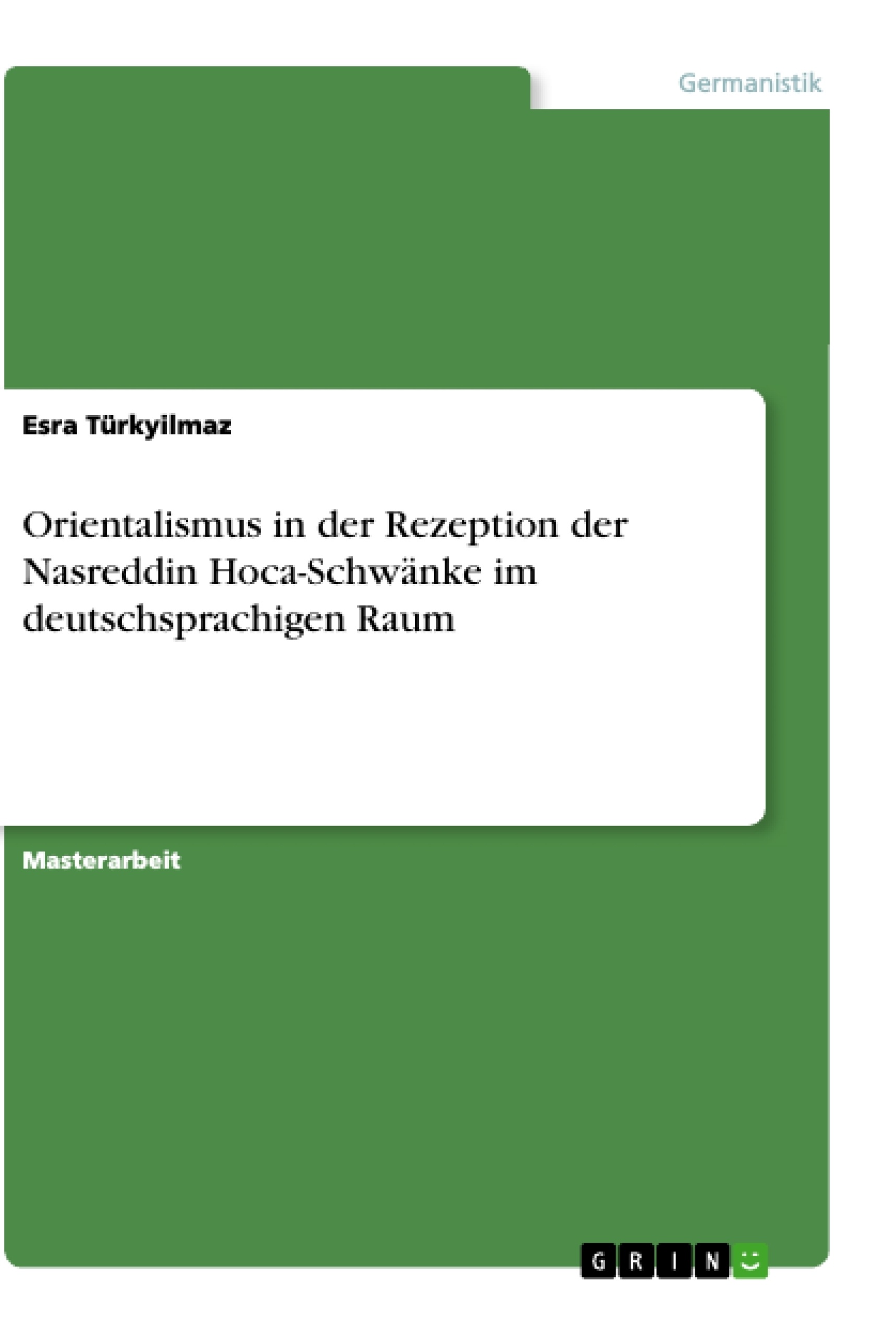Die Leitfragen dieser Arbeit lautet: Aus welchem Blickwinkel wird der Nasreddin Hoca-Stoff in Deutschland rezipiert? Wird die Figur Nasreddin Hoca eher modernisiert oder archaisiert? Werden die Schwänke in den deutschsprachigen Bearbeitungen selbst konstruierten orientalischen Stereotypen, wie orientalischer Sinnlichkeit, Despotismus oder Barbarei angepasst?
Neben der Sammlung morgenländischer Erzählungen Tausendundeine Nacht zählen die Nasreddin Hoca-Schwänke zu den größten literarischen Exporten aus dem Orient in den Okzident. Beide Werke wurden durch Antoine Galland in den europäischen Sprachraum eingeführt, durch den die Texte zunächst ins Französische übersetzt wurden.
Die Popularität des Schwankenhelden führte dazu, dass das Jahr 1996 vom UNESCO zum Nasreddin Hoca Jahr ernannt wurde. Schon Goethe hat die Figur und Person Nasreddin als "launigen Zug- und Zeltgefährten" des mongolischen Herrschers Timur gekannt. Morgenländische Geschichten übten schon immer einen gewissen Reiz auf die Europäer aus. Das Schillernde und Opulente an Tausendundeine Nacht besaß die notwendige Portion Exotik, um eine Faszination an einer scheinbar fremden Welt auszulösen. Ähnlich ist der Medienrummel um die 1962 verfilmte Biografie des zum Übermenschen stilisierten Lawrence von Arabien zu bewerten.
Auf den ersten Blick liegt die Vermutung nahe, dass auch die Figur Nasreddin Hoca sich in diese Reihe der schillernden, bunten Geschichten aus dem Orient einreihen lässt. Maler zeichnen sein Bild seit Jahrhunderten ohne einen nennenswerten Unterschied. Das Bild von Nasreddin Hoca, der einen Turban auf dem Kopf trägt, bekleidet in weite Gewänder und in treuer Begleitung seines grauen Esels hat sich als Prototyp einer orientalischen Figur im kulturellen Gedächtnis der Menschen verankert. Doch das trifft in diesem Fall nicht auf die türkischsprachigen Texte zu. Im extremen Gegensatz zu den eingangs genannten Beispielen weisen die Schwänke von Nasreddin Hoca in den türkischsprachigen Versionen eine erstaunliche Nähe zum Alltäglichen auf: Dazu zählen beispielsweise das stehende Inventar der Anekdoten, wozu der Ort (Haus, Schule, Gericht, Moschee, Markt und Kafeehaus), die Zeit (Nacht, Tag, Sommer, Winter) und das Personal (er selbst, seine Frau, seine Tochter, Nachbar, Krämer, Gläubiger, Richter, Dieb und Fremder) zählen. Gewöhnlich besteht die Fabel auch inhaltlich in einem alltäglichen Vorfall. Nichts könnte weniger kulturell spezifisch sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Morgenländische Tradition im Abendland
- Kontext der Arbeit, Forschungsziele und Fragen
- Aufbau der Arbeit
- Allgemeine Informationen und Kontext der türkischsprachigen Vorlagen
- Geographische Verbreitung des Nasreddin Hoca-Stoffes
- Bekanntheitsgrad in Sprachen gemessen
- Ersetzung anderer Narrengestalten durch Nasreddin
- Mythos oder Realität: Die Biografie der historischen Person Nasreddin Hoca
- Nasreddin Hocas Nachfahren
- Hocas Grab als Pilgerstätte
- Innertürkische Überlieferungsgeschichte
- Wandlung des Stoffes in den schriftlichen türkisch-sprachigen Schwank-Sammlungen aus historischer Perspektive
- Saidscher Orientalismus in der Übersetzungs- und Wirkungsgeschichte von Tausendundeine Nacht
- Überblick über die Übersetzungs-, Wirkungsgeschichte, sowie die Überlieferungswege von Tausendundeine Nacht
- Parallele zwischen dem Werk 1001 Nacht und den Schwanksammlungen über Nasreddin Hoca
- Übersetzungsgeschichtlicher Aspekt: Antoine Gallands Adaptation des Stoffes
- Wirkungsgeschichtlicher Aspekt: Narrativer Orientalismus oder das „Aladdin-Syndrom“
- Rückwirkung des Werkes oder der „,Pizza-Effekt“
- Rezeptionsgeschichte des Nasreddin Hoca-Stoffes in Deutschland
- Edward William Said: Der Orient als europäische Erfindung
- François Julliens Selbstanalyse durch Fremdanalyse
- Forschungsstand der ,,Nasreddinologie“
- Reinhold Köhler (1898)
- Albert Wesselski (1911)
- Dieter Glade (1988)
- Ulrich Marzolph (1996)
- Überschreitung von kulturellen Grenzen als Grundlage der Komparatistik
- Bezugnahmen deutscher Autoren zu Nasreddin Hoca
- Johann Wolfgang von Goethes Kenntnis von Nasreddin Hoca
- Hermann Hesses Kenntnis von Nasreddin Hoca
- Rezeption des Nasreddin-Stoffes durch Johann Wolfgang von Goethe und Hermann Hesse vor dem Hintergrund der Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Deutschland bzw. Preußen und dem Deutschen Kaiserreich
- Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817) als Orientalist und erster Übersetzer des Nasreddin-Stoffes in Deutschland
- Analogie zwischen Till Eulenspiegel und Nasreddin Hoca
- Identisches Handlungsgerüst
- Till Eulenspiegel und Nasreddin Hoca als verschiedene Ausformungen des Universaltypus des Tricksters
- Ergebnisse der bisherigen Abschnitte im Kontext der deutsch-türkischen Beziehungen:
- Das Verhältnis von Macht und Sprache: Übersetzungsmethoden der deutschsprachigen Schwanksammlungen
- Einbürgerung versus Bewahren des Fremden
- Requisitenverschiebung aus dem mittelalterlichen osmanischen Reich ins technologische Deutschland des 21. Jahrhunderts
- Identischer Handlungsablauf mit anderen Requisiten, Schauplätzen und Figuren
- Identische Dialektik
- Identische Charakterisierung Nasreddin Hocas
- Rückwirkungen der deutschsprachigen Nasreddin Hoca-Bearbeitungen
- Die Rezeptionsgeschichte des Nasreddin Hoca-Stoffes in Deutschland
- Orientalistische Perspektiven und Stereotypen in der deutschen Rezeption
- Die Frage der Einbürgerung und Bewahrung des Fremden in den Übersetzungen
- Die Rolle von Macht und Sprache in der Übersetzungsgeschichte
- Der Einfluss des Nasreddin Hoca-Stoffes auf die deutsch-türkischen Beziehungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Rezeption des Nasreddin Hoca-Stoffes im deutschsprachigen Raum. Sie untersucht, wie die Figur des Nasreddin Hoca in deutschen Übersetzungen und Bearbeitungen des Stoffes interpretiert und dargestellt wurde. Dabei steht die Frage im Zentrum, inwieweit die Figur des Nasreddin Hoca als „Orientalisierungsprojekt“ genutzt wurde, um westliche Stereotypen und Vorstellungen vom Orient auf die Figur zu projizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet den Kontext sowie die Forschungsziele und -fragen. Im zweiten Kapitel werden allgemeine Informationen über die türkischsprachigen Vorlagen des Nasreddin Hoca-Stoffes gegeben, darunter die geographische Verbreitung, die Biografie des historischen Nasreddin Hoca und die innertürkische Überlieferungsgeschichte. Das dritte Kapitel widmet sich dem saidschen Orientalismus in der Übersetzungs- und Wirkungsgeschichte von Tausendundeine Nacht. Es beleuchtet Parallelen zwischen den beiden Werken sowie den Einfluss von Antoine Galland und die Frage des „Aladdin-Syndroms“. Im vierten Kapitel wird die Rezeptionsgeschichte des Nasreddin Hoca-Stoffes in Deutschland betrachtet. Hierbei werden die Theorien von Edward William Said und François Jullien sowie der Forschungsstand der „Nasreddinologie“ beleuchtet. Abschließend werden deutsche Autoren, die sich mit dem Nasreddin Hoca-Stoff auseinandergesetzt haben, sowie die Analogie zwischen Till Eulenspiegel und Nasreddin Hoca untersucht. In diesem Zusammenhang werden auch die Übersetzungsmethoden der deutschsprachigen Schwanksammlungen analysiert, um den Einfluss von Macht und Sprache auf die Rezeption des Stoffes zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Nasreddin Hoca, Orientalismus, Rezeption, Übersetzungsgeschichte, Deutsch-türkische Beziehungen, Kulturtransfer, Stereotypen, Einbürgerung, Bewahrung des Fremden, Macht, Sprache, Tricksterfigur, Till Eulenspiegel, Tausendundeine Nacht, Antoine Galland, Edward William Said, François Jullien.
- Quote paper
- Esra Türkyilmaz (Author), 2014, Orientalismus in der Rezeption der Nasreddin Hoca-Schwänke im deutschsprachigen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1149261