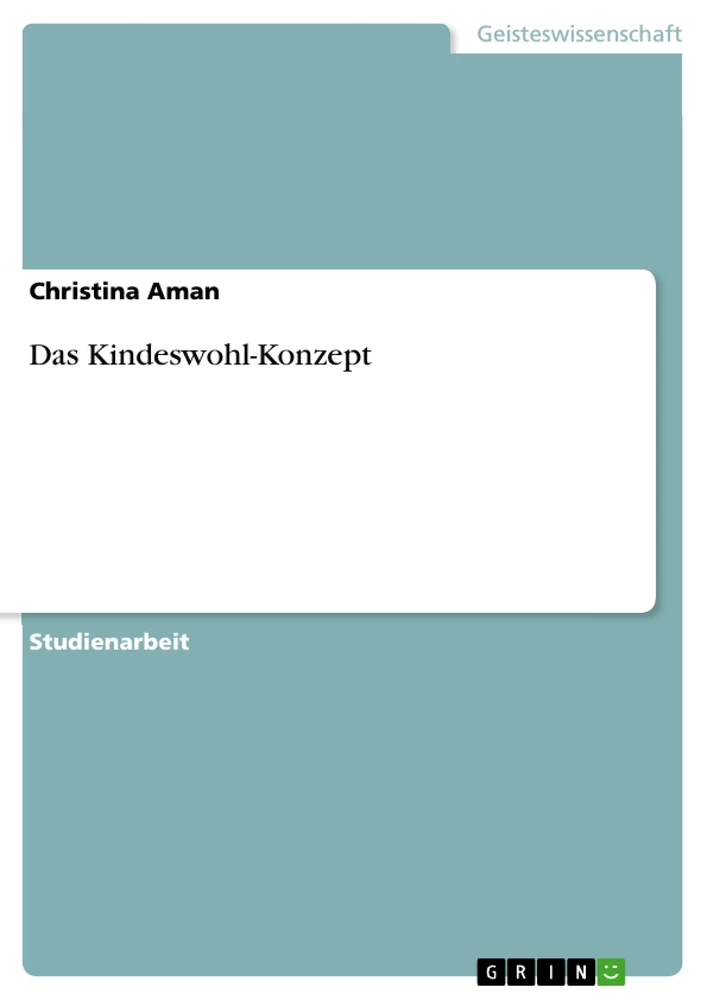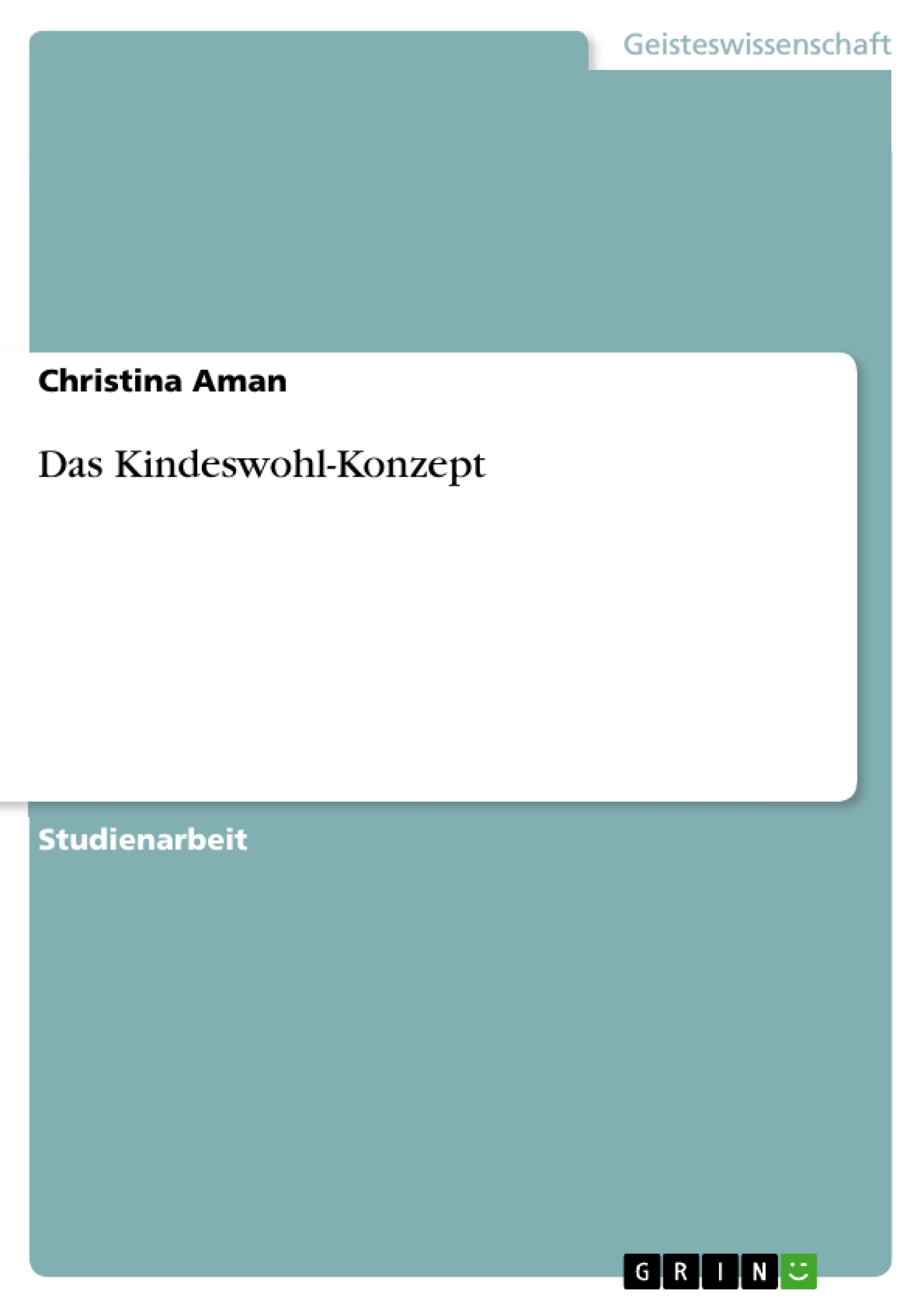In dieser Arbeit sollen unterschiedliche Definitionsversuche zu Kindeswohl aus verschiedenen Teilgebieten der Wissenschaft, aber auch aus dem rechtlichen Bereich nebeneinander gestellt werden, um die Intensität dieses Begriffs zu verdeutlichen. Autoren, Wissenschaftler und Institutionen aus unterschiedlichen Professionen führen schon seit Einführung des Kindeswohlbegriffs unbefriedigende Debatten. Den Beitrag leisten die verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen aus unterschiedlichen Fachgebieten, wie der Human-, Familienrechts- und Entwicklungspsychologie, den Sozialwissenschaften, der Sozialpädagogik, dem Familienrecht, Kinder- und Jugendhilfegesetz und mehr, die keine Übereinstimmung über den Inhalt des Kindeswohlbegriffs finden können, da die Methoden der Untersuchungen und die Anwendung des Kindeswohlbegriffs abweichend sind. Jedoch muss das Wohl des Kindes im Fokus interdisziplinärer Arbeit sein, um alle Bereiche, die das Kind betreffen, abdecken zu können. Zudem sind die vielen Definitionen konfuser Art und nicht leicht zugänglich. Es stellen sich die Fragen, warum ist es so schwierig auf nationaler Ebene eine gleichbedeutende und anerkannte Kindeswohldefinition zu finden? Und was wäre, wenn es den Begriff nicht geben würde, bzw. wenn es eine klare Definition geben könnte?
Fragen, die zum Schluss beantwortet werden sollen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Kindeswohl“
- Sichtweise im Familienrecht
- Sichtweise im Jugendamt
- Interdisziplinäre Kindeswohldefinitionsversuche
- Kindeswohl im Familienrecht
- Aspekt der elterlichen Trennung/Scheidung
- Ein familienrechtspsychologischer Definitionsvorschlag
- Kindeswohl aus psychologischer und pädagogischer Perspektive
- Aus pädagogisch-psychologischer Sicht
- Aus entwicklungspsychologischer Sicht
- Schutzauftrag der Kindeswohlsicherung: Funktion des Wächteramts und Aufgabenbereiche der Behörden
- Gesetzliche Grundlagen zum Kindeswohl
- Staatliches Recht auf Eingriff in das Elternrecht
- § 1697a BGB das Kindeswohlprinzip: „Generalklausel“
- Das Kindeswohl-Konzept
- Die Berücksichtigung des Kindeswillens
- Vorrang der Kindesinteressen
- Vorrang der Individualgerechtigkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den vielschichtigen Begriff des „Kindeswohls“ und seine Anwendung im deutschen Recht und in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition und die unterschiedlichen Perspektiven im Familienrecht, im Jugendamt und in interdisziplinären Ansätzen. Ziel ist es, die Komplexität des Begriffs aufzuzeigen und die Herausforderungen bei der Anwendung im praktischen Kontext zu verdeutlichen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Kindeswohl“
- Unterschiedliche Perspektiven auf Kindeswohl im Familienrecht und Jugendhilfe
- Der Konflikt zwischen elterlichem Recht und staatlichem Eingriffsrecht
- Die Rolle des Kindeswillens bei Entscheidungen zum Kindeswohl
- Interdisziplinäre Ansätze zur Kindeswohldefinition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Kindeswohls ein und betont die Uneinheitlichkeit in der Definition und dem Verständnis des Begriffs. Sie skizziert die Bedeutung der Kinderrechte, sowohl international durch die UN-Kinderrechtskonvention als auch national durch das BGB und das KJHG, und die daraus resultierende Herausforderung, ein homogenes Verständnis für den Begriff zu etablieren. Die Arbeit kündigt die Gegenüberstellung verschiedener Definitionsversuche aus unterschiedlichen Disziplinen an.
Der Begriff „Kindeswohl“: Dieses Kapitel analysiert den vagen und vielschichtig interpretierten Begriff des Kindeswohls. Es werden die kritischen Stimmen zu seiner Unbestimmtheit im wissenschaftlichen und juristischen Kontext beleuchtet. Der Beitrag diskutiert die Herausforderungen einer präzisen Definition und die unterschiedlichen Perspektiven innerhalb des Familienrechts und der Jugendhilfe, wobei die Schwierigkeiten der Anwendung und der Mehrdeutigkeit des Begriffes betont werden. Die unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Interpretationen des Kindeswohls werden hervorgehoben.
Schutzauftrag der Kindeswohlsicherung: Funktion des Wächteramts und Aufgabenbereiche der Behörden: Dieses Kapitel befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen und dem staatlichen Eingriffsrecht im Bezug auf Kindeswohl. Es untersucht die Rolle des Staates als Wächter des Kindeswohls, insbesondere im Kontext von § 1697a BGB. Es analysiert das Spannungsfeld zwischen dem Recht der Eltern und dem staatlichen Schutzauftrag für das Kind. Die Berücksichtigung des Kindeswillens und der Vorrang der Kindesinteressen werden ausführlich erörtert.
Schlüsselwörter
Kindeswohl, Kinderrechte, Familienrecht, Jugendhilfe, § 1697a BGB, UN-Kinderrechtskonvention, Kindeswille, elterliche Verantwortung, staatlicher Eingriff, interdisziplinäre Perspektive, Definitionsversuche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kindeswohl im deutschen Recht und in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den komplexen Begriff des „Kindeswohls“ aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich Familienrecht, Jugendhilfe und interdisziplinären Ansätzen. Sie untersucht die Schwierigkeiten bei der Definition, die unterschiedlichen Interpretationen und die Herausforderungen bei der praktischen Anwendung im Kontext von staatlichen Eingriffen in das Elternrecht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung des Begriffs „Kindeswohl“, die unterschiedlichen Perspektiven im Familienrecht und der Jugendhilfe, den Konflikt zwischen elterlichem Recht und staatlichem Eingriffsrecht, die Rolle des Kindeswillens bei Entscheidungen zum Kindeswohl und interdisziplinäre Ansätze zur Kindeswohldefinition. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, insbesondere § 1697a BGB, und die Berücksichtigung internationaler Standards wie der UN-Kinderrechtskonvention.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Begriff „Kindeswohl“ (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Sichtweisen), Schutzauftrag der Kindeswohlsicherung (mit Fokus auf staatliches Eingriffsrecht und Kindeswille) und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Welche Perspektiven auf Kindeswohl werden betrachtet?
Die Arbeit vergleicht die Sichtweisen des Familienrechts, des Jugendamts und verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen (Psychologie, Pädagogik, Entwicklungspsychologie). Sie zeigt die Unterschiede und Herausforderungen auf, die sich aus diesen verschiedenen Perspektiven ergeben.
Welche Rolle spielt der Kindeswille?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Kindeswillens bei Entscheidungen zum Kindeswohl und den Vorrang der Kindesinteressen im Kontext des staatlichen Eingriffsrechts. Sie diskutiert den Konflikt zwischen dem Kindeswillen und anderen relevanten Faktoren.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den gesetzlichen Grundlagen zum Kindeswohl, insbesondere mit § 1697a BGB, der als „Generalklausel“ für das Kindeswohlprinzip gilt. Die Rolle des Staates als Wächter des Kindeswohls und das Spannungsfeld zwischen elterlichem Recht und staatlichem Schutzauftrag werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kindeswohl, Kinderrechte, Familienrecht, Jugendhilfe, § 1697a BGB, UN-Kinderrechtskonvention, Kindeswille, elterliche Verantwortung, staatlicher Eingriff, interdisziplinäre Perspektive, Definitionsversuche.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler, Fachkräfte im Bereich der Jugendhilfe und des Familienrechts, sowie alle, die sich mit dem Thema Kindeswohl auseinandersetzen.
- Quote paper
- Dipl. Sozialpäd./-arbeiterin (Uni) Christina Aman (Author), 2007, Das Kindeswohl-Konzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114912