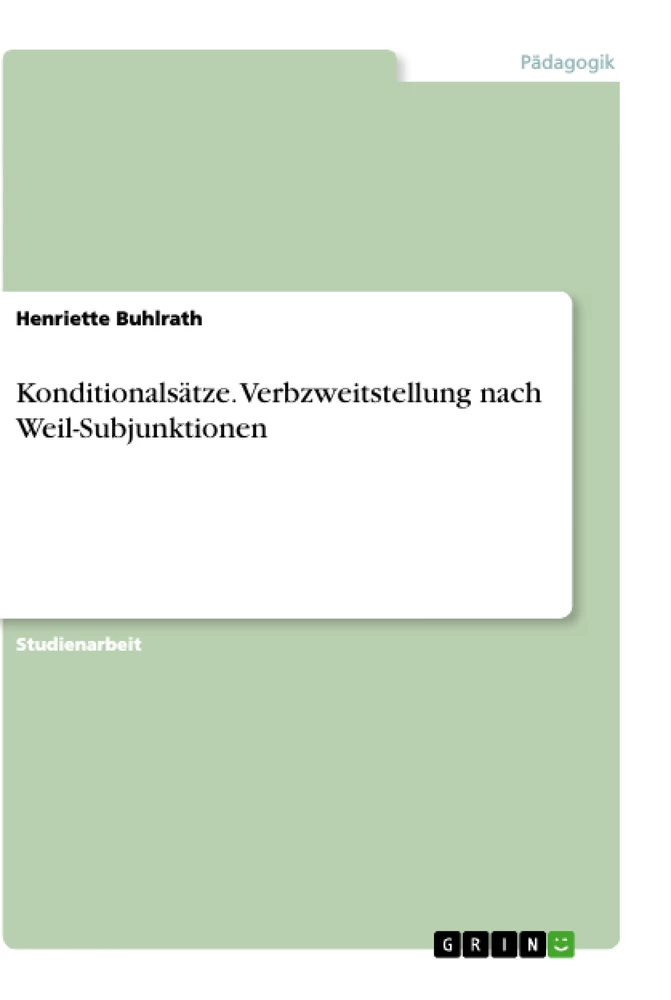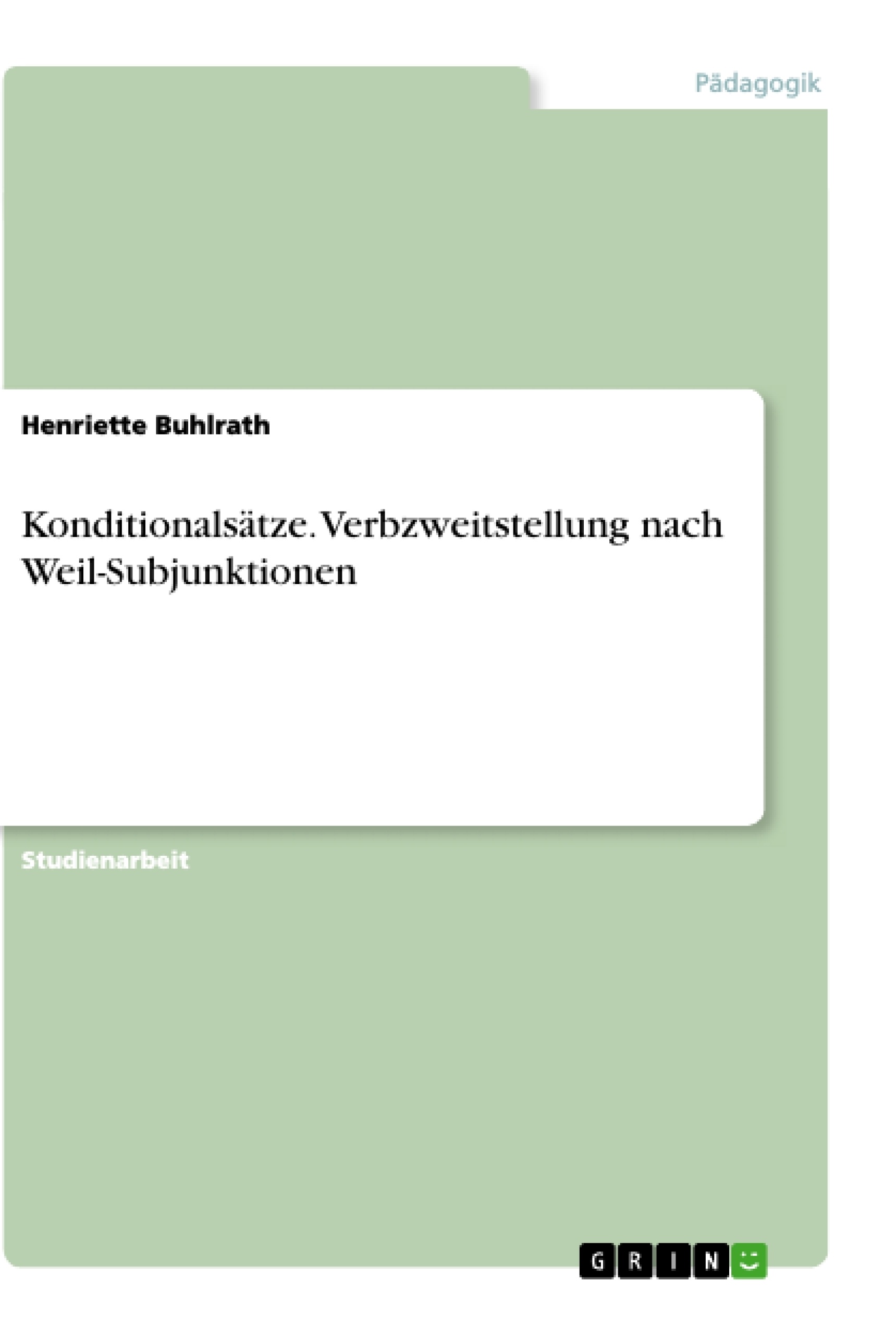Diese Arbeit befasst sich mit der Verbstellung in Konditionalsätzen.
Heute kann man alles bei der großen Suchmaschine Google finden und wenn man nun den Begriff Weil-Satz oder weil als Diskursmarker in der Suchfunktion eingibt, dann wird sehr schnell klar, dass das ein Thema ist, welches vor allem in der gesprochenen Sprache ist, das Thema aktuell. In der geschriebenen Sprache folgt auf die Wörter "weil", "obwohl" und "wobei" ein Nebensatz mit Verbletztstellung.
Dieses Phänomen der Verbzweitstellung nach Subjunktionen ist aber weit verbreitet und mittlerweile hat eben dieses Phänomen es auch geschafft, Aufmerksamkeit zu erzielen. Sprachpfleger befürchten aufgrund von diesem Phänomen den endgültigen Verfall der deutschen Sprache.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit eben diesem Phänomen anhand einer Darstellung eines Alltagsgesprächs und einer institutionellen Kommunikation. Im Anschluss daran werden die Untersuchungs- sowie Analysemethoden der Korpora erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachwissenschaftliche Betrachtung
- Theoretische Abhandlung des Begriffs Diskursmarker
- Kausalsätze
- Eigenschaften von V2 und VL Nebensätzen
- Unterschiede zwischen weil- VL und weil- V2
- Weil- Sätze mit Verbendstellung
- Weil -Sätze mit Verbzweitstellung
- Lesarten von Weil mit Verbzweitstellung
- Propositionale Begründung
- Epistemische Begründung
- Begründung bezogen auf den Sprechakt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der „Weil-V2-Sätze“ (WV2), welche in der gesprochenen Sprache immer häufiger auftreten und in der Sprachwissenschaft eine intensive Debatte auslösen. Der Fokus liegt auf der Analyse dieser Konstruktion im Vergleich zu traditionellen „Weil-VL-Sätzen“ (WVL), sowie der Untersuchung der verschiedenen Begründungsarten, die durch WV2 ausgedrückt werden.
- Untersuchung der Unterschiede zwischen WV2 und WVL in Bezug auf Syntax, Semantik und Pragmatik
- Analyse der verschiedenen Begründungsarten (propositional, epistemisch, sprechaktbezogen) im Kontext von WV2
- Erläuterung des Diskursmarker-Charakters von „weil“ in WV2 und seine Funktionen in der gesprochenen Sprache
- Einordnung des Phänomens WV2 in den Kontext der Sprachentwicklung und die Debatte um den Verfall der deutschen Sprache
- Analyse von empirischen Daten aus Alltagsgesprächen und institutioneller Kommunikation, um das Auftreten und die Verwendung von WV2 zu beleuchten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einführung stellt das Phänomen der WV2 im Kontext der aktuellen Sprachdiskussion dar, beleuchtet die Debatte um den „Verfall“ der deutschen Sprache und führt in die Forschungsfragen und die Struktur der Arbeit ein.
- Sprachwissenschaftliche Betrachtung:
- Theoretische Abhandlung des Begriffs Diskursmarker: Erklärt den Begriff „Diskursmarker“ und erläutert dessen Funktion in der Sprachkommunikation.
- Kausalsätze: Definiert den Begriff „Kausalsatz“ und beleuchtet die Unterschiede zwischen der Verwendung in der gesprochenen und der geschriebenen Sprache.
- Eigenschaften von V2 und VL Nebensätzen: Vergleicht die Eigenschaften von WV2 und WVL in Bezug auf ihre syntaktische Position und weitere Merkmale.
- Unterschiede zwischen weil- VL und weil- V2: Analysiert die Unterschiede zwischen den beiden Satzkonstruktionen in Bezug auf Syntax, Semantik und Pragmatik.
- Weil- Sätze mit Verbendstellung: Erläutert die Konnektorenmerkmale von „weil“ in Bezug auf Verbendstellung.
- Weil -Sätze mit Verbzweitstellung: Beschreibt die Eigenschaften von WV2 und deren Bedeutung in der gesprochenen Sprache.
- Lesarten von Weil mit Verbzweitstellung:
- Propositionale Begründung: Beschreibt die propositionale Begründungsfunktion von WV2.
- Epistemische Begründung: Erläutert die epistemische Begründungsfunktion von WV2.
- Begründung bezogen auf den Sprechakt: Analysiert die sprechaktbezogene Begründungsfunktion von WV2.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern der deutschen Syntax, der Pragmatik, der Diskursanalyse und der Sprachentwicklung. Im Zentrum stehen die Konstruktionen „Weil-V2-Sätze“ (WV2) und „Weil-VL-Sätze“ (WVL), sowie die verschiedenen Begründungsarten, die durch diese Konstruktionen ausgedrückt werden. Weitere Schlüsselwörter sind: Diskursmarker, Kausalsätze, Verbzweitstellung, Verbendstellung, epistemische Begründung, propositionale Begründung, sprechaktbezogene Begründung.
- Citation du texte
- Henriette Buhlrath (Auteur), 2021, Konditionalsätze. Verbzweitstellung nach Weil-Subjunktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148815