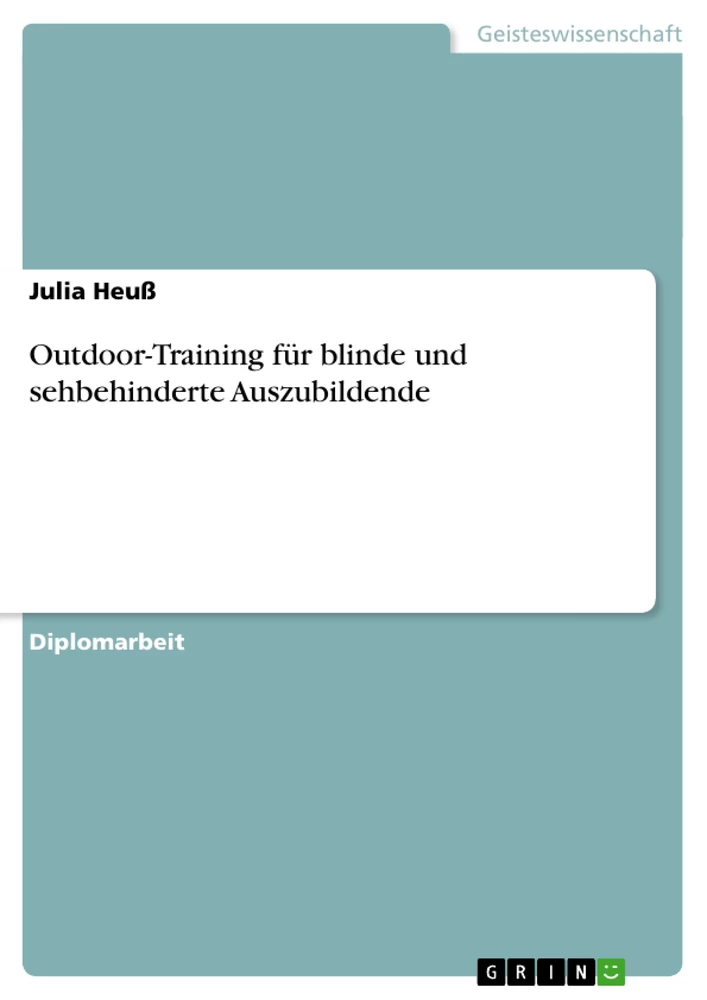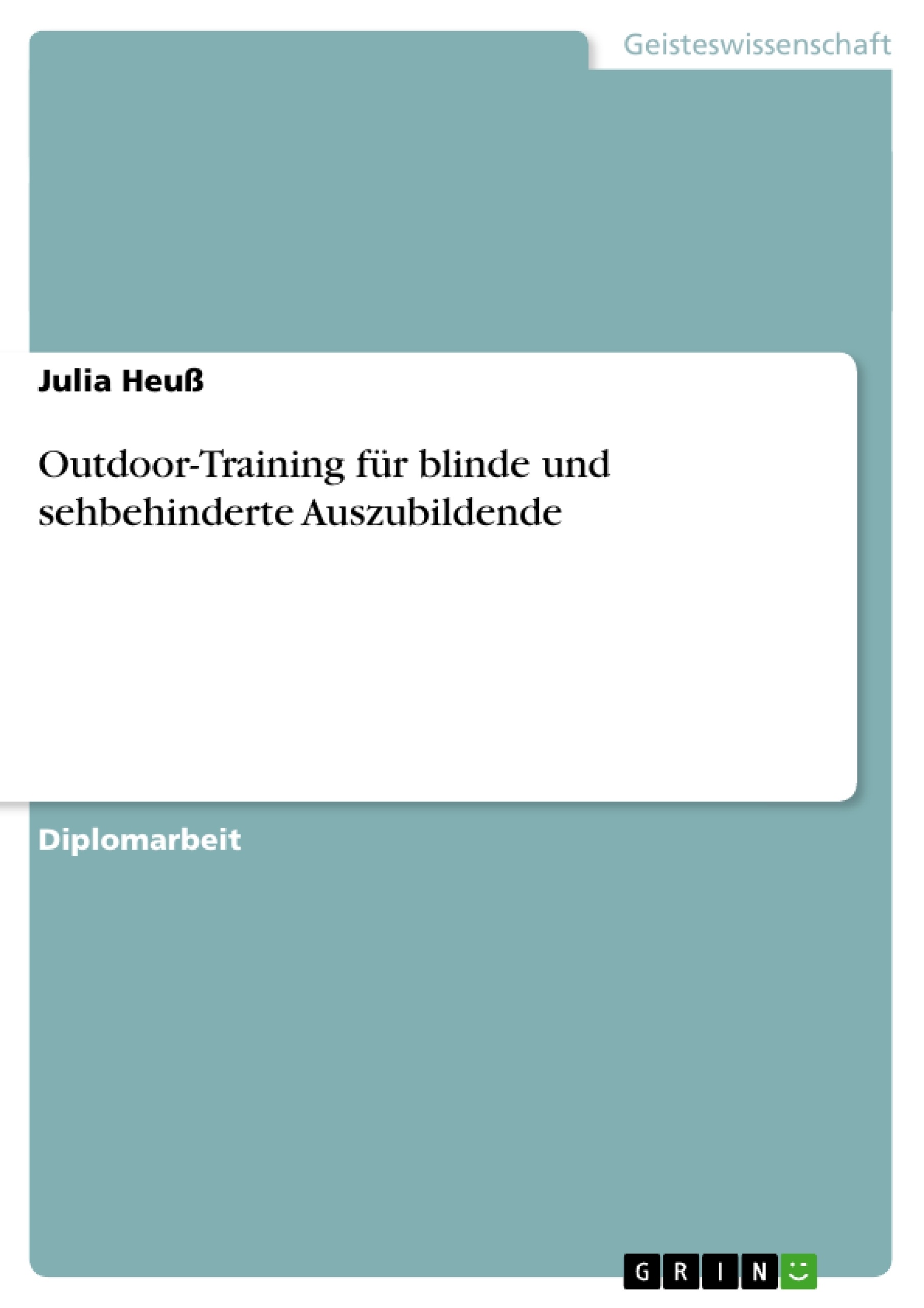Durch vielfältige Veränderungen der Bedingungen, denen Industrie-, Wirtschafts-,
und Dienstleistungsunternehmen in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, verändern
sich auch die Anforderungen an deren Mitarbeiter. Waren früher maßgeblich
Fachkompetenzen gefragt, so zählen heute auch die Methoden-, Selbst- und
Sozialkompetenz zum Anforderungsprofil an einen guten Arbeitnehmer. Zur
Förderung dieser so genannten Softskills werden Outdoor-Trainings seit den 70er
Jahren in der betrieblichen Weiterbildung mit steigender Beliebtheit eingesetzt. Es werden u.a. Trainings für Führungskräfte, einzelne Arbeitnehmer oder
Arbeitsgruppen und Teams innerhalb eines Unternehmens angeboten. Auch
Auszubildende können von dieser Form der betrieblichen Bildung profitieren.
Bisher sind nur Trainings mit sehenden Menschen bekannt. Jedoch befinden sich
unter den Arbeitnehmern, die von den Umgestaltungen in den Unternehmen
betroffen sind und die den neuen Anforderungen genügen müssen, auch viele
Blinde und Sehbehinderte. Es ist verwunderlich, dass diese erfolgversprechende
Methode für diese Zielgruppe noch nicht eingesetzt oder wissenschaftlich
untersucht wurde.
Ob ein Outdoor-Training auch für die Zielgruppe blinder und sehbehinderter
Auszubildender eine durchführbare und wirksame Bildungsmaßnahme darstellt,
wurde deshalb im Rahmen dieser Arbeit erforscht. Dazu wurde ein Outdoor-
Training für blinde und sehbehinderte Auszubildende konzipiert, durchgeführt und
ausgewertet.
Nach einer theoretischen Einführung in das Outdoor-Training und die Begriffe
Blindheit und Sehbehinderung, wird der Stand der Forschung zum Thema
Outdoor-Training mit blinden und sehbehinderten Menschen gesichtet. Im
Anschluss erfolgt eine ausführliche Beschreibung der Methodik dieser
Untersuchung. Die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation stehen am
Ende der Arbeit.
Diese Arbeit verwendet zur leichteren Lesbarkeit lediglich die männliche Form, es wird von Teilnehmer, Mitarbeiter, Arbeitnehmer usw. gesprochen. Natürlich sind
damit auch alle Teilnehmerinnen, Mitarbeiterinnen, Arbeitnehmerinnen etc.
gemeint!
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen zum Thema
- 2.1. Outdoor-Training
- 2.1.1. Entwicklungslinien
- 2.1.2. Outdoor-Training und Erlebnispädagogik
- 2.1.3. Begriffsbestimmungen
- 2.1.4. Abgrenzung zu anderen Formen von Outdoor-Aktivitäten
- 2.1.5. Merkmale von Outdoor-Trainings
- 2.1.6. Programmtypen von Outdoor-Trainings
- 2.1.7. Prinzipien von Outdoor-Trainings
- 2.1.8. Zielgruppen und Zielsetzungen von Outdoor-Trainings
- 2.1.9. Wirkungsweisen von Outdoor-Trainings
- 2.2. Blindheit und Sehbehinderung
- 2.1. Outdoor-Training
- 3. Stand der Forschung zum Thema Outdoor-Training mit Blinden und Sehbehinderten
- 3.1. Arbeiten zu Erlebnispädagogik mit Sehgeschädigten
- 3.2. Studien zur Wirksamkeit von Outdoor-Trainings
- 4. Methodik und Fragestellungen
- 4.1. Ziel der Forschungsmethodik
- 4.2. Schaffung von Rahmenbedingungen
- 4.3. Gegenstand und Fragestellung der Untersuchung
- 4.4. Operationalisierung der Fragestellungen
- 4.5. Informationsquellen
- 4.6. Methoden und Instrumente zur Datenerhebung
- 5. Beschreibung der Methodik im Einzelnen
- 5.1. TeilnehmerInnen des Trainings
- 5.2. Stichprobe der angewendeten Forschungsmethodik
- 5.3. Konzeption des Trainings
- 5.3.1. Einschätzung der Teilnehmer
- 5.3.2. Zielsetzungen des Trainings
- 5.3.3. Rahmenbedingungen des Trainings
- 5.3.4. Vorbereitungen zur Programmplanung
- 5.3.5. Programmplanung
- 5.3.6. Trainingsprogramm
- 5.4. Durchführung des Trainings
- 5.4.1. Besonderheiten bei der Anleitung und Durchführung der Aktionen
- 5.4.2. Abänderung des Trainingsprogramms
- 5.5. Selbsteinschätzungsbögen
- 5.5.1. Konstruktion der Selbsteinschätzungsbögen
- 5.5.2. Durchführung der Befragung
- 5.5.3. Kritische Bemerkungen zur Befragung
- 5.6. Beobachtungen
- 5.6.1. Form der Beobachtungen
- 5.6.2. Durchführung der Beobachtungen
- 5.6.3. Kritische Bemerkungen zu den Beobachtungen
- 5.7. Interviews
- 5.7.1. Gründe für die Auswahl dieses Interviewtypus
- 5.7.2. Konstruktion der Leitfäden
- 5.7.3. Durchführung der Interviews
- 5.7.4. Kritische Bemerkungen zum Interview
- 6. Ergebnisse
- 6.1. Ergebnisse im Hinblick auf die Durchführbarkeit
- 6.1.1. Auswertung der Beobachtungen
- 6.1.2. Auswertung der Interviews
- 6.2. Ergebnisse im Hinblick auf die Wirksamkeit
- 6.2.1. Gruppenbezogene Ergebnisse
- 6.2.2. Teilnehmerbezogene Effekte
- 6.3. Kritische Bewertung der Durchführung auf der Basis der Interviewergebnisse und eigener Überlegungen
- 6.1. Ergebnisse im Hinblick auf die Durchführbarkeit
- 7. Interpretation der Ergebnisse und Erfahrungen aus dieser Untersuchung
- 7.1. Durchführbarkeit
- 7.2. Wirksamkeit
- 8. Schlusswort
- 9. Literaturverzeichnis
- 10. Abkürzungsverzeichnis
- 11. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob Outdoor-Training für blinde und sehbehinderte Auszubildende eine durchführbare und wirksame Bildungsmaßnahme darstellt. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Anwendung von Outdoor-Training in der beruflichen Bildung für diese Zielgruppe.
- Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen von Outdoor-Training und Erlebnispädagogik.
- Sie beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen blinder und sehbehinderter Auszubildender im Kontext von Outdoor-Aktivitäten.
- Die Arbeit untersucht die Durchführbarkeit und Wirksamkeit eines eigens konzipierten Outdoor-Trainings für blinde und sehbehinderte Auszubildende.
- Sie analysiert die Ergebnisse des Trainings anhand von Beobachtungen, Interviews und Selbsteinschätzungsbögen.
- Die Arbeit diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für die Praxis der beruflichen Bildung für blinde und sehbehinderte Menschen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Outdoor-Training für blinde und sehbehinderte Auszubildende ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Outdoor-Training und Erlebnispädagogik sowie die Besonderheiten der Zielgruppe blinder und sehbehinderter Menschen. Kapitel 3 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zum Thema Outdoor-Training mit blinden und sehbehinderten Menschen. Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Untersuchung, die sich auf die Konzeption, Durchführung und Auswertung eines eigens entwickelten Outdoor-Trainings für blinde und sehbehinderte Auszubildende konzentriert. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, die sich auf die Durchführbarkeit und Wirksamkeit des Trainings beziehen. Kapitel 6 interpretiert die Ergebnisse und diskutiert die Implikationen für die Praxis der beruflichen Bildung für blinde und sehbehinderte Menschen. Das Schlusswort fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Outdoor-Training, Erlebnispädagogik, blinde und sehbehinderte Auszubildende, berufliche Bildung, Inklusion, Barrierefreiheit, Durchführbarkeit, Wirksamkeit, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Teamarbeit, Kommunikation, Selbstvertrauen, Motivation, Handlungskompetenz, Empowerment, Partizipation, Forschungsmethodik, qualitative Forschung, quantitative Forschung, Beobachtung, Interview, Selbsteinschätzungsbogen, Empirische Forschung, Praxisrelevanz.
- Citation du texte
- Julia Heuß (Auteur), 2007, Outdoor-Training für blinde und sehbehinderte Auszubildende, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114838