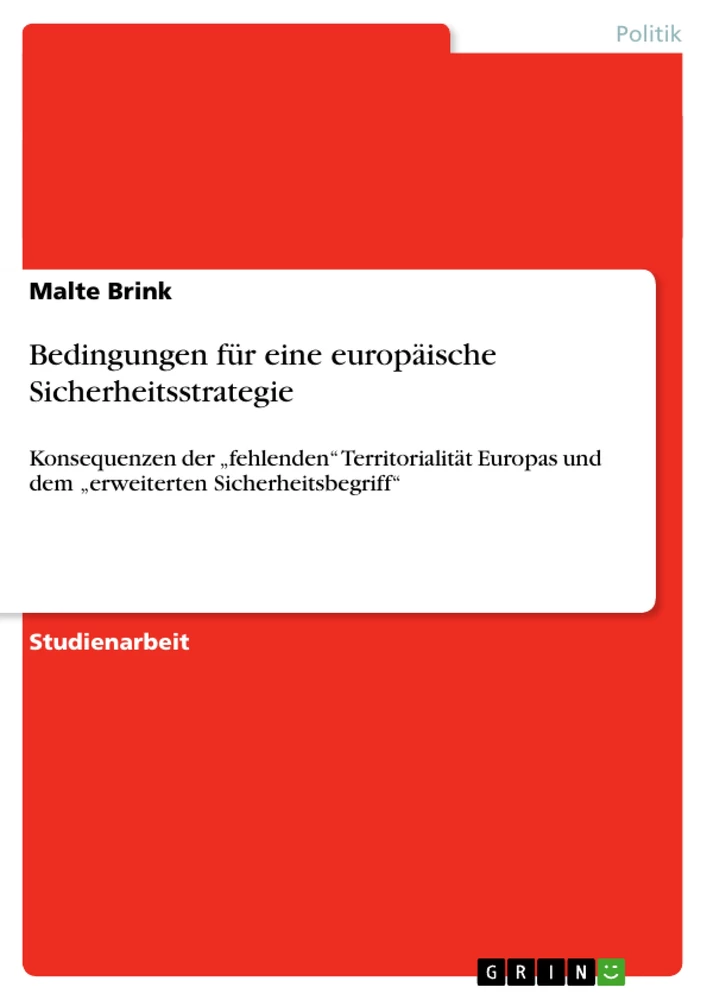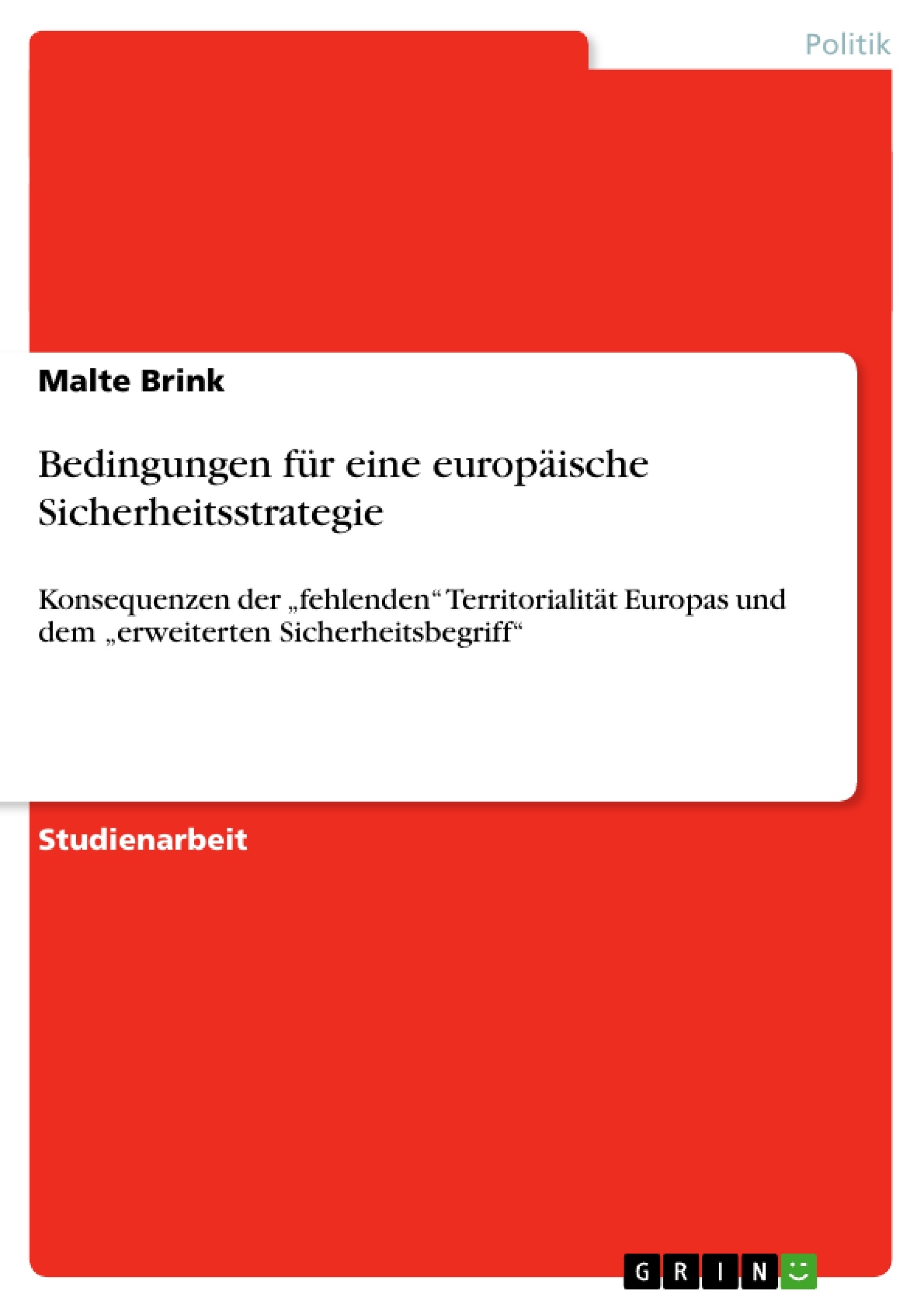In dieser Arbeit zunächst drei Perspektiven dargestellt mit deren Hilfe versucht werden kann Europa zu definieren. Geographische, kulturelle sowie politisch-institutionelle Besonderheiten Europas werden im zweiten Abschnitt dahingehend analysiert, inwieweit sich mit ihnen eine Aussage über die Territorialität Europas treffen lässt. Es wird demnach auf Fragen eingegangen wie: Wo liegen die natürlichen Grenzen Europas? Welche Staaten gehören zu Europa? Wo endet Europa? Welche Kriterien lassen sich finden um Europa zu definieren? Solche Fragen werden vor allem in der Diskussion um die Erweiterung der Europäischen Union immer wieder gestellt. Dass sie aber auch eine ebenso hohe Bedeutung für die Sicherheitspolitik in Europa haben, soll durch eine Auseinandersetzung mit dem „erweiterten Sicherheitsbegriff“ im dritten Abschnitt deutlich werden. Denn Sicherheitspolitik beschäftigt sich nicht zuletzt mit dem Schutz eines Territoriums. Wenn dieses Territorium für Europa allerdings nicht eindeutig definiert wird oder werden kann und wenn die Risiken, durch die die Sicherheit in Europa gefährdet wird, ebenfalls komplexer und vielschichtiger geworden sind, dann sind dies grundlegende Bedingungen für eine europäische Sicherheitsstrategie. Denkbare Schlussfolgerungen, die sich aus dem „Fehlen“ eines europäischen Territoriums und dem „erweiterten Sicherheitsbegriff“ in Bezug auf Akteure, Ziele, Risiken, Mittel und Zweck der europäischen Sicherheitspolitik ziehen lassen, werden im vierten Teil der Arbeit abschließend dargestellt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schwierigkeiten Europas Territorium zu definieren
- Der erweiterte Sicherheitsbegriff
- Schlussfolgerungen
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Bedingungen für eine europäische Sicherheitsstrategie. Sie analysiert die Schwierigkeiten, Europas Territorium zu definieren, und die Auswirkungen des „erweiterten Sicherheitsbegriffs“ auf die Gestaltung einer gemeinsamen Sicherheitspolitik.
- Definition des europäischen Territoriums
- Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“
- Akteure, Ziele und Risiken der europäischen Sicherheitspolitik
- Mittel und Zweck der europäischen Sicherheitspolitik
- Die Rolle der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der europäischen Sicherheitsstrategie im Kontext der deutschen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union im Jahr 2007 dar. Sie beleuchtet die vielschichtigen sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen die EU gegenübersteht, und die Notwendigkeit, die Bedingungen für eine adäquate Reaktion zu analysieren.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Schwierigkeiten, Europas Territorium zu definieren. Es werden geographische, kulturelle und politisch-institutionelle Aspekte beleuchtet, die eine eindeutige Identifizierung Europas erschweren. Die Diskussion um die Ostgrenze Europas und die Frage nach der Zugehörigkeit verschiedener Staaten werden anhand von historischen und geographischen Argumenten beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert den „erweiterten Sicherheitsbegriff“ und seine Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsstrategie. Es wird deutlich, dass die Sicherheitsbedrohungen für Europa komplexer und vielschichtiger geworden sind und sich nicht mehr auf ein klar definiertes Territorium beschränken lassen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die europäische Sicherheitsstrategie, die Territorialität Europas, den „erweiterten Sicherheitsbegriff“, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die Herausforderungen der Sicherheitspolitik, die Rolle der EU, die Identitätsfindung Europas und die Bedeutung der geographischen, kulturellen und politisch-institutionellen Faktoren für die Gestaltung einer europäischen Sicherheitsstrategie.
- Quote paper
- Malte Brink (Author), 2007, Bedingungen für eine europäische Sicherheitsstrategie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114823