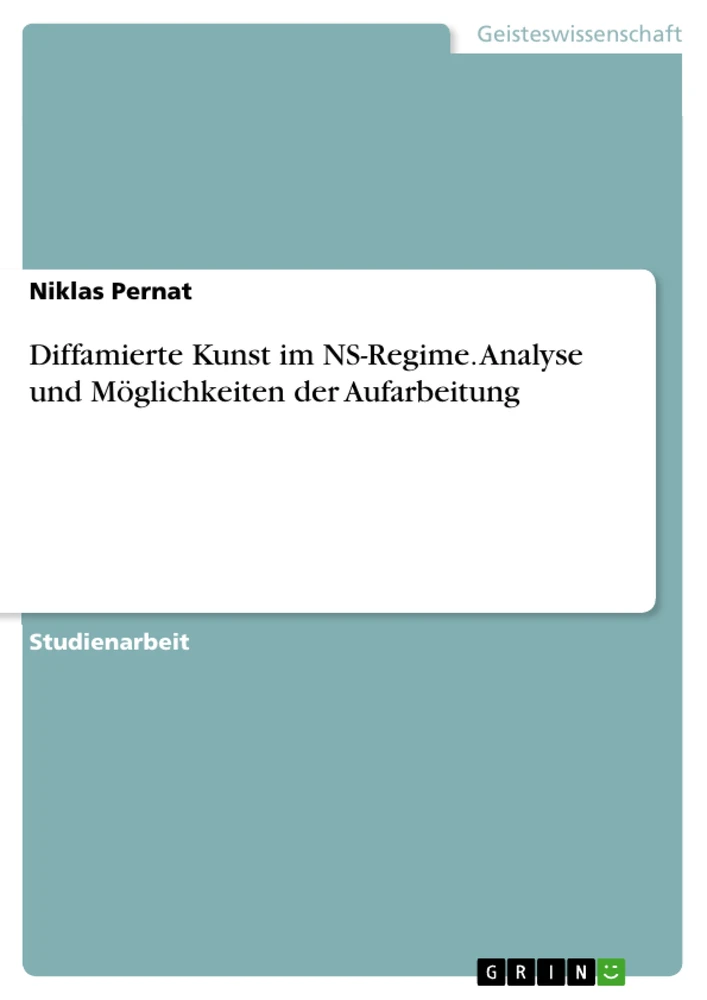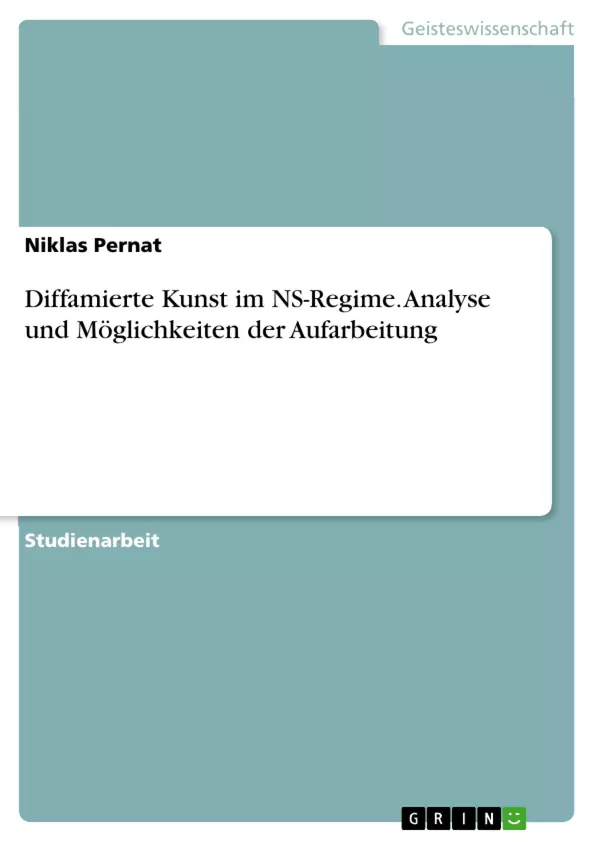Wie wurde mit diffamierter Kunst nach der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland umgegangen? Fand eine kritische Aufarbeitung oder eine affektive Verdrängung statt? Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es zunächst einer genaueren Betrachtung der Funktionsmechanismen zur Ästhetisierung des Politischen im Naziregime. Die Prägung des kulturellen und nationalen Gedächtnisses ist dabei von zentraler Rolle. Walter Benjamin formulierte hier als Kulturkritiker dieser Epoche bereits umfangreiche Einblicke in die Medienkultur der NS-Zeit. Außerdem betont Benjamin die Implikation von Kunst, und der Kunstproduktion, in gesellschaftlichen Verhältnissen. Eine wichtige Erkenntnis, wenn es um die Frage nach Verdrängung oder Aufarbeitung geht. War der Mensch in der Lage, jene Umstände, auf die Benjamin aufmerksam machte, zu erkennen und aufzuarbeiten? Hierfür wird sich diese Arbeit vor allem auf die Berliner und Münchner Institutionen im Nachkriegsdeutschland sowie auf den Umgang mit „entarteter“ Kunst heute stützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung / Fragestellung
- 1 Funktionsmechanismen der politischen Ästhetisierung im Naziregime
- 1. Funktionsmechanismen einer nationalsozialistischen Kulturpolitik
- 2 Umgang mit „entarteter Kunst“ nach dem 2. Weltkrieg
- 3 Wege aus der Instrumentalisierung von Kunst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit diffamierter Kunst nach dem Nationalsozialismus in Deutschland. Sie analysiert, ob eine kritische Aufarbeitung oder eine Verdrängung stattfand und beleuchtet die Funktionsmechanismen der Ästhetisierung des Politischen im Naziregime. Die Rolle des kulturellen und nationalen Gedächtnisses im Kontext der Kunst und ihrer Instrumentalisierung wird dabei zentral betrachtet. Die Arbeit stützt sich auf Berliner und Münchner Institutionen sowie auf den heutigen Umgang mit „entarteter“ Kunst.
- Funktionsmechanismen der nationalsozialistischen Kulturpolitik
- Umgang mit „entarteter Kunst“ nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Rolle des kulturellen und nationalen Gedächtnisses
- Möglichkeiten der Aufarbeitung diffamierter Kunst
- Das Potential der Kunst zur gesellschaftlichen Veränderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung / Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Umgang mit diffamierter Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht, ob eine kritische Aufarbeitung oder eine Verdrängung stattfand und kündigt den Fokus auf die Funktionsmechanismen der Ästhetisierung des Politischen im Naziregime an. Die Arbeit wird sich dabei auf Berliner und Münchner Institutionen und den heutigen Umgang mit „entarteter“ Kunst stützen. Die These ist, dass die Verhältnisse der Kunst aufgearbeitet werden können und wandelbar sind, gestützt durch das Potential der Kunst selbst. Der Ausblick verweist auf Bertolt Brechts episches Theater als Modell für eine Handlungsfähigkeit, die den Ausbruch aus künstlerischer Instrumentalisierung ermöglicht.
1 Funktionsmechanismen der politischen Ästhetisierung im Naziregime: Dieses Kapitel analysiert die Mechanismen der nationalsozialistischen Kulturpolitik, beginnend mit der Ernennung Wilhelm Fricks zum Minister 1930. Es beschreibt die Verbote von Kulturgütern in verschiedenen Bereichen (Musik, Literatur, Theater, Film, Malerei) und die Prägung eines völkischen Kulturbildes. Die Arbeit bezieht sich auf Sigmund Freud und Walter Benjamin, um das repressive Potential von Kultur und die Erfahrungsarmut zu beleuchten, die zur Entstehung moderner Kunst beitrug. Der Einfluss des nationalen und kulturellen Gedächtnisses nach Assmann wird diskutiert, mit dem Fokus auf die Ausgrenzung anderer kultureller Formen durch die Manifestation einer politischen Leitkultur. Die Archivierung und die mediale Verwirklichung als konstitutive Elemente des kulturellen Gedächtnisses werden erläutert, und die unvermeidliche Ausgrenzung anderer kultureller Formen durch eine konkrete Definition der Kultur wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Diffamierte Kunst, Nationalsozialismus, Verdrängung, Aufarbeitung, Kulturelles Gedächtnis, Nationales Gedächtnis, Politische Ästhetisierung, „Entartete Kunst“, Kulturpolitik, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Institutionen, Kunst und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Umgang mit diffamierter Kunst nach dem Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Umgang mit als „entartete Kunst“ diffamierten Werken nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Sie analysiert kritisch, ob eine Aufarbeitung oder eher eine Verdrängung dieser Kunst stattfand und beleuchtet die Mechanismen der politischen Ästhetisierung im NS-Regime. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle des kulturellen und nationalen Gedächtnisses im Kontext der Kunst und ihrer Instrumentalisierung.
Welche Institutionen und den heutigen Umgang mit „entarteter Kunst“ werden betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf Berliner und Münchner Institutionen und untersucht den heutigen Umgang mit Kunst, die im Nationalsozialismus als „entartet“ diffamiert wurde.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie wurde mit diffamierter Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen? Wurde eine kritische Aufarbeitung betrieben oder erfolgte eine Verdrängung? Die Arbeit untersucht weiter die Funktionsmechanismen der politischen Ästhetisierung im Nationalsozialismus und die Rolle des kulturellen und nationalen Gedächtnisses.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Funktionsmechanismen der nationalsozialistischen Kulturpolitik, den Umgang mit „entarteter Kunst“ nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rolle des kulturellen und nationalen Gedächtnisses, Möglichkeiten der Aufarbeitung diffamierter Kunst und das Potential der Kunst zur gesellschaftlichen Veränderung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit der Forschungsfrage und These, ein Kapitel über die Funktionsmechanismen der politischen Ästhetisierung im Naziregime (inkl. Analyse der nationalsozialistischen Kulturpolitik und Bezug auf Freud und Benjamin), und ein Kapitel zum Umgang mit „entarteter Kunst“ nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Ausblick verweist auf Bertolt Brechts episches Theater als Modell für eine Handlungsfähigkeit, die den Ausbruch aus künstlerischer Instrumentalisierung ermöglicht.
Welche Rolle spielen Walter Benjamin und Bertolt Brecht in der Arbeit?
Sigmund Freud und Walter Benjamin werden herangezogen, um das repressive Potential von Kultur und die Erfahrungsarmut zu beleuchten, die zur Entstehung moderner Kunst beitrug. Bertolt Brechts episches Theater dient als Modell für eine Handlungsfähigkeit, die den Ausbruch aus künstlerischer Instrumentalisierung ermöglicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Diffamierte Kunst, Nationalsozialismus, Verdrängung, Aufarbeitung, Kulturelles Gedächtnis, Nationales Gedächtnis, Politische Ästhetisierung, „Entartete Kunst“, Kulturpolitik, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Institutionen, Kunst und Gesellschaft.
Welche These vertritt die Arbeit?
Die Arbeit vertritt die These, dass die Verhältnisse der Kunst aufgearbeitet werden können und wandelbar sind, gestützt durch das Potential der Kunst selbst.
- Quote paper
- Niklas Pernat (Author), 2021, Diffamierte Kunst im NS-Regime. Analyse und Möglichkeiten der Aufarbeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1147867