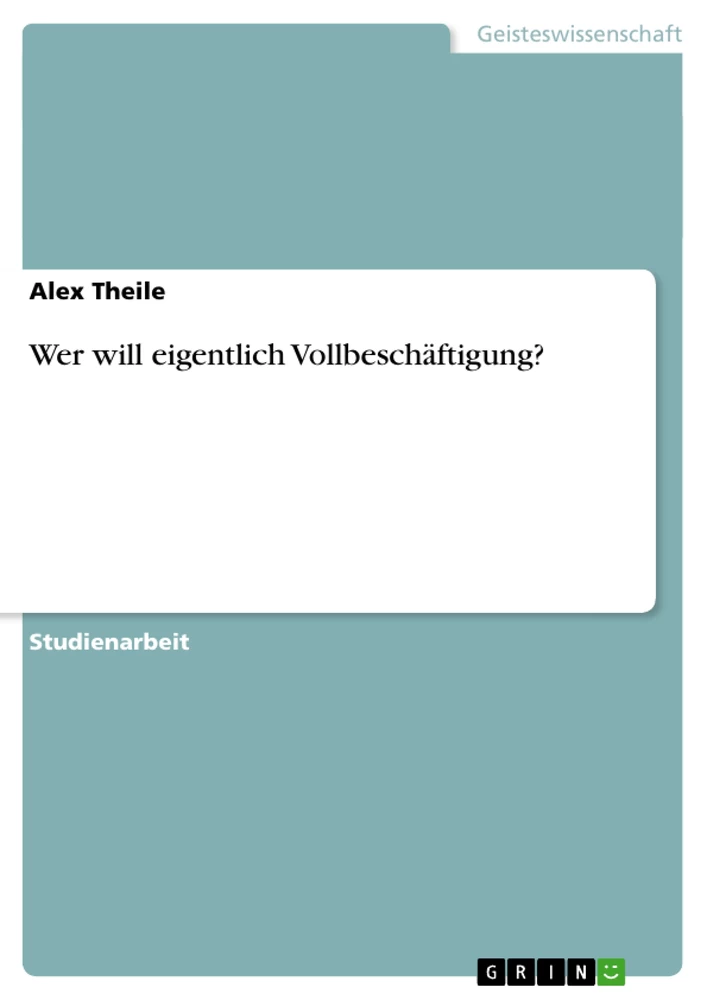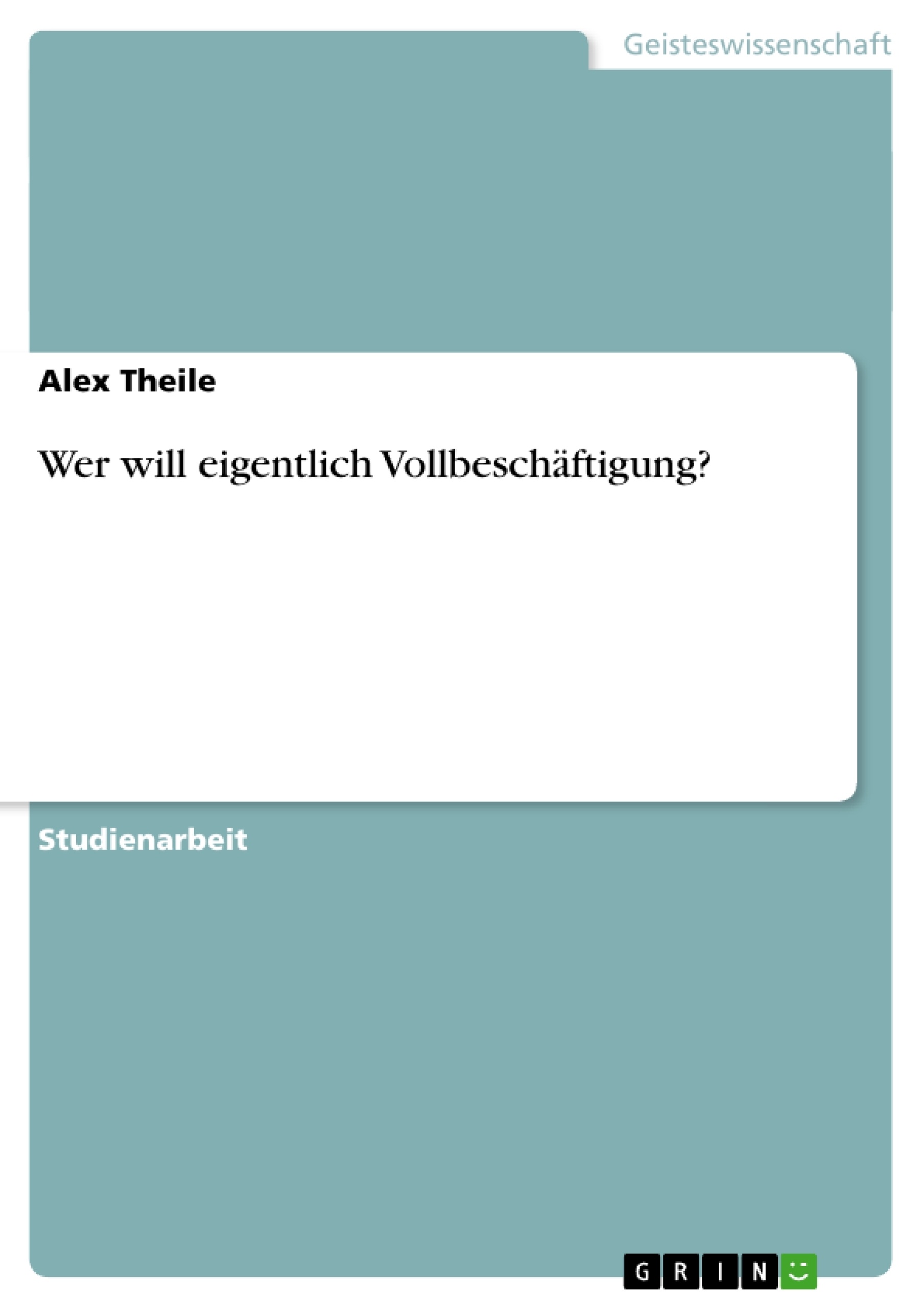Eines der wohl fundamentalsten Themen unserer und vergangener Gesellschaften ist das Problem der Erwerbsbeschäftigung. Erwerbsbeschäftigung soll heißen, dass jeder, der arbeitet, mindestens so viel Geld dafür bekommt, dass es zum Überleben reicht. Doch diese Auffassung ist in der modernen Gesellschaft wohl kaum noch zu vertreten. Nach dem 2. Weltkrieg stieg der Bedarf, nicht nur an Grundgütern, sondern auch an Luxusgütern. Solch ein Anstieg resultiert aus einer sich stark entwickelnden Wirtschaft. Jedoch zeigt die Geschichte, dass Wirtschaft nicht als Fundament und dauerhaft stabil gesehen werden darf.
Vielmehr ist zu erkennen, dass mit der Ölkrise in den 1970ern ein neues Problem auf die Gesellschaft und ihre Verantwortlichen zukam, die Massenarbeitslosigkeit. In den vergangenen Jahrzehnten bis in die Gegenwart wurden Konzepte erarbeitet, diese Erscheinung in Grenzen zu halten.
Ein sich daraus ergebendes Ziel war die Vollbeschäftigung. Nun gibt es verschiedenste Auffassungen von Vollbeschäftigung. Im Verlauf des Textes wird auf folgende Fragen eingegangen: Was ist eigentlich Vollbeschäftigung? Daraus resultierend: wird Vollbeschäftigung eigentlich noch gewollt? Welche Effekte hat Vollbeschäftigung auf einzelne Institutionen? Und schließlich: Gibt es eine Möglichkeit Vollbeschäftigung zu erzeugen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist eigentlich Vollbeschäftigung?
- 2.1. Definition (die Allgemeine)
- 2.2. Definition (die Grobe)
- 2.3. Definition (die Verfeinerte)
- 2.4. Definition (die Unvollkommene)
- 2.5. Definition (die Letzte)
- 3. Vollbeschäftigung das Ziel?
- 3.1. Kapitaleigner
- 3.2. Unternehmer
- 3.3. Unternehmerverbände
- 3.4. Gewerkschaften
- 3.5. Empfänger von Sozialleistungen
- 3.6. Politische Vertreter
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff der Vollbeschäftigung und hinterfragt dessen Relevanz und Definition in der modernen Gesellschaft. Sie analysiert unterschiedliche Auffassungen von Vollbeschäftigung und deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Akteure.
- Definitionen von Vollbeschäftigung
- Wunsch nach Vollbeschäftigung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
- Auswirkungen von Vollbeschäftigung auf Institutionen
- Möglichkeiten zur Erzeugung von Vollbeschäftigung
- Die Rolle der Arbeitslosigkeit in verschiedenen Gesellschaftssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das zentrale Thema der Arbeit ein – die Erwerbsbeschäftigung und das Konzept der Vollbeschäftigung. Sie stellt die historische Entwicklung dar, beginnend mit dem Bedarf an Gütern nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zum Auftreten von Massenarbeitslosigkeit in den 1970er Jahren. Die Einleitung benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit, die sich mit verschiedenen Definitionen von Vollbeschäftigung, dem Wunsch nach Vollbeschäftigung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und den Möglichkeiten ihrer Erzeugung befassen.
2. Was ist eigentlich Vollbeschäftigung?: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von Vollbeschäftigung, beginnend mit einer einfachen, ungenauen Definition ("Wenn jeder Arbeit hat") und fortschreitend zu komplexeren, die Aspekte wie ehrenamtliche Tätigkeiten, Hausfrauen, Rentner und Arbeitsunfähige berücksichtigen. Die Arbeit kritisiert die bestehenden Definitionen und zeigt deren Schwächen auf, insbesondere die Schwierigkeit, eine Definition zu finden, die die Realität des Arbeitsmarktes adäquat widerspiegelt. Sie führt schliesslich zur Diskussion einer "Quasi-Vollbeschäftigung", die eine bestimmte, akzeptierte Arbeitslosenquote miteinbezieht.
3. Vollbeschäftigung das Ziel?: In diesem Kapitel untersucht die Arbeit die Perspektive verschiedener gesellschaftlicher Gruppen auf das Ziel der Vollbeschäftigung. Es werden die Standpunkte von Kapitaleignern, Unternehmern, Unternehmerverbänden, Gewerkschaften, Empfängern von Sozialleistungen und politischen Vertretern analysiert und verglichen. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interessen und Motivationen der einzelnen Gruppen im Hinblick auf Vollbeschäftigung und zeigt die Komplexität des Themas auf.
Schlüsselwörter
Vollbeschäftigung, Arbeitslosigkeit, Definitionen, Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Akteure, Kapital, Unternehmer, Gewerkschaften, Sozialleistungen, ökonomische Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, konjunkturelle Arbeitslosigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vollbeschäftigung - Eine Analyse
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Vollbeschäftigung. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse unterschiedlicher Definitionen von Vollbeschäftigung, der Betrachtung verschiedener Perspektiven gesellschaftlicher Akteure und der Hinterfragung der Relevanz des Ziels Vollbeschäftigung in der modernen Gesellschaft.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Was ist eigentlich Vollbeschäftigung?, 3. Vollbeschäftigung das Ziel?, 4. Schluss. Kapitel 2 analysiert verschiedene Definitionen von Vollbeschäftigung, während Kapitel 3 die Perspektiven verschiedener gesellschaftlicher Gruppen (Kapitaleigner, Unternehmer, Gewerkschaften etc.) auf das Thema beleuchtet. Die Einleitung führt in die Thematik ein und der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie definiert der Text Vollbeschäftigung?
Der Text untersucht nicht nur eine einzige Definition, sondern verschiedene, beginnend mit einfachen, ungenauen Definitionen bis hin zu komplexeren, die Aspekte wie ehrenamtliche Tätigkeiten, Hausfrauen und Arbeitsunfähige berücksichtigen. Er kritisiert die bestehenden Definitionen und zeigt deren Schwächen auf. Letztlich wird eine "Quasi-Vollbeschäftigung" diskutiert, welche eine akzeptierte Arbeitslosenquote miteinbezieht.
Welche gesellschaftlichen Akteure werden im Text betrachtet?
Der Text analysiert die Perspektiven verschiedener gesellschaftlicher Gruppen auf Vollbeschäftigung, darunter Kapitaleigner, Unternehmer, Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Empfänger von Sozialleistungen und politische Vertreter. Es werden deren unterschiedliche Interessen und Motivationen im Hinblick auf Vollbeschäftigung untersucht.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Die zentralen Themen sind die verschiedenen Definitionen von Vollbeschäftigung, der Wunsch nach Vollbeschäftigung in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die Auswirkungen von Vollbeschäftigung auf Institutionen, Möglichkeiten zur Erzeugung von Vollbeschäftigung und die Rolle der Arbeitslosigkeit in verschiedenen Gesellschaftssystemen.
Welche Schlüsselwörter werden im Text verwendet?
Wichtige Schlüsselwörter sind Vollbeschäftigung, Arbeitslosigkeit, Definitionen, Arbeitsmarkt, gesellschaftliche Akteure, Kapital, Unternehmer, Gewerkschaften, Sozialleistungen, ökonomische Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und konjunkturelle Arbeitslosigkeit.
Für wen ist dieser Text bestimmt?
Der Text ist für ein akademisches Publikum bestimmt und eignet sich besonders für Studierende und Forscher, die sich mit dem Thema Vollbeschäftigung und den damit verbundenen sozioökonomischen Fragen befassen.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema?
Der Text selbst bietet keine expliziten Quellenangaben oder weiterführende Literatur. Weitere Informationen können jedoch über wissenschaftliche Datenbanken und Fachliteratur zum Thema Arbeitsmarktökonomie und Soziologie recherchiert werden.
- Quote paper
- Alex Theile (Author), 2003, Wer will eigentlich Vollbeschäftigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11476