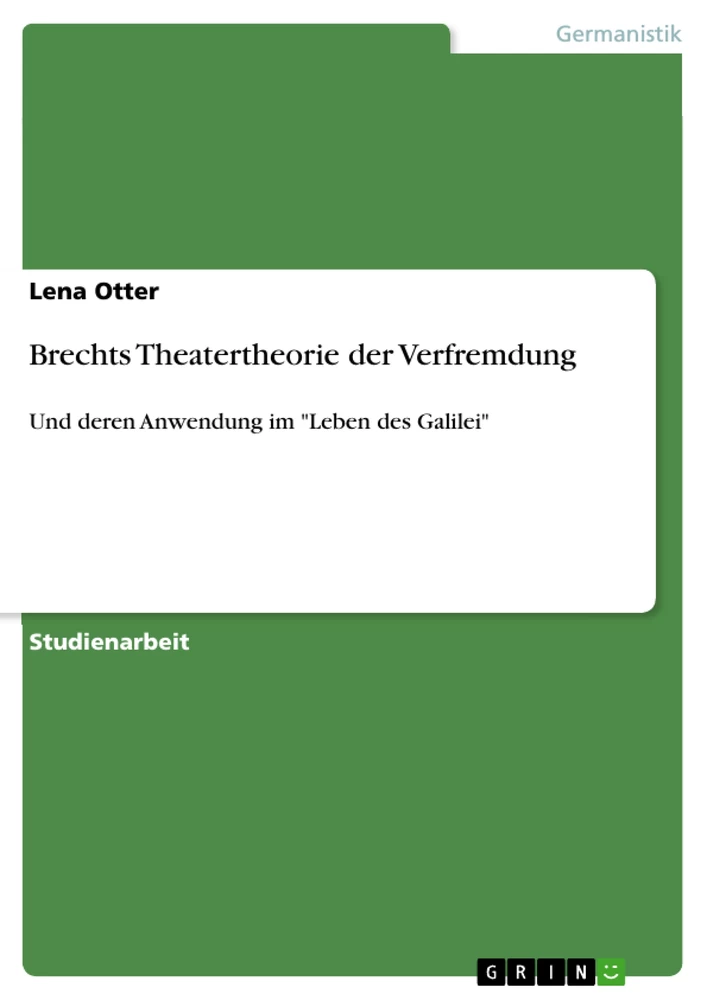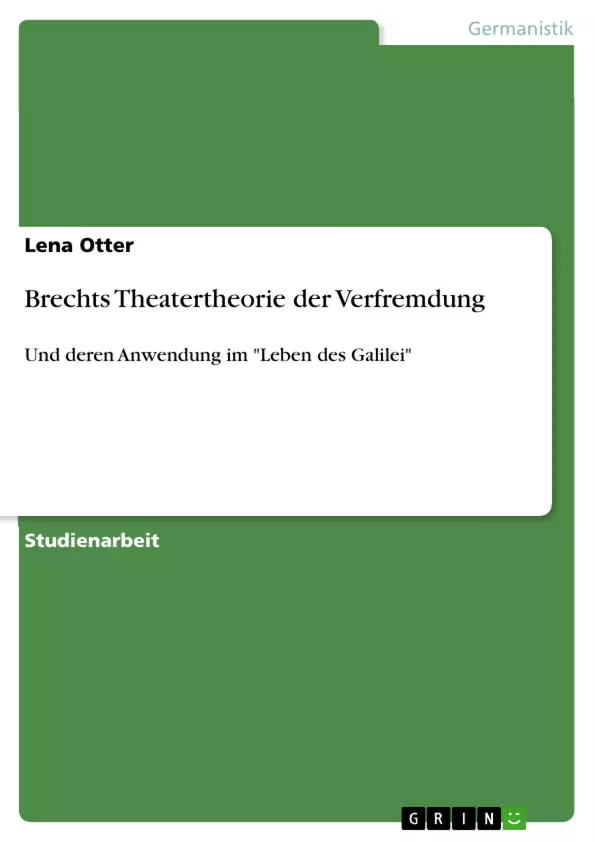Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit möchte ich mich den Konsequenzen widmen, die Brecht vollzieht: dem radikalen Bruch mit der Tradition der Dramatik und Erarbeitung einer Dramentheorie, die er selbst episch oder anti-aristotelisch nennt.
Der zweite Teil versucht die Frage zu beantworten, in wieweit sich diese Theorie in der Umsetzung des Leben des Galilei widerspiegelt, einem Stück, das von den bürgerlichen Kritikern des brechtschen V-Effektes gerade wegen dessen scheinbaren Fehlen positiv rezensiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Kritik des aristotelischen Theaters
- Theorie der Verfremdung
- Mittel der Verfremdung
- Historisierung
- Unterhaltungstheater - Lehrtheater
- Leben des Galilei – Entstehung
- Epische Elemente in Leben des Galilei
- Historisierung in Leben des Galilei
- Einfühlung und Distanz in Leben des Galilei
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Bertolt Brechts Theatertheorie der Verfremdung und deren Anwendung in seinem Drama "Leben des Galilei". Die Zielsetzung besteht darin, Brechts radikale Abkehr vom aristotelischen Theater zu analysieren und zu beleuchten, wie diese Theorie in einem konkreten Werk umgesetzt wird. Dabei wird insbesondere der scheinbare Widerspruch zwischen Brechts Theorie und der positiven Rezeption des Stücks durch bürgerliche Kritiker betrachtet.
- Brechts Kritik des aristotelischen Theaters und der Katharsis
- Die Theorie der Verfremdung als Mittel zur kritischen Distanzierung
- Die Umsetzung epischer Elemente in "Leben des Galilei"
- Das Spannungsfeld zwischen Einfühlung und Distanz im Stück
- Der Vergleich zwischen Unterhaltungs- und Lehrtheater
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung stellt Brechts Überzeugung vor, dass das Theater ein "praktikables Weltbild" vermitteln soll. Sie kritisiert die bestehende Theaterlandschaft als ungeeignet, aktuelle Probleme darzustellen, und kündigt die Analyse von Brechts radikalem Bruch mit der Tradition und seiner epischen Dramentheorie an. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Umsetzung dieser Theorie in "Leben des Galilei" und dem scheinbar positiven Empfang des Stücks durch bürgerliche Kritiker, trotz des vermeintlichen Fehlens des V-Effekts.
Kritik des aristotelischen Theaters: Dieses Kapitel analysiert Brechts Kritik am aristotelischen Theater, die sich weniger gegen die drei Einheiten richtet, sondern gegen die Katharsis und die damit verbundene Identifikation des Zuschauers mit dem Dargestellten. Brecht sieht in der Einfühlung ein Hindernis für die kritische Reflexion und plädiert für Distanz als Voraussetzung für eine kritische Betrachtung. Er betont, dass der Verzicht auf Einfühlung nicht gleichbedeutend mit einem Verzicht auf Emotionen ist, sondern eher eine "Akzent- oder Gewichtsverschiebung" darstellt.
Theorie der Verfremdung: Dieses Kapitel beschreibt Brechts Theorie der Verfremdung als Mittel zur kritischen Distanzierung des Zuschauers. Brecht strebt an, das scheinbar Natürliche auffällig zu machen und den Zuschauer zum Denken und Handeln anzuregen. Die Verfremdung soll Neugier und Staunen auslösen und das Verhalten der Figuren nicht als einzig mögliche Reaktion, sondern als eine von vielen präsentieren. Der Gegensatz zum dramatischen Theater wird herausgestellt: Während dieses zur Identifikation einlädt, fordert das epische Theater zur aktiven Auseinandersetzung auf.
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, Theatertheorie, Verfremdungseffekt, episches Theater, aristotelisches Theater, Katharsis, Einfühlung, Distanz, "Leben des Galilei", Mimesis, kritische Reflexion, politische Handlungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Leben des Galilei" und Brechts Theatertheorie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Bertolt Brechts Theatertheorie der Verfremdung und deren Anwendung in seinem Drama "Leben des Galilei". Sie untersucht Brechts Kritik am aristotelischen Theater, die Theorie der Verfremdung als Mittel zur kritischen Distanzierung und die Umsetzung epischer Elemente in "Leben des Galilei". Ein besonderer Fokus liegt auf dem scheinbaren Widerspruch zwischen Brechts Theorie und der positiven Rezeption des Stücks durch bürgerliche Kritiker.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Brechts Kritik am aristotelischen Theater und der Katharsis; die Theorie der Verfremdung als Mittel zur kritischen Distanzierung; die Umsetzung epischer Elemente in "Leben des Galilei"; das Spannungsfeld zwischen Einfühlung und Distanz im Stück; und der Vergleich zwischen Unterhaltungs- und Lehrtheater.
Was ist Brechts Kritik am aristotelischen Theater?
Brechts Kritik richtet sich weniger gegen die drei Einheiten des aristotelischen Theaters, sondern vor allem gegen die Katharsis und die damit verbundene Identifikation des Zuschauers mit dem Dargestellten. Er sieht in der Einfühlung ein Hindernis für die kritische Reflexion und plädiert für Distanz als Voraussetzung für eine kritische Betrachtung. Der Verzicht auf Einfühlung bedeutet für Brecht keine Verweigerung von Emotionen, sondern eine "Akzent- oder Gewichtsverschiebung".
Was ist die Theorie der Verfremdung?
Die Verfremdungstheorie dient der kritischen Distanzierung des Zuschauers. Durch Verfremdungseffekte soll das scheinbar Natürliche auffällig gemacht und der Zuschauer zum Denken und Handeln angeregt werden. Die Verfremdung soll Neugier und Staunen auslösen und das Verhalten der Figuren nicht als einzig mögliche Reaktion, sondern als eine von vielen präsentieren. Im Gegensatz zum dramatischen Theater, das zur Identifikation einlädt, fordert das epische Theater zur aktiven Auseinandersetzung auf.
Wie werden epische Elemente in "Leben des Galilei" umgesetzt?
Die Arbeit analysiert die Umsetzung epischer Elemente in "Leben des Galilei", indem sie Historisierung, die Mittel der Verfremdung und den Umgang mit Einfühlung und Distanz im Stück untersucht. Dies wird im Kontext von Brechts Gesamtwerk und seiner Theatertheorie betrachtet.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beleuchtet den scheinbar positiven Empfang des Stücks durch bürgerliche Kritiker trotz des vermeintlichen Fehlens des V-Effekts (Verfremdungseffekt). Es wird reflektiert, wie Brechts radikale Abkehr vom aristotelischen Theater in einem konkreten Werk umgesetzt wurde und welche Bedeutung dies für das Verständnis von Brechts Theatertheorie hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bertolt Brecht, Theatertheorie, Verfremdungseffekt, episches Theater, aristotelisches Theater, Katharsis, Einfühlung, Distanz, "Leben des Galilei", Mimesis, kritische Reflexion, politische Handlungsfähigkeit.
- Citation du texte
- Lena Otter (Auteur), 2004, Brechts Theatertheorie der Verfremdung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114767