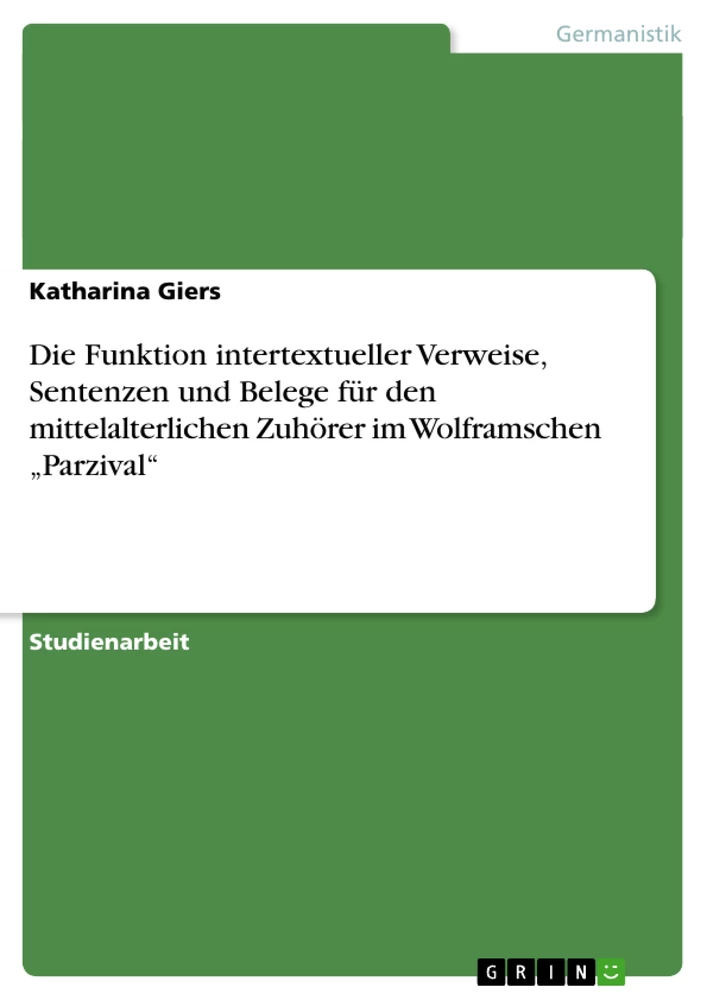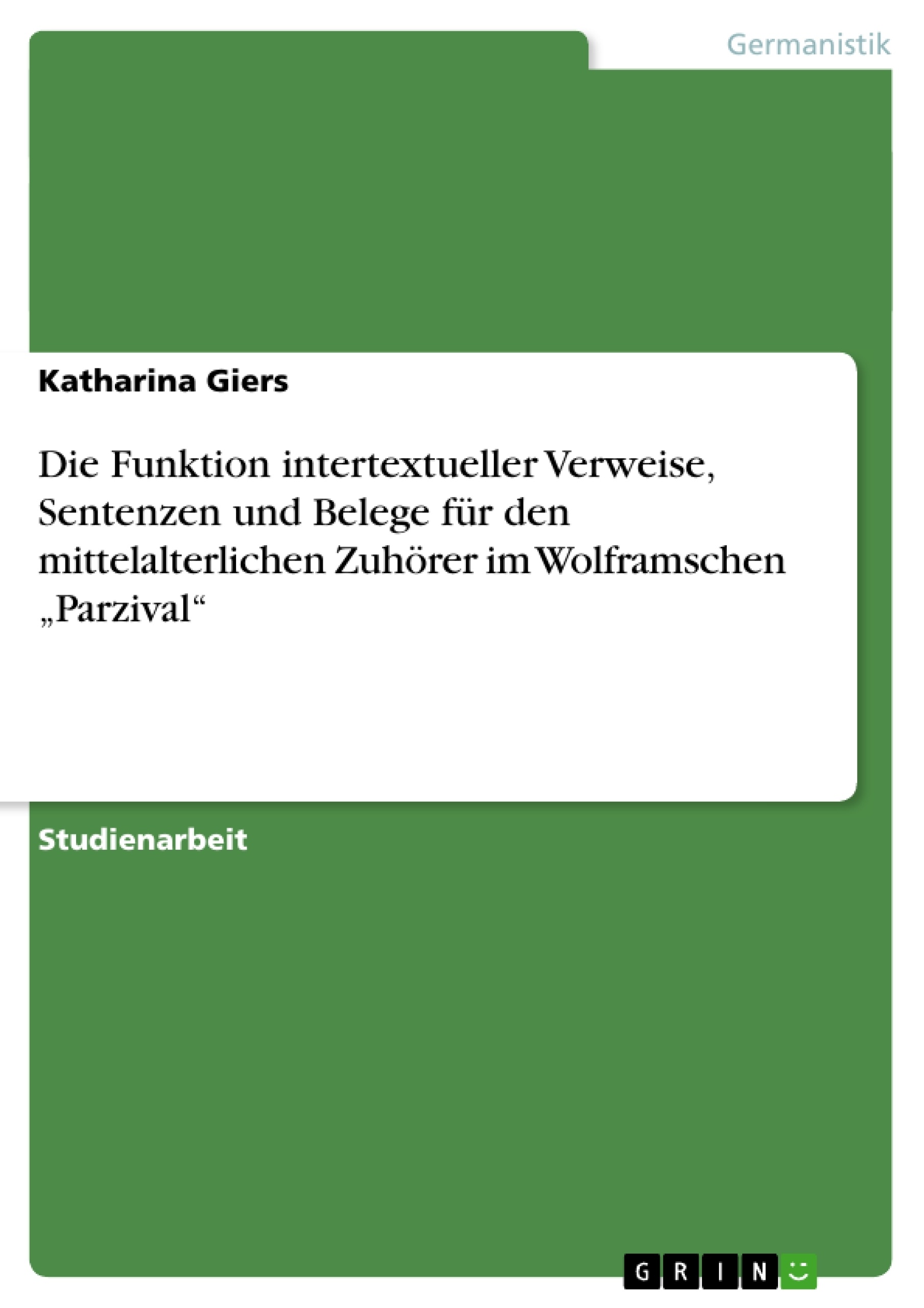Im folgenden Teil meiner Hauptseminarsarbeit möchte ich gern die Funktionen der mittelalterlichen Literatur und ihre Wirkung auf den Zuschauer am Beispiel des Wolframschen „Parzival“ analysieren und erläutern.
Dem realen, sowie auch dem fiktiven Zuschauer soll hierbei eine besondere Aufmerksamkeit zugesprochen werden, da sich erst aus seiner Wissens- und Handlungsperspektive die Absichten, die der Autor bezweckt, entfalten können. Der Zuschauer gilt folglich als Adressat der zweckgebundenen Literatur.
Gern möchte ich die Termini Zuhörer und Leser synonym verwenden, da, wie in Kapitel I. 2 beschrieben werden soll, die Leserschaft nur einen sehr geringen Prozentsatz darstellt und die Zuhörerschaft folglich vordergründig behandelt werden muss – die Funktionen der Literatur aber gleichermaßen auf das entsprechende Auditorium wirken.1
Ziel meiner Arbeit ist es, nachzuweisen, dass mittelalterliche Literatur immer an einen Zweck gebunden war und intertextuelle Verweise und Sentenzen, sowie Belege und Einschübe, zur Gemeinschaftsstiftung notwendig und dienlich waren.
Mein Interesse gilt hier dem „Parzival“, weil ich bei meinem ersten Lesen dieses mittelalterlichen Romans sehr bewusst und eindeutig feststellen konnte, dass Wolfram ein Spiel mit seinen Zuschauern anstrebt und sie ins Handlungsgeschehen einbindet. Sie werden zu Mitspielern auf einer Basis der Gemeinsamkeit; sie erfüllen in der Handlung eine sinnstiftende Funktion.
Wolfram strebt in seinem Werk deutlich die Bildung einer Zuhörergemeinschaft an, um in diesem Bunde miteinander agieren zu können. Dieses Vorgehen hat mir imponiert, so wie auch die zeitliche Einordnung, denn bereits um 1200 wurde folglich improvisierend Literatur vorgetragen. Nicht der sture Psalm- oder Bibelvortrag war am mittelalterlichen Hof vordergründig, wie oft vermutet wird, sondern das gemeinsame Literaturspektakel.
Hier sehe ich einen aktuellen Bezug zur Gegenwart der mich erstaunt. Auch heute wird der Improvisation viel Aufmerksamkeit zugemessen. In diversen Fernsehsendungen und Lesungen ist sie nämlich genau das, was angestrebt wird und was das Publikum erwartet.
Das dieses auch im Mittelalter der Fall war, beeindruckt mich und deshalb möchte ich mein Interesse auf den folgenden Seiten genau dieser Situation widmen.
Ich beziehe mich im Folgenden auf die überarbeitete Lachmann-Übersetzung sowie auf seine 16teilige Gliederung der Handlung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Das Werk und sein Publikum
- I. 1 Das Werk,,Parzival“ und seine Einordnung in der mittelalterlichen Literatur
- I. 2 Das höfische Publikum und der geistlichen Leser
- I. 3 Der reale und der fiktive Zuhörer…......
- I. 4 Die Erzählerinstanz
- I. 5 Die Vortragssituation um 1200..............
- II. Verweise, Einschübe, Sentenzen und Anspielungen im „Parzival“, sowie die damit
verbundene Funktion für den mittelalterlichen Zuhörer
- II. 1 Direkt den Vortrag und die Zuhörer betreffende Verweise
- II. 1. A Erzähler-Reden und Hörer-Anreden.......
- II. 2 Indirekt den Zuhörer betreffende Verweise
- II. 2. A Sachliche Erläuterungen und Sentenzen
- II. 2. B Literarische Anspielungen......
- II. 2. C Historische Verweise und politische Zusammenhänge.......
- II. 2. D,,Fachexpertenexkurse" und magische Motive......
- II. 2. E Geographische Bezüge und Orient-Belege
- II. 1 Direkt den Vortrag und die Zuhörer betreffende Verweise
- III. Der gewollte Umgang des Erzählers mit den Zuhörern der „Parzival“-Erzählung, sowie seine Ziele und Zwecke.
- Literaturverzeichnis:.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Funktion intertextueller Verweise, Sentenzen und Belege im Wolframschen „Parzival“ für den mittelalterlichen Zuhörer. Sie untersucht, wie diese Elemente zur Gemeinschaftsbildung und zur Einbindung des Publikums in die Handlung beitragen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des realen und fiktiven Zuschauers und zeigt auf, wie der Autor durch gezielte Anspielungen, Erläuterungen und Einschübe die Aufmerksamkeit und das Verständnis des Publikums gewinnt.
- Die Rolle des realen und fiktiven Zuschauers im „Parzival“
- Die Funktion intertextueller Verweise und Sentenzen für die Gemeinschaftsbildung
- Die Einbindung des Publikums in die Handlung durch gezielte Anspielungen und Erläuterungen
- Die Bedeutung der Vortragssituation im Mittelalter für die Rezeption des „Parzival“
- Die Ziele und Zwecke des Erzählers im Umgang mit seinem Publikum
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit dem Werk „Parzival“ und seiner Einordnung in die mittelalterliche Literatur. Es werden die Lebensumstände Wolframs von Eschenbach, die Entstehungszeit des Romans und seine Quellen beleuchtet. Zudem wird die Rolle des höfischen Publikums und der geistlichen Leser im Mittelalter erörtert. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des realen und fiktiven Zuschauers für die Rezeption des „Parzival“ und die Absichten des Autors.
Das zweite Kapitel analysiert die verschiedenen Arten von Verweisen, Einschüben, Sentenzen und Anspielungen im „Parzival“ und ihre Funktion für den mittelalterlichen Zuhörer. Es werden direkte und indirekte Verweise auf den Vortrag und die Zuhörer untersucht, sowie sachliche Erläuterungen, literarische Anspielungen, historische Verweise, „Fachexpertenexkurse“ und geographische Bezüge. Das Kapitel zeigt auf, wie Wolfram durch diese Elemente die Aufmerksamkeit des Publikums fesselt und die Handlung des Romans bereichert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Parzival“, Wolfram von Eschenbach, mittelalterliche Literatur, höfisches Publikum, geistliche Leser, intertextuelle Verweise, Sentenzen, Belege, Gemeinschaftsbildung, Vortragssituation, Erzählerinstanz, fiktiver Zuhörer, reales Publikum, Anspielungen, Erläuterungen, Einschübe, Handlungsgeschehen, Gemeinsamkeit, Zweckgebundenheit, mittelalterliche Kultur, Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Katharina Giers (Author), 2006, Die Funktion intertextueller Verweise, Sentenzen und Belege für den mittelalterlichen Zuhörer im Wolframschen „Parzival“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114679