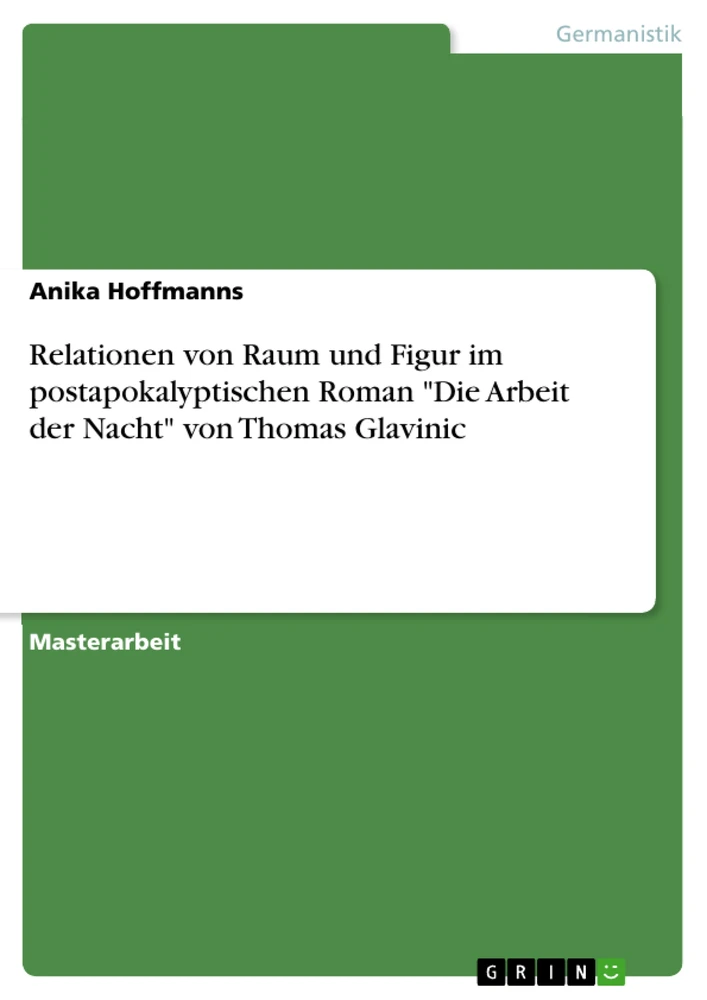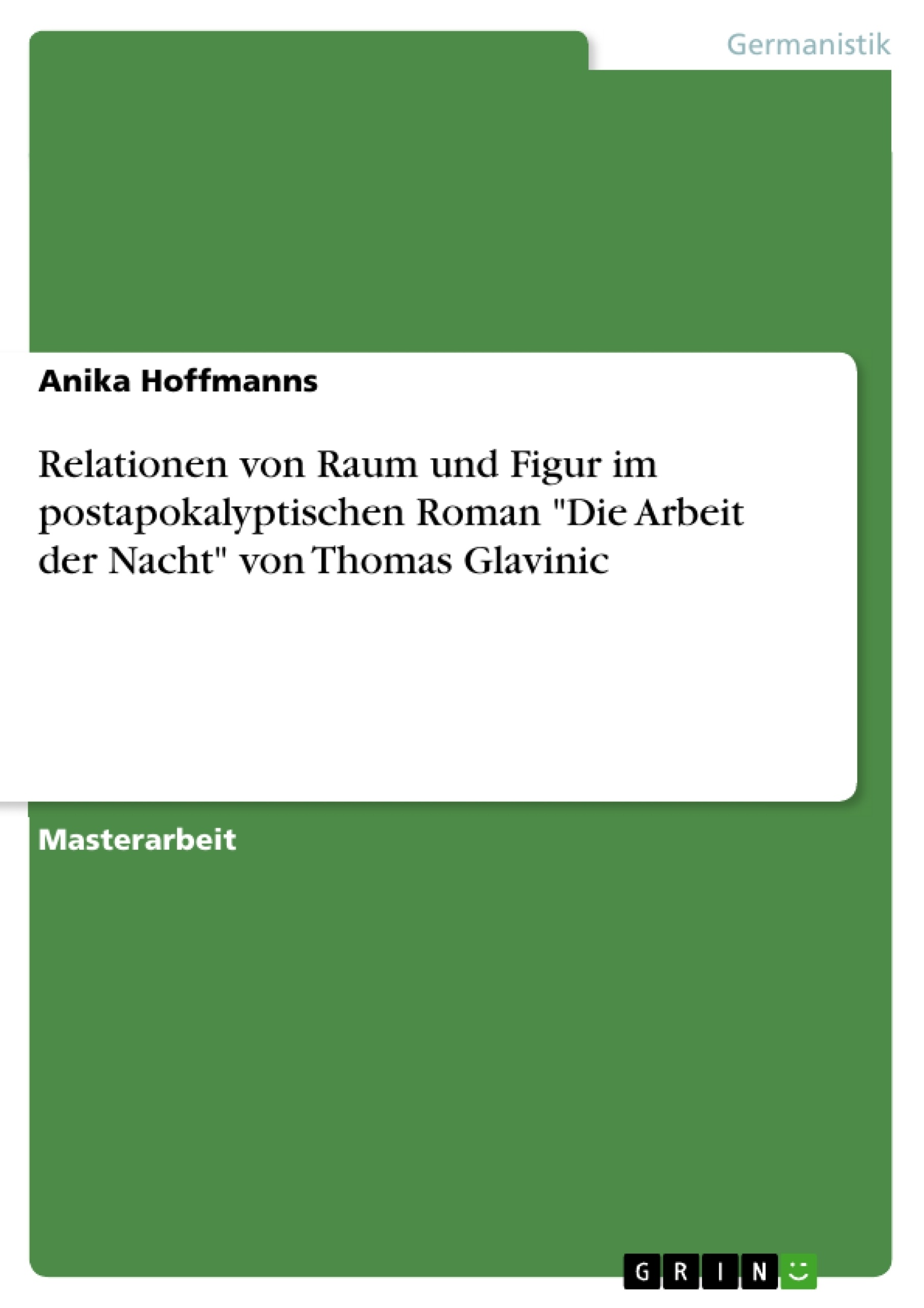Diese Arbeit handelt von dem Roman "Die Arbeit der Nacht" von Thomas Glavinic und beschäftigt sich mit der erzählerischen Darstellung der Wechselbeziehungen zwischen Romanfigur und Raum.
Zunächst wird eine literaturhistorische Übersicht über die apokalyptische und postapokalyptische Literatur gegeben. Daraufhin findet eine Vertiefung der Merkmale postapokalyptischer Erzählstrukturen statt, wodurch anschließend eine Erarbeitung der postapokalyptischen Motive in "Die Arbeit der Nacht" erfolgen kann. In diesem Zuge wird auch geklärt, inwieweit die Verschiebung des apokalyptischen Moments die Erzählstruktur beeinflusst.
Danach wird die Raumtheorie Jurij M. Lotmans vorgestellt, die in der späteren Analyse als Instrumentarium dient. Ergänzend zu Lotmans semantischem Ansatz wird mit Marc Augés Konzept der ‚Nicht-Orte‘ eine andere Perspektive auf Raum vorgestellt, die ebenfalls als Instrumentarium für den Analyseteil genutzt wird. Anhand der vorgestellten Theorien von Lotman und Augé wird schließlich Glavinics Roman "Die Arbeit der Nacht" im Hinblick auf die These analysiert. Durch die beiden unterschiedlichen Analyseansätze werden die zwei Ebenen, auf denen der Raum im Roman funktioniert, herausgearbeitet.
Anhand Augés Ansatz wird untersucht, wie sich die Abwesenheit von Menschen und die damit einhergehende soziale Interaktion auf den diegetischen Raum und die Nicht-Orte, deren Funktion durch die Gesellschaft bestimmt ist beziehungsweise war, auswirkt, und wie Jonas auf diese Veränderungen reagiert. Hierzu werden verschiedene Nicht-Orte im Roman identifiziert und im Hinblick auf die erzählerische Gestaltung und den Bezug zu der Figur untersucht.
Mit einbezogen und in Beziehung zu den analysierten Szenen gesetzt, werden Überlegungen zum Raum als Träger von Geschichte. Anschließend wird ein genauerer Blick auf Jonas‘ Versuch, sich den entfremdeten Raum mittels Schrift anzueignen, gerichtet. Danach wird dargelegt, wie zwei klassifikatorische Grenzen die Romanhandlung strukturieren.
Abschließend werden die Erkenntnisse im Fazit noch einmal in Bezug zu der These und der Fragestellung gesetzt. Ob tatsächlich eine Wechselbeziehung zwischen der Figur Jonas und dem Raum besteht, und das vorhandene Raumkonzept analog zu Jonas immer instabiler wird, soll schließlich geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von apokalyptischen Texten der Antike zum postapokalyptischen Narrativ gegenwärtiger Literatur – eine Skizze
- Theorie: Merkmale postapokalyptischer Texte
- Postapokalyptische Motive in Die Arbeit der Nacht
- Methodik: Raumtheorie
- Raumsemantik nach Jurij M. Lotman
- Nicht-Orte nach Marc Augè
- Raumtheoretische Analyse von Die Arbeit der Nacht
- Nicht-Orte als Inszenierung von Isolation
- Transiträume: Funktionalität im leeren Raum
- Erinnerungsräume: Das Gedächtnis des Raumes
- Raumaneignung durch Schrift
- Grenzüberschreitungen nach Jurij M. Lotman
- Die mediale Erweiterung des Raumes: Das Unerfahrbare erfahrbar machen
- Die Reise nach England: Das Vertraute und das Fremde
- Der Suizid als letzte Grenze
- Nicht-Orte als Inszenierung von Isolation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die enge Beziehung zwischen Raum und Figur im postapokalyptischen Roman „Die Arbeit der Nacht“ von Thomas Glavinic. Ziel ist es, die räumliche Ordnung des Romans unter Einbezug raumtheoretischer Konzepte, wie der Nicht-Orte nach Marc Augè und der Raumsemantik nach Jurij M. Lotman, zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Handlung und die Entwicklung der Figur Jonas zu beleuchten.
- Die Konstruktion des postapokalyptischen Raums in „Die Arbeit der Nacht“
- Die Rolle von Nicht-Orten und Transiträumen in der Inszenierung von Isolation und Verzweiflung
- Die Beziehung zwischen Raumaneignung und Jonas' psychischem Verfall
- Die Bedeutung von Grenzüberschreitungen im Roman und deren Einfluss auf die Figur
- Die Wechselwirkung zwischen räumlicher Ordnung und der Selbstkonfrontation der Figur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und die Ausgangssituation des Romans, die durch die plötzliche und unerklärliche Abwesenheit aller Menschen und Tiere gekennzeichnet ist. Im zweiten Kapitel wird die literaturhistorische Entwicklung des apokalyptischen und postapokalyptischen Narrativs skizziert, wobei die Verschiebung vom apokalyptischen Moment zur postapokalyptischen Welt im 20. Jahrhundert im Vordergrund steht. Im dritten Kapitel werden die Merkmale postapokalyptischer Texte und die spezifischen Motive in „Die Arbeit der Nacht“ betrachtet. Kapitel 4 widmet sich der Methodendiskussion und stellt wichtige raumtheoretische Ansätze vor, die die Grundlage für die Analyse bilden. Die raumtheoretische Analyse von „Die Arbeit der Nacht“ erfolgt in Kapitel 5, wobei die Bedeutung von Nicht-Orten, Raumaneignung und Grenzüberschreitungen im Kontext von Jonas' Isolation und Verzweiflung im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Postapokalyptischer Roman, Raumtheorie, Nicht-Orte, Raumsemantik, Isolation, Selbstkonfrontation, Grenzüberschreitung, „Die Arbeit der Nacht“, Thomas Glavinic
- Quote paper
- Anika Hoffmanns (Author), 2021, Relationen von Raum und Figur im postapokalyptischen Roman "Die Arbeit der Nacht" von Thomas Glavinic, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146703