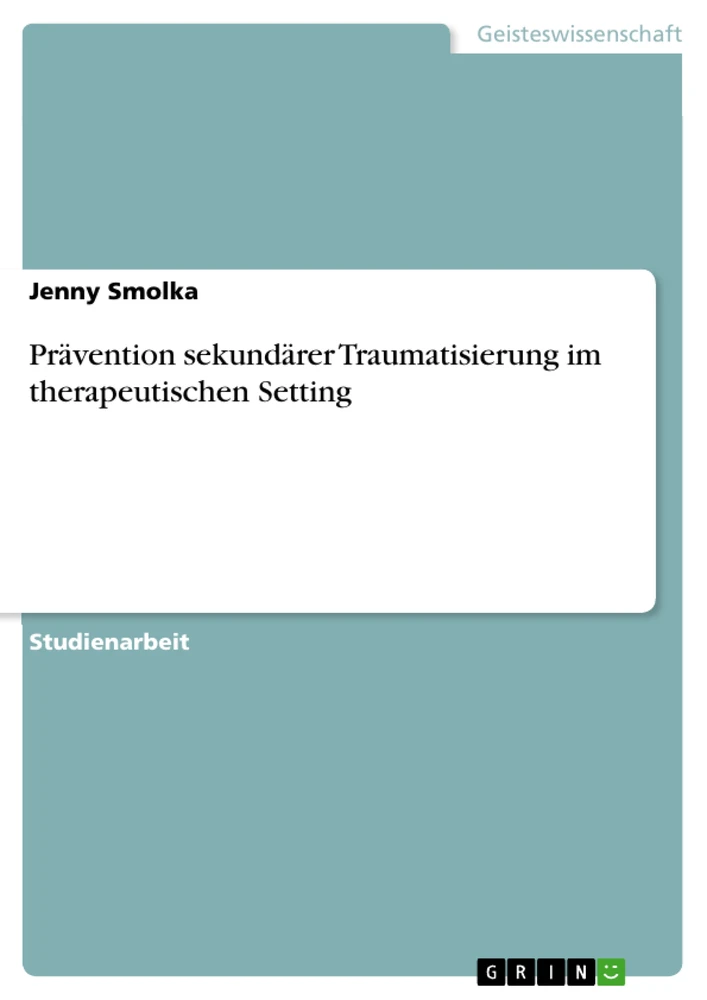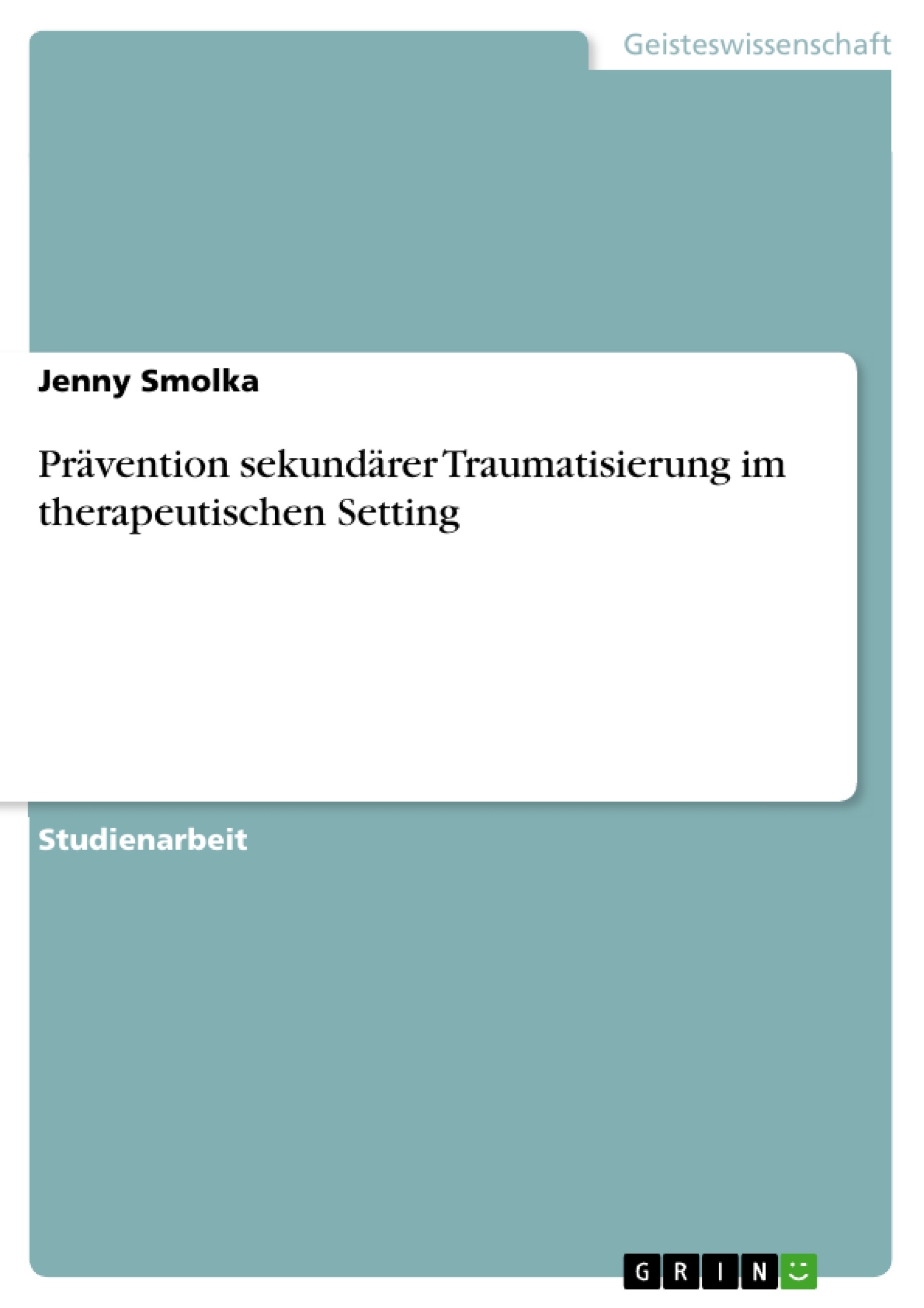Um sich in seine Patientinnen und Patienten hineinversetzen zu können, stellt sich der Therapeut Dr. Mustermann die ihm geschilderten traumatischen Situationen bildlich vor. Nach einiger Zeit dieser Methodik wird er jedoch selbst zum Patienten: Die Traumata seiner Patienten werden zu seinen eigenen. Ohne die traumatischen Situationen selbst erlebt zu haben, belasten ihn die immer wiederkehrenden Bilder, die er selbst nur aufgrund von Beschreibungen seiner Patientinnen und Patienten in seinem Kopf erzeugt hat. Er zeigt Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Bei diesem beschriebenen Phänomen handelt es sich um die in der Wissenschaft umstrittene Sekundäre Traumatisierung (ST).
Therapierende kümmern sich um traumatisierte Personen – doch wer kümmert sich um traumatisierte Therapierende? Es ist nicht nur relevant, dass traumatisierte Personen eine Therapie zur Linderung ihrer Symptomatik erhalten; gleichzeitig ist es wichtig, dass Therapierende sich schützen, um nicht selbst sekundär traumatisiert und womöglich berufsunfähig zu werden. Die Grundlage dafür ist, diese Art der Traumatisierung an sich und die Schutz- und Risikofaktoren ebenjener zu kennen.
Daher widmet sich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit der Prävention der Sekundären Traumatisierung bei Therapierenden. Die untersuchte Fragestellung lautet konkret:
„Wie können sich Therapierende vor einer Sekundären Traumatisierung schützen, die durch Schilderungen traumatischer Ereignisse durch traumatisierte Personen entstehen kann?“
Zur Beantwortung werden in Kapitel 2 zunächst die Grundlagen der Sekundären Traumatisierung erläutert. Dabei wird die ST definiert und von anderen Begriffen abgegrenzt. Zusätzlich wird diese Art der Traumatisierung innerhalb der PTBS eingeordnet und gleichzeitig unter einem anderen Blickwinkel von dieser differenziert. Das Kapitel 3 thematisiert die vorhandenen bzw. nicht vorhandenen empirischen Belege der ST und stellt dabei ältere sowie aktuelle Meta-Analysen und deren Ergebnisse vor. Darauffolgend werden erste Erkenntnisse der Schutz- und Risikofaktoren zusammengetragen. Die wissenschaftliche Arbeit endet mit einer Diskussion der Inhalte und Studien, in der die anfangs eingeführte Fragestellung final beantwortet wird – ergänzt um einen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Sekundäre Traumatisierung
- 2.1 Definition und Begrifflichkeiten
- 2.2 Prävalenz
- 2.3 Symptome und Diagnostik
- 2.3.1 PTBS: Vergleich ICD-11 und DSM-5
- 2.3.2 Vergleich PTBS und Sekundäre PTBS
- 2.3.3 Unterschiede Patient*in und Therapeut*in
- 2.3.4 Fragebogen
- 3 Meta-Analysen
- 4 Risikofaktoren
- 5 Schutzfaktoren
- 6 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prävention sekundärer Traumatisierung bei Therapeut*innen. Das zentrale Ziel ist die Beantwortung der Frage, wie sich Therapeut*innen vor sekundärer Traumatisierung schützen können, die durch Schilderungen traumatischer Ereignisse durch Patient*innen entsteht. Die Arbeit analysiert die Grundlagen der sekundären Traumatisierung, bewertet vorhandene empirische Belege mittels Meta-Analysen und untersucht schließlich Schutz- und Risikofaktoren.
- Definition und Abgrenzung sekundärer Traumatisierung
- Empirische Befunde und Meta-Analysen zur sekundären Traumatisierung
- Identifizierung von Risikofaktoren für sekundäre Traumatisierung bei Therapeut*innen
- Analyse von Schutzfaktoren zur Prävention sekundärer Traumatisierung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Phänomen der sekundären Traumatisierung anhand eines Beispiels und führt in die Thematik ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Schutzmöglichkeiten für Therapeut*innen vor sekundärer Traumatisierung aufgrund der Schilderungen traumatischer Ereignisse ihrer Patient*innen. Die Arbeit gliedert sich in die Analyse der Grundlagen der sekundären Traumatisierung, die Bewertung empirischer Belege, die Untersuchung von Schutz- und Risikofaktoren und schließlich eine Diskussion mit Handlungsempfehlungen.
2 Sekundäre Traumatisierung: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung der sekundären Traumatisierung. Es beinhaltet eine genaue Definition und Abgrenzung des Begriffs von ähnlichen Konzepten. Die Prävalenz wird beleuchtet, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der Symptome und ihrer Diagnostik, unter Berücksichtigung von DSM-5 und ICD-11. Der Vergleich der Symptomatik zwischen Patient*innen und Therapeut*innen wird ebenso angesprochen, wie der Einsatz von Fragebögen zur Erfassung sekundärer Traumatisierung. Es wird eine umfassende Grundlage für das Verständnis der Thematik geschaffen.
3 Meta-Analysen: Dieses Kapitel bewertet die vorhandenen empirischen Belege zur sekundären Traumatisierung anhand von Meta-Analysen. Es werden sowohl ältere als auch aktuelle Studien berücksichtigt und deren Ergebnisse kritisch diskutiert. Der Fokus liegt auf der wissenschaftlichen Fundierung des Themas und der Bewertung des Forschungsstands.
4 Risikofaktoren: Das Kapitel fokussiert auf die Identifizierung von Faktoren, die das Risiko für eine sekundäre Traumatisierung bei Therapeut*innen erhöhen. Es werden verschiedene Faktoren detailliert analysiert und in ihren Zusammenhängen dargestellt, um ein umfassendes Bild der Risikofaktoren zu vermitteln.
5 Schutzfaktoren: Dieses Kapitel befasst sich mit Faktoren, die Therapeut*innen vor sekundärer Traumatisierung schützen können. Es werden verschiedene Schutzmechanismen und präventive Maßnahmen detailliert beschrieben und ihre Wirksamkeit diskutiert, um Therapeut*innen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Sekundäre Traumatisierung, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Prävention, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Therapeut*innen, Traumatisierung, DSM-5, ICD-11, Meta-Analyse, vicarious trauma, secondary traumatic stress.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Prävention sekundärer Traumatisierung bei Therapeut*innen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Prävention sekundärer Traumatisierung bei Therapeut*innen. Das zentrale Ziel ist die Untersuchung von Schutzmöglichkeiten vor sekundärer Traumatisierung, die durch die Schilderung traumatischer Erlebnisse von Patient*innen entsteht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Grundlagen der sekundären Traumatisierung, bewertet vorhandene empirische Belege mittels Meta-Analysen und untersucht Schutz- und Risikofaktoren. Sie umfasst Definition und Abgrenzung sekundärer Traumatisierung, empirische Befunde und Meta-Analysen, Risikofaktoren für sekundäre Traumatisierung bei Therapeut*innen, Schutzfaktoren zur Prävention und Handlungsempfehlungen zur Prävention.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur sekundären Traumatisierung (inkl. Definition, Prävalenz, Symptomatik, Diagnostik nach DSM-5 und ICD-11 und Vergleich zwischen Patient*in und Therapeut*in), ein Kapitel zu Meta-Analysen, Kapitel zu Risikofaktoren und Schutzfaktoren und eine abschließende Diskussion.
Was wird unter sekundärer Traumatisierung verstanden?
Das Kapitel "Sekundäre Traumatisierung" liefert eine umfassende Definition und Abgrenzung des Begriffs. Es werden Symptome und Diagnostik detailliert beschrieben, unter Berücksichtigung von DSM-5 und ICD-11. Der Vergleich der Symptomatik zwischen Patient*innen und Therapeut*innen wird ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielen Meta-Analysen in dieser Arbeit?
Das Kapitel "Meta-Analysen" bewertet vorhandene empirische Belege zur sekundären Traumatisierung. Es werden ältere und aktuelle Studien berücksichtigt und deren Ergebnisse kritisch diskutiert, um den Forschungsstand wissenschaftlich zu fundieren.
Welche Risikofaktoren für sekundäre Traumatisierung werden untersucht?
Das Kapitel "Risikofaktoren" analysiert detailliert Faktoren, die das Risiko für sekundäre Traumatisierung bei Therapeut*innen erhöhen. Die Faktoren werden in ihren Zusammenhängen dargestellt, um ein umfassendes Bild zu vermitteln.
Welche Schutzfaktoren werden betrachtet?
Das Kapitel "Schutzfaktoren" beschreibt detailliert Mechanismen und präventive Maßnahmen, die Therapeut*innen vor sekundärer Traumatisierung schützen können. Die Wirksamkeit dieser Faktoren wird diskutiert, um konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Sekundäre Traumatisierung, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Prävention, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Therapeut*innen, Traumatisierung, DSM-5, ICD-11, Meta-Analyse, vicarious trauma, secondary traumatic stress.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion und Handlungsempfehlungen zur Prävention sekundärer Traumatisierung bei Therapeut*innen.
- Quote paper
- Jenny Smolka (Author), 2021, Prävention sekundärer Traumatisierung im therapeutischen Setting, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146241