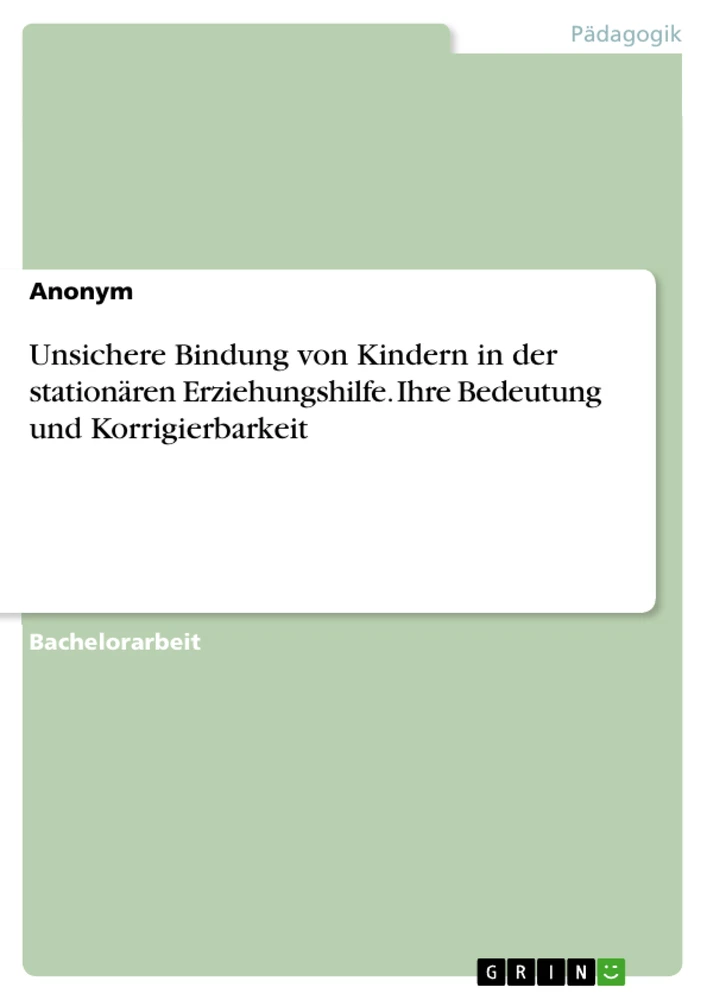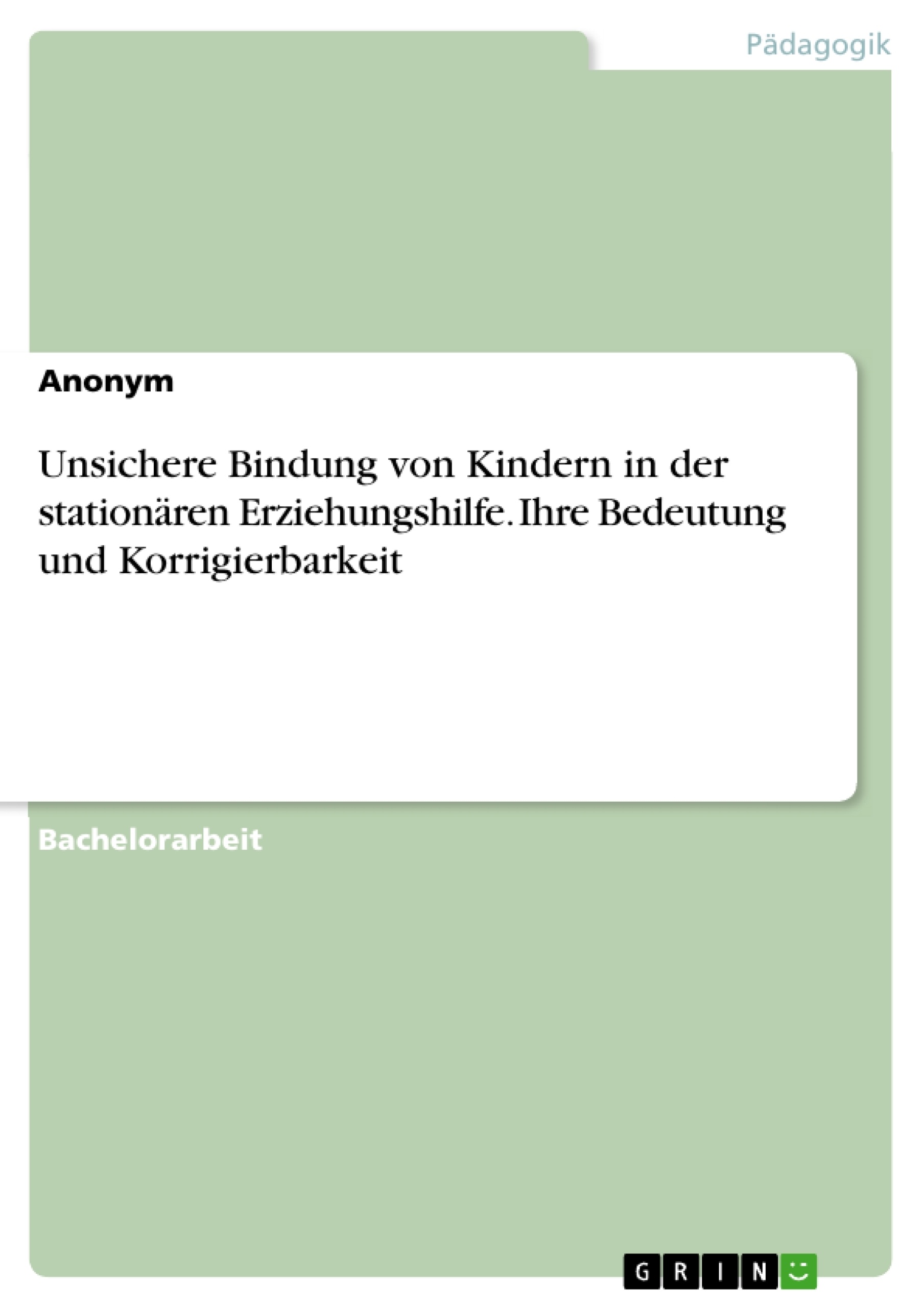Diese Arbeit widmet sich der Frage, wie sich negative Bindungserfahrungen von Kindern in der stationären Hilfe zur Erziehung korrigieren lassen. Dabei ist das Ziel, sich der entwickelten Fragestellung wissenschaftlich zu nähern, indem anhand von vorhandenen theoretischen sowie empirischen Daten diese analysiert, interpretiert, zusammengeführt und diskutiert werden sollen. Auf den bindungstheoretischen Hintergrund wird eingegangen.
Betrachtet man die innerhalb eines Jahres begonnen Hilfen der Heimerziehung, so lagen diese im Jahr 2008 noch bei 32'198. Seither stiegen sie kontinuierlich aufwärts. Insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 wurde ein deutliches Plus um jeweils 10 und 12 Tausend Hilfen verzeichnet, sodass sie 2016 einen Höchststand von 61'764 erreichten und sich damit im Vergleich zum Jahr 2008 beinahe verdoppelten. Dieser enorme Anstieg kann zum einen mit der hohen Zahl der unbegleiteten, geflüchteten Kinder und Jugendlichen, welche gleichermaßen einen staatlichen Anspruch auf die Betreuung in Heimen oder sonstigen Wohnformen besitzen, erklärt werden. Zum anderen stiegen in selbigen Jahren zeitgleich die Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls, wodurch sich die Zahlen ebenfalls durch den Schutzauftrag der Erziehungshilfe begründen lassen. Auch sollte angemerkt werden, dass seit 2016 ein Abwärtstrend der begonnenen Heimerziehungen festzustellen ist. Für die aktuelle Abnahme sind jedoch vor allem die Zahlen der Inobhutnahmen der unbegleiteten Flüchtlinge ausschlaggebend, welche sich seit dem Höchststand im Jahr 2016 bis 2019 um ganze 80% reduziert haben. Parallel dazu steigen aber sowohl die Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung, als auch die tatsächlichen Zahlen der Gefährdung des Kindeswohls kontinuierlich und sind insbesondere in den letzten zwei Messzeiträumen schlagartig auf einen derzeitigen Höchststand gestiegen. Gerade von diesen Betroffenen werden knapp ein Drittel in ein neues Zuhause, wie zum Beispiel in eine Einrichtung der stationären Erziehungshilfe, vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bindungstheoretische Grundlagen
- 2.1 Bindung
- 2.2 Bindungs- und Explorationsverhalten
- 2.3 Fürsorgesystem und Bindungsentwicklung
- 2.4 Inneres Arbeitsmodell
- 2.5 Bindungsqualität
- 2.5.1 Differenzierung der Bindungsstile
- 2.5.2 Bindungsstil als Risiko- und Schutzfaktor
- 3. Stationäre Hilfen zur Erziehung
- 3.1 Zielgruppe
- 3.2 Rechtliche Grundlage
- 3.3 Betreuungsformen
- 4. Unsicher-gebundene Kinder in stationären Hilfen zur Erziehung
- 4.1 Pädagogisches Handeln im Umgang mit unsicher-gebundenen Kindern
- 4.2 Fachkräfte als sichere Basis
- 4.2.1 Zur Korrigierbarkeit innerer Arbeitsmodelle
- 4.2.2 Schutzfaktoren und Resilienzförderung
- 4.2.3 Zur Organisation und Unterbringung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung und Korrigierbarkeit der unsicheren Bindung von Kindern im Kontext der stationären Erziehungshilfe. Ziel ist es, die Auswirkungen unsicherer Bindung auf die Entwicklung von Kindern in Heimen und ähnlichen Einrichtungen zu analysieren und zu erforschen, wie negative Bindungserfahrungen korrigiert werden können. Die Arbeit untersucht die Relevanz der Bindungstheorie für die Praxis der Heimerziehung und beleuchtet die Rolle von Fachkräften als sichere Basis für die betroffenen Kinder.
- Die Bedeutung unsicherer Bindung für die Entwicklung von Kindern in stationären Einrichtungen
- Die Herausforderungen im Umgang mit unsicher-gebundenen Kindern in der stationären Erziehungshilfe
- Möglichkeiten der Korrektur negativer Bindungserfahrungen durch pädagogisches Handeln
- Die Rolle von Fachkräften als sichere Basis für die Entwicklung der Kinder
- Die Relevanz der Bindungstheorie für die Gestaltung von Hilfen in der stationären Erziehungshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der stationären Erziehungshilfe in Deutschland vor und führt in die Forschungsfrage ein. Es wird die Relevanz des Themas unsicherer Bindung für die Praxis der Heimerziehung hervorgehoben.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Konzepte der Bindungstheorie, wie z.B. die Entstehung von Bindung, Bindungsverhalten und die Entwicklung des inneren Arbeitsmodells. Des Weiteren werden die verschiedenen Bindungsstile und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes beschrieben.
- Kapitel 3: Hier werden die stationären Hilfen zur Erziehung im Detail betrachtet. Es werden die Zielgruppe, die rechtliche Grundlage und die verschiedenen Betreuungsformen dieser Hilfen dargestellt.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Umgang mit unsicher-gebundenen Kindern in stationären Einrichtungen. Es werden die spezifischen Herausforderungen für Fachkräfte, die Möglichkeiten der Korrektur negativer Bindungserfahrungen und die Rolle von Fachkräften als sichere Basis für die Kinder beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Bindungstheorie, der stationären Erziehungshilfe und der Korrigierbarkeit negativer Bindungserfahrungen. Hierzu werden wichtige Begriffe wie unsichere Bindung, inneres Arbeitsmodell, stationäre Hilfen zur Erziehung, Fachkräfte als sichere Basis, Korrigierbarkeit und Resilienzförderung behandelt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Unsichere Bindung von Kindern in der stationären Erziehungshilfe. Ihre Bedeutung und Korrigierbarkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146067