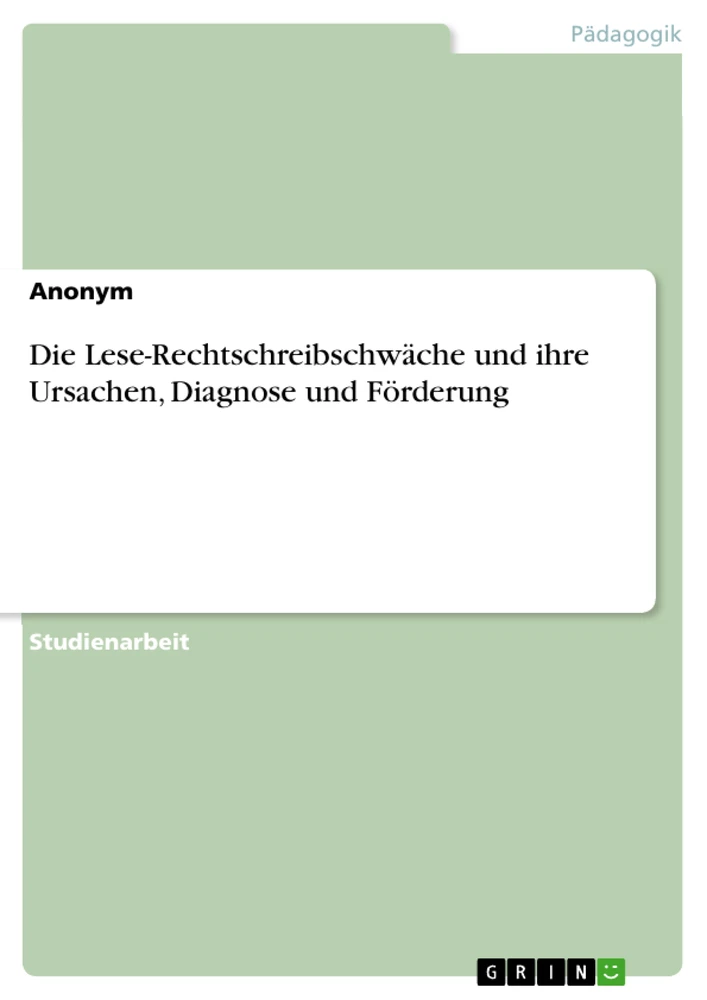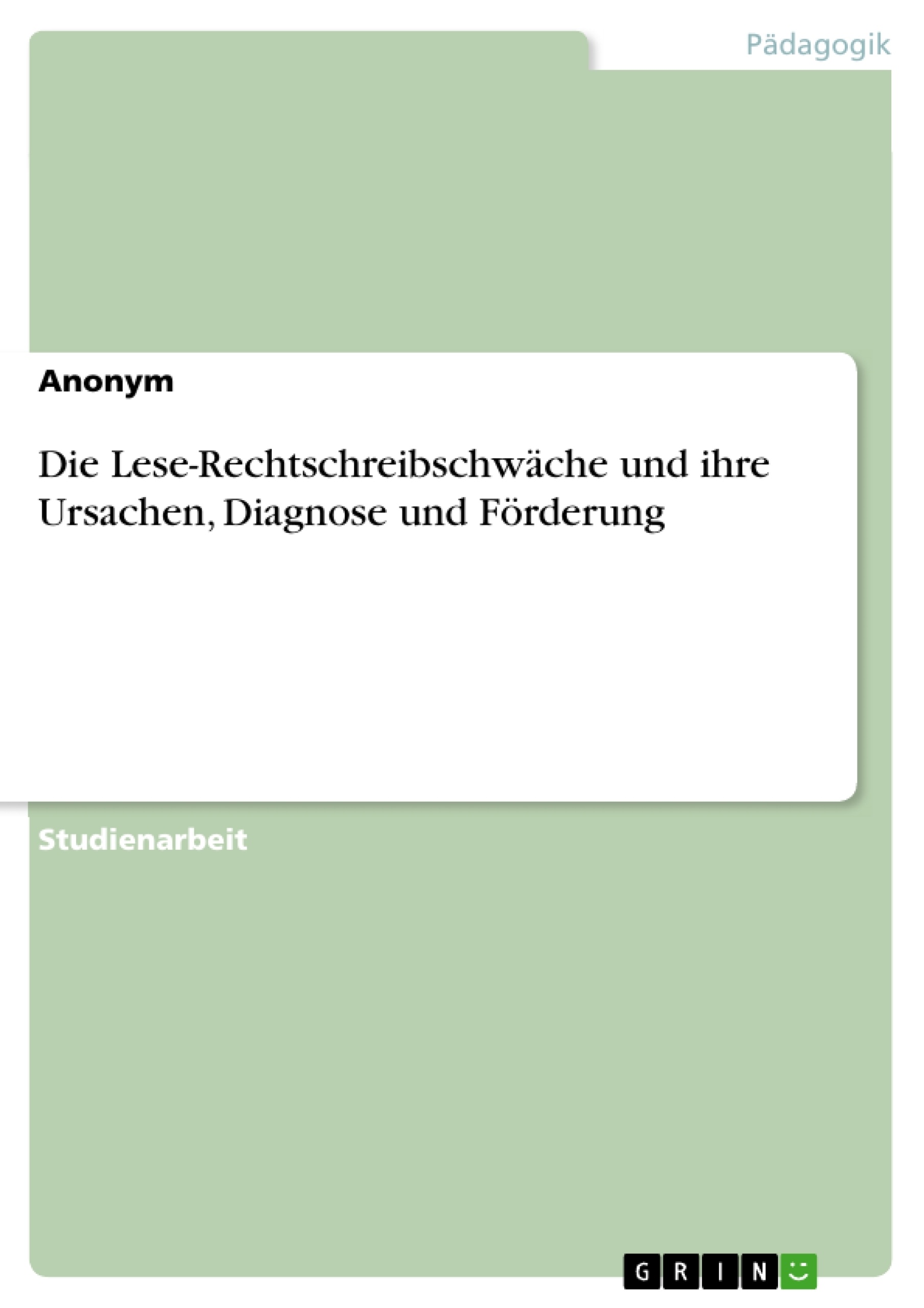"Konzentrier dich doch mal!" Diese Forderung bekommen Kinder oft zu hören, wenn sie viele Fehler machen. Viele Rechtschreibfehler und Probleme beim Lesen werden nicht selten auf fehlende Konzentration geschoben. Doch ist es richtig, dass diese Kinder nicht aufpassen oder sich nicht konzentrieren können?
Eine der wichtigsten in der Schule erlernten Fähigkeiten ist die Beherrschung der Schriftsprache. Kinder, die damit Probleme haben, erhalten oft die Diagnose Lese-Rechtschreibschwäche (im Folgenden LRS). Mit diesem Phänomen beschäftigt sich die Forschung schon lange. Ursachen, Symptome, Diagnose und Fördermaßnahmen sollen wissenschaftlich fundiert werden, allerdings sind diese Arbeiten noch lange nicht abgeschlossen.
In dieser Hausarbeit folgt auf die Definition der LRS die verschiedenen Ursachen und Symptome. Dann werden die von Peter May entwickelten Diagnoseverfahren erläutert und auf die daraus resultierenden Fördermöglichkeiten am Beispiel der Lerntherapie eingegangen. Exemplarisch wird daraufhin das Unternehmen "Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz" vorgestellt, um einen möglichen Ablauf einer dortigen Unterrichtseinheit aufzeigen. Im abschließendem Fazit wird darauf eingegangen, inwiefern die Ausarbeitung dieser Arbeit weitergeholfen hat und es wird von den eigenen Erfahrungen im LOS berichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Ursachen
- Biologische Faktoren
- Neurobiologische Faktoren
- Sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren
- Symptome
- Diagnose
- Förderung
- Förderung am Beispiel des Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), einem Lernproblem, das sich in Schwierigkeiten beim automatisierten Worterkennen, beim Lesen und beim Schreiben äußert. Sie beleuchtet die Definition, die verschiedenen Ursachen, Symptome, Diagnosemethoden und Fördermöglichkeiten von LRS. Die Arbeit geht auch auf die Rolle des Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz als Beispiel für eine mögliche Lerntherapie ein.
- Definition der LRS und ihrer Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche
- Analyse der Ursachen von LRS, einschließlich biologischer, neurobiologischer und sozioökonomischer Faktoren
- Vorstellung von Diagnoseverfahren nach Peter May und deren Implikationen für die Förderung
- Bedeutung der Förderung von LRS mit einem konkreten Beispiel des Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz
- Reflexion der eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Bearbeitung des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema LRS ein und erläutert die Relevanz der Forschung in diesem Bereich. Das Kapitel „Definition“ definiert LRS als eine Lernproblematik, die sich in der Beeinträchtigung beim automatisierten Worterkennen, der Geschwindigkeit des Lesens und der Rechtschreibung äußert. Der Einfluss von LRS auf verschiedene Lebensbereiche, wie die sprachliche Entwicklung, soziale Interaktion und die eigene Entwicklung, wird ebenfalls beleuchtet. Die Ursachen von LRS werden im folgenden Kapitel betrachtet, wobei verschiedene biologische, neurobiologische und sozioökonomische Faktoren eine Rolle spielen. Biologische Faktoren umfassen die Vererbung von Eigenschaften und Schwangerschaftskomplikationen, während neurobiologische Faktoren wie Defizite in der Verarbeitung phonologischer Informationen, auditive Verarbeitungsschwierigkeiten und visuelle Wahrnehmungsstörungen behandelt werden. Sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren, wie die häusliche Umgebung und der Einfluss von Migrantenfamilien, werden ebenfalls in ihrer Relevanz für die Entstehung von LRS untersucht.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche, LRS, phonologische Informationsverarbeitung, neurobiologische Fehlentwicklungen, Diagnoseverfahren, Fördermöglichkeiten, Lerntherapie, Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz, Sprachkompetenz, Sozioökonomische Faktoren, soziokulturelle Faktoren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Lese-Rechtschreibschwäche und ihre Ursachen, Diagnose und Förderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1145731