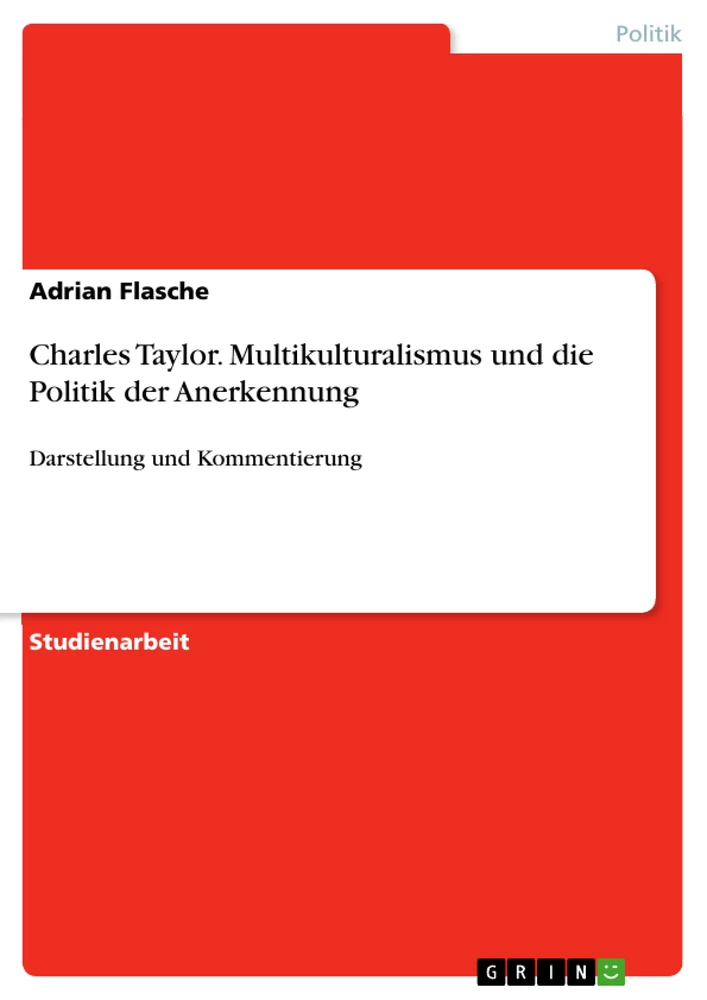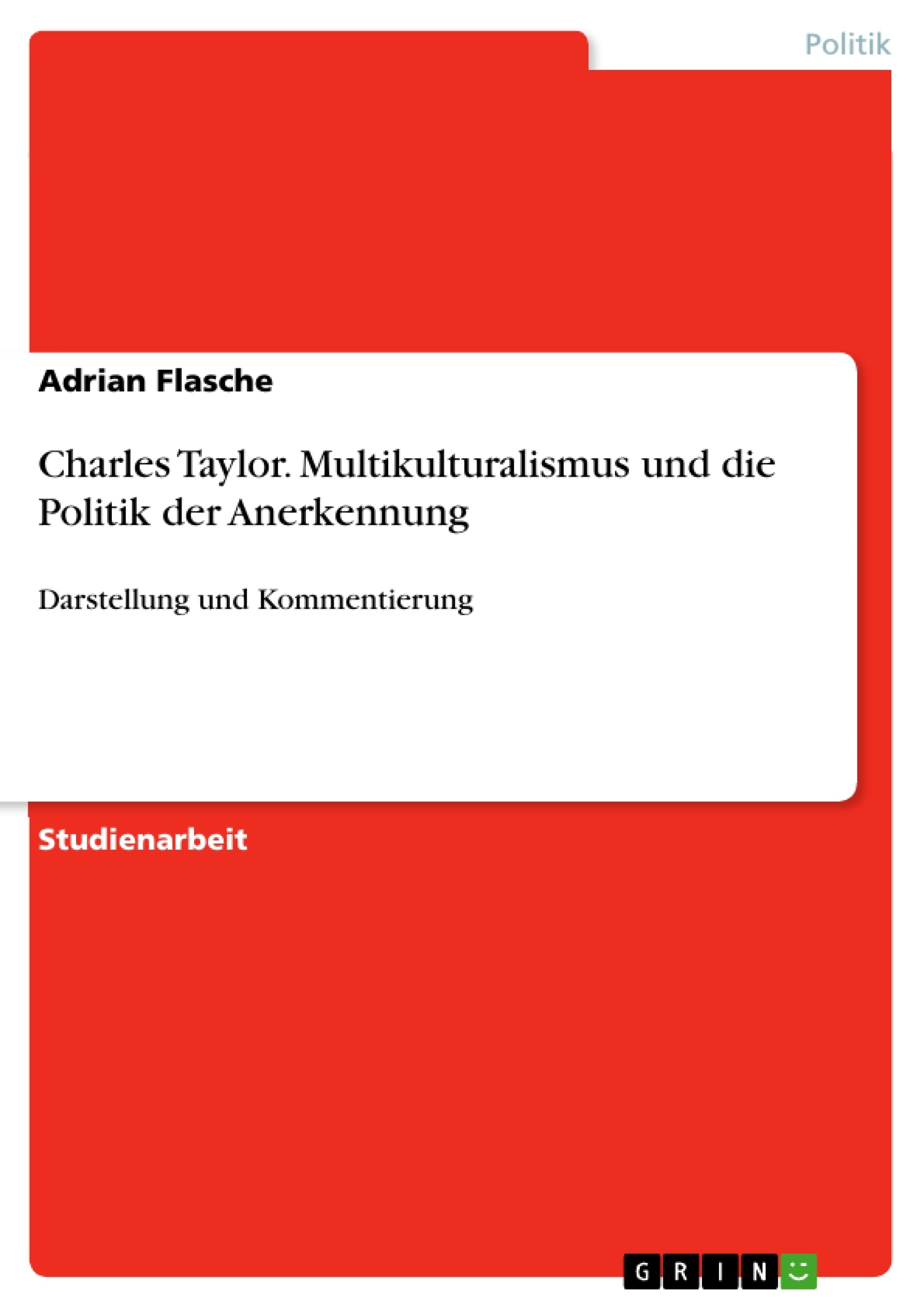Immer wieder wird die Frage gestellt, welche von den vielen Kulturen der menschlichen Zivilisation denn die allgemeingültige für die gesamte Menschheit sei. Spätestens seit der Industriellen Revolution vor knapp 200 Jahren hat die sog. westliche Welt die „Führung“ der Erde übernommen, mit dem Selbstverständnis, mit ihrer liberalen, demokratischen Gesellschaftsform und ihrer Marktwirtschaft die ideale Gesellschaftsform für die ganze Menschheit zu sein. Andere Kulturen mit jeweils differenten Lebensformen erheben diesen Anspruch aber ebenso.
Doch das Phänomen der verschiedenen Kulturen besteht nicht nur international, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft, in ihrer Binnenstruktur, wo sich die Konflikte mit der Kulturdifferenz besonders herauskristallisieren. Einerseits streben kulturelle Minoritäten die Gleichberechtigung an, verlangen also dieselben Rechte, die der Majorität eigen sind. Andererseits wollen ethnische Minderheiten jedoch nicht von der Mehrheit assimiliert und somit wiederum diskriminiert werden. Das Ziel von ethnischen Minderheiten ist das Recht, die Freiheit zu erhalten, mit der sie ihre ureigene Kultur erhalten und entfalten können – ebenso, wie die Mehrheit ihre Kultur frei entfalten kann. Somit kämpfen ethnische Minderheiten nicht ausschließlich für Gleichberechtigung, sondern für die Akzeptanz ihrer Andersartigkeit, für ihr Recht auf Verschiedenheit.
In einigen Fällen wollen ethnische Minderheiten jedoch auch Kulturen durchsetzen, die den demokratischen Staat hochgradig unterlaufen. Wie soll in solch einer Situation einer ethnischen Minderheit begegnet werden, die eine traditionell antidemokratische Kulturform hat? Besonders uns in den westlichen Industrieländern muß die Frage beschäftigen: Welche Urteilswege stehen uns überhaupt für andersartige Kulturen offen? Sollen und dürfen wir unsere Ideale von Toleranz, Freiheit, Demokratie und Menschenrechten der ganzen Welt mit ihren andersartigen Gesellschaften aufzwingen?
In dieser komplexen Debatte, die oft sehr polemisch und undifferenziert geführt wird, hat der Kanadier Charles Taylor mit seinem Essay »Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung« 1992 einen besonderen Beitrag geleistet, indem er versuchte, Nüchternheit und Differenziertheit in die hitzige Auseinandersetzung zu bringen mit dem Versuch, konstruktive Antworten auf die multikulturellen Fragen zu geben. Taylors’ Ansatz wird in diesem Buch dargestellt und kommentiert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Darstellung der Argumentation von Charles Taylor
- 1. Identität und Anerkennung
- 2. Die Identitätsentwicklung im historischen Rückblick
- 3. Identitätsbildung durch Dialog
- 4. Die Politik der gleichheitlichen Anerkennung und die Politik der Differenz
- 5. Die Politik der allgemeinen Menschenwürde die Varianten von Rousseau und Kant
- 6. Prozeduraler und substantieller Liberalismus
- 7. Das Problem des Multikulturalismus
- III. Kommentare zu Taylors` Diskurs
- 1. Susan Wolf
- 2. Michael Walzer
- 3. Steven C. Rockefeller
- IV. Eigener Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert und kommentiert Charles Taylors Essay „Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung“, der die Debatte um den Umgang mit kultureller Vielfalt in modernen Gesellschaften beleuchtet. Taylor plädiert für ein Verständnis von Anerkennung, das die individuellen und kulturellen Identitäten respektiert und fördert, während gleichzeitig die gemeinsamen Grundwerte einer demokratischen Gesellschaft gewahrt bleiben.
- Identität und Anerkennung als zentrale Elemente der menschlichen Existenz
- Die Bedeutung von Dialog und gegenseitigem Verständnis für die Gestaltung einer multikulturellen Gesellschaft
- Die Herausforderungen und Chancen der Politik der Anerkennung im Kontext von kultureller Vielfalt
- Der Vergleich verschiedener Ansätze zur Gestaltung des Verhältnisses zwischen Mehrheits- und Minderheitskulturen
- Die Rolle von Toleranz und Menschenrechten in einer pluralistischen Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der kulturellen Vielfalt und der damit verbundenen Herausforderungen ein. Sie beleuchtet die historischen Wurzeln des Problems und die unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage, wie mit kultureller Vielfalt umgegangen werden sollte.
Kapitel II stellt die Argumentation von Charles Taylor im Detail dar. Es werden Taylors Konzepte von Identität und Anerkennung erläutert, die Bedeutung der historischen Entwicklung von Identitäten beleuchtet und die Herausforderungen der Politik der Anerkennung in einem multikulturellen Kontext diskutiert.
Kapitel III präsentiert Kommentare zu Taylors Argumentation aus der Sicht verschiedener Autoren wie Susan Wolf, Michael Walzer und Steven C. Rockefeller.
Schlüsselwörter
Multikulturalismus, Politik der Anerkennung, Identität, Kultur, Dialog, Toleranz, Menschenrechte, Liberalismus, Differenz, Gleichheit, Minderheiten, Mehrheiten, ethnische Konflikte, gesellschaftliche Integration, soziale Gerechtigkeit.
- Quote paper
- Kulturwissenschaftler M.A. Adrian Flasche (Author), 1995, Charles Taylor. Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11456