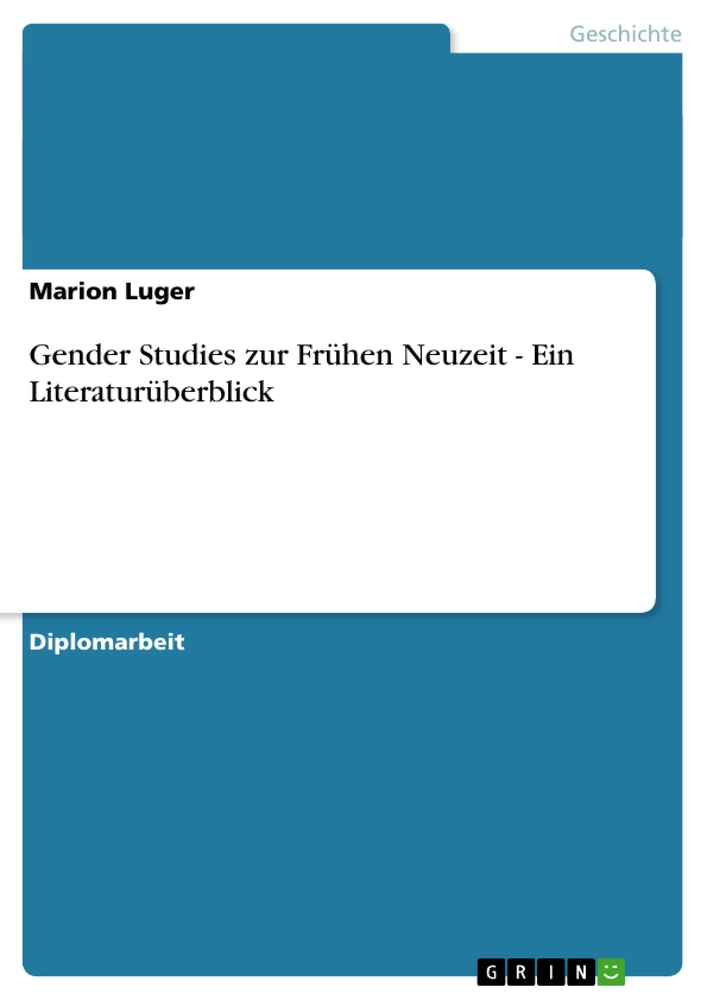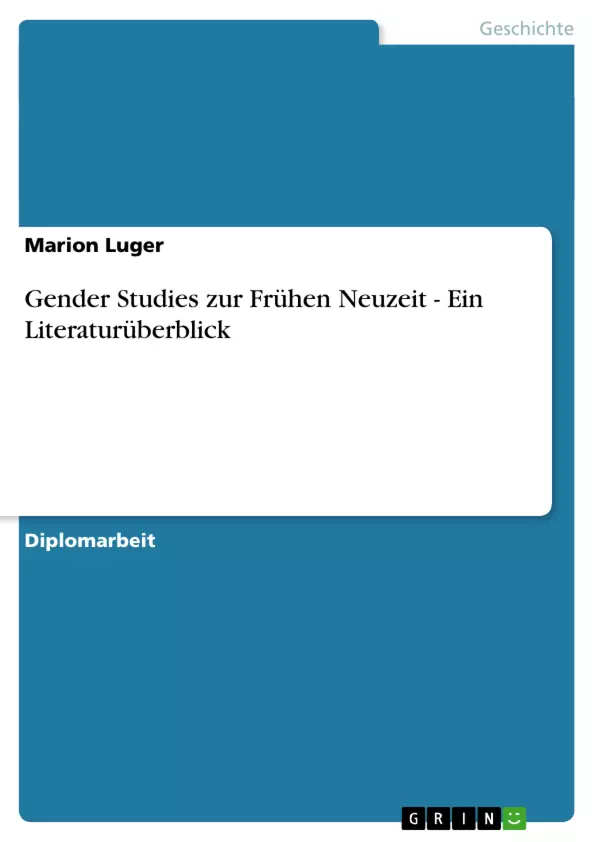Da das Schreiben von Geschichte nicht auf einer tabula rasa erfolgen kann, soll in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden, inwieweit sich die theoretischen Erkenntnisse, die die Frauen- und Geschlechtergeschichte seit den 1970er-Jahren gewonnen hat, in empirischen Gender Studies zur Frühen Neuzeit widerspiegeln. Zu diesem Zweck wurden rund 150 Untersuchungen zur Frühen Neuzeit aus der vergangenen Dekade zum Vergleich herangezogen. Der Zeitraum, der in diesen Werken behandelt wird, reicht vom Ausgang des Spätmittelalters bis zum Übergang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft im ausgehenden 18. Jahrhundert.
Um zu untersuchen, inwiefern sich feministische Theoriebildung und empirische Studien zur Frühen Neuzeit wechselseitig beeinflusst haben, werden auf die Themenfelder Lebensverläufe, Arbeit, Religion, Politik, Bildung, Ehe und soziale Sphären die folgenden Fragestellungen angewandt: 1. In welchem Maße haben HistorikerInnen die Dichotomie „männlich-öffentlich“ vs. „weiblich-privat“ und die Theorie von den „komplementären Geschlechtscharakteren“ als gegeben gedacht? 2. Wie wird in den Forschungen das Verhältnis zwischen Norm und Praxis der Geschlechterverhältnisse beschrieben? 3. Inwiefern wird die Kategorie „Geschlecht“ in Relation zu anderen Kategorien gesetzt? 4. Wird die Konstruktion von Geschlechterdifferenzen in der Frühen Neuzeit zum Thema gemacht? 5. Inwieweit haben Gender Studies zur Frühen Neuzeit die Geschichte neu geschrieben?
Die Antworten bieten einen ambivalenten Überblick über den Forschungen implizite Diskursstränge und zeigen Forschungsdesiderate auf.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Konstruierte Geschichte
- Theorie vs. Empirie?
- Erkenntnisstränge
- Forschungsgegenstände
- ALTE DICHOTOMIEN UND NEUE PERSPEKTIVEN
- „Privatheit“ - „Öffentlichkeit“: eine fragwürdige Dichotomie
- Die Relevanz von normativen Debatten
- Der,,männliche Blick" im „Zivilrecht"
- LEBENS(VER)LÄUFE UND LEBENSABSCHNITTE
- Zur Bedeutung von „Geschlecht“ und anderen Kategorien
- Kinder und Alte, Ledige und Witwe/r
- Armut und Geschlecht
- ARBEIT
- Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung.
- Frauen-Erwerbstätigkeit und ihr Wert_
- Frauen-Arbeit im handwerklichen Bereich
- Welche Arbeit gebührt wem?
- RELIGION
- Religion und Frömmigkeit – eine „,weibliche" Angelegenheit?
- Religion und Geschlecht - und sonstige Kategorien
- POLITIK
- ,,Politik" im weiteren Sinne
- Herrscherinnen: Das Vorrecht des Standes_
- ,,Richterinnen": Praktizierte Konfliktregelung
- BürgerInnen und BäuerInnen: Politische Partizipation
- Menschen im Aufruhr: Unterschiedlichste Solidaritäten
- GELEHRSAMKEIT, BILDUNG UND WISSENSCHAFT
- Humanistische,,Gelehrsamkeit"
- Zugang zum Wissen und Erziehungsziele
- Der Wert von „Bildung“
- Frauen in der Wissenschaft
- Wissenschaft und die „Geschlechter-Differenz"
- EHE
- Zur Theorie und Praxis des Ehe-Ideals
- Frau oder Mann
- Wer,,hat die Hosen an"?
- Die Bestimmung zur „Ehefrau, Hausfrau und Mutter"
- Mutterpflicht - Mutterglück?
- GETRENNTE WEGE
- Zwei Geschlechter - zwei Sphären?
- Gemischtgeschlechtliche Geselligkeit
- Formen der Geselligkeit und die Rede von „Männlichkeit“-„Weiblichkeit“
- Die Theorie von der Geschlechterpolarität und die Frauen
- Der Brief als „Medium der Weiblichkeit"
- RESÜMEE UND AUSBLICK_
- Rückprojektionen von Geschlechter-Modellen
- Bedeutung von Normen und Praktiken
- Positionierung der Kategorie „,,Geschlecht"
- Konstruktion der Geschlechter-Differenz
- Perspektiven einer neuen Geschichtsschreibung.
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit „Gender Studies zur Frühen Neuzeit. Ein Literaturüberblick“ von Mari On Luger zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die aktuelle Forschung zu Gender Studies in der Frühen Neuzeit zu geben. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Forschungsfeldes, identifiziert zentrale Themen und diskutiert die verwendeten Methoden und Theorien.
- Die Konstruktion von Geschlecht in der Frühen Neuzeit
- Die Rolle von Normen und Praktiken in der Geschlechterdifferenz
- Die Bedeutung von „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“ in der Geschlechtergeschichte
- Die Analyse von Lebensläufen und Lebensabschnitten im Kontext von Geschlecht
- Die Untersuchung von Arbeit, Religion, Politik, Bildung und Ehe im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Konstruiertheit von Geschichte und die Bedeutung von Interpretationen für die historische Forschung in den Vordergrund. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Theorie- und Methodenintegration in der Genderforschung zur Frühen Neuzeit.
Das zweite Kapitel widmet sich der kritischen Analyse der Dichotomie von „Privatheit“ und „Öffentlichkeit“ und zeigt deren problematische Anwendung in der Geschlechtergeschichte auf. Es beleuchtet die Relevanz von normativen Debatten und den „männlichen Blick“ im „Zivilrecht“ der Frühen Neuzeit.
Das dritte Kapitel untersucht die Bedeutung von „Geschlecht“ und anderen Kategorien für die Analyse von Lebensläufen und Lebensabschnitten in der Frühen Neuzeit. Es beleuchtet die Lebensbedingungen von Kindern, Alten, Ledigen und Witwen sowie die Auswirkungen von Armut auf die Geschlechterverhältnisse.
Das vierte Kapitel analysiert die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Frühen Neuzeit. Es untersucht die Erwerbstätigkeit von Frauen, ihren Wert und ihre Rolle im handwerklichen Bereich.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Rolle von Religion und Frömmigkeit in der Geschlechtergeschichte. Es untersucht die Frage, ob Religion eine „weibliche“ Angelegenheit war und analysiert die Interaktion von Religion, Geschlecht und anderen Kategorien.
Das sechste Kapitel widmet sich dem Thema „Politik“ im weiteren Sinne. Es untersucht die Rolle von Herrscherinnen, Richterinnen, Bürgerinnen und Bäuerinnen in der politischen Partizipation und die Bedeutung von Solidarität in Zeiten des Aufruhrs.
Das siebte Kapitel analysiert die Rolle von Frauen in der humanistischen Gelehrsamkeit, Bildung und Wissenschaft der Frühen Neuzeit. Es untersucht den Zugang zum Wissen, die Erziehungsziele und den Wert von „Bildung“ für Frauen.
Das achte Kapitel befasst sich mit der Theorie und Praxis des Ehe-Ideals in der Frühen Neuzeit. Es untersucht die Geschlechterrollen in der Ehe und die Frage, wer „die Hosen anhat“.
Das neunte Kapitel analysiert die Trennung von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ in der Frühen Neuzeit. Es untersucht die Formen der gemischtgeschlechtlichen Geselligkeit und die Rolle des Briefes als „Medium der Weiblichkeit“.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gender Studies, Frühe Neuzeit, Geschlechtergeschichte, Geschlechterrollen, Normen, Praktiken, „Privatheit“, „Öffentlichkeit“, Lebensläufe, Lebensabschnitte, Arbeit, Religion, Politik, Bildung, Ehe, Wissenschaft, Herrscherinnen, Richterinnen, Bürgerinnen, Bäuerinnen, Solidarität, Gelehrsamkeit, „Männlichkeit“, „Weiblichkeit“, Geselligkeit, Brief, Konstruktion von Geschlecht, Geschlechterdifferenz.
- Arbeit zitieren
- Marion Luger (Autor:in), 2004, Gender Studies zur Frühen Neuzeit - Ein Literaturüberblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114529