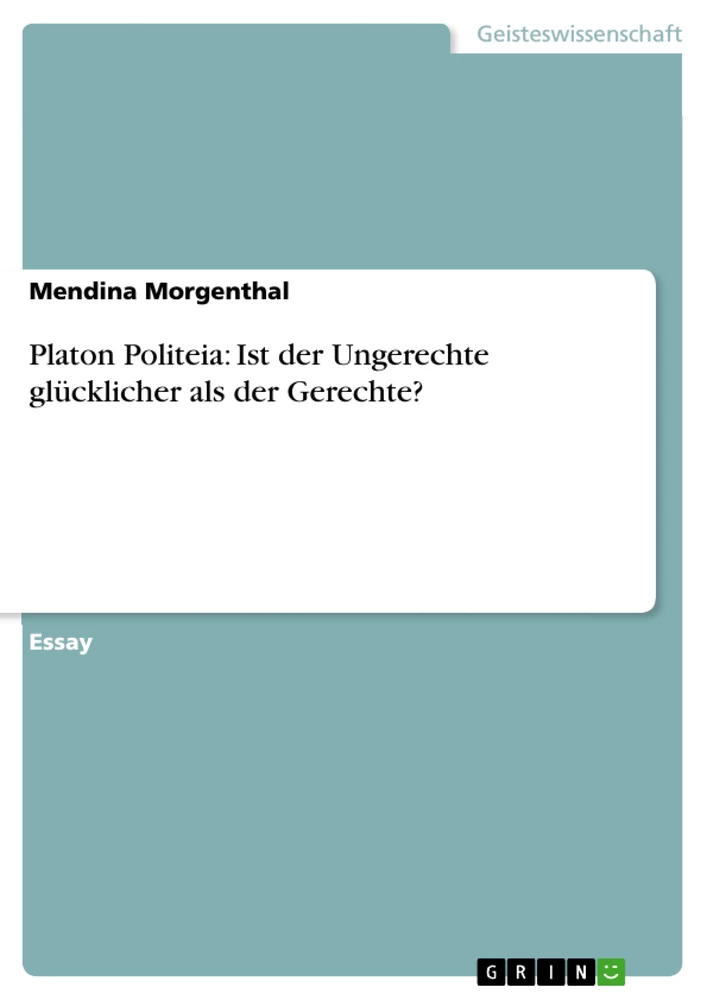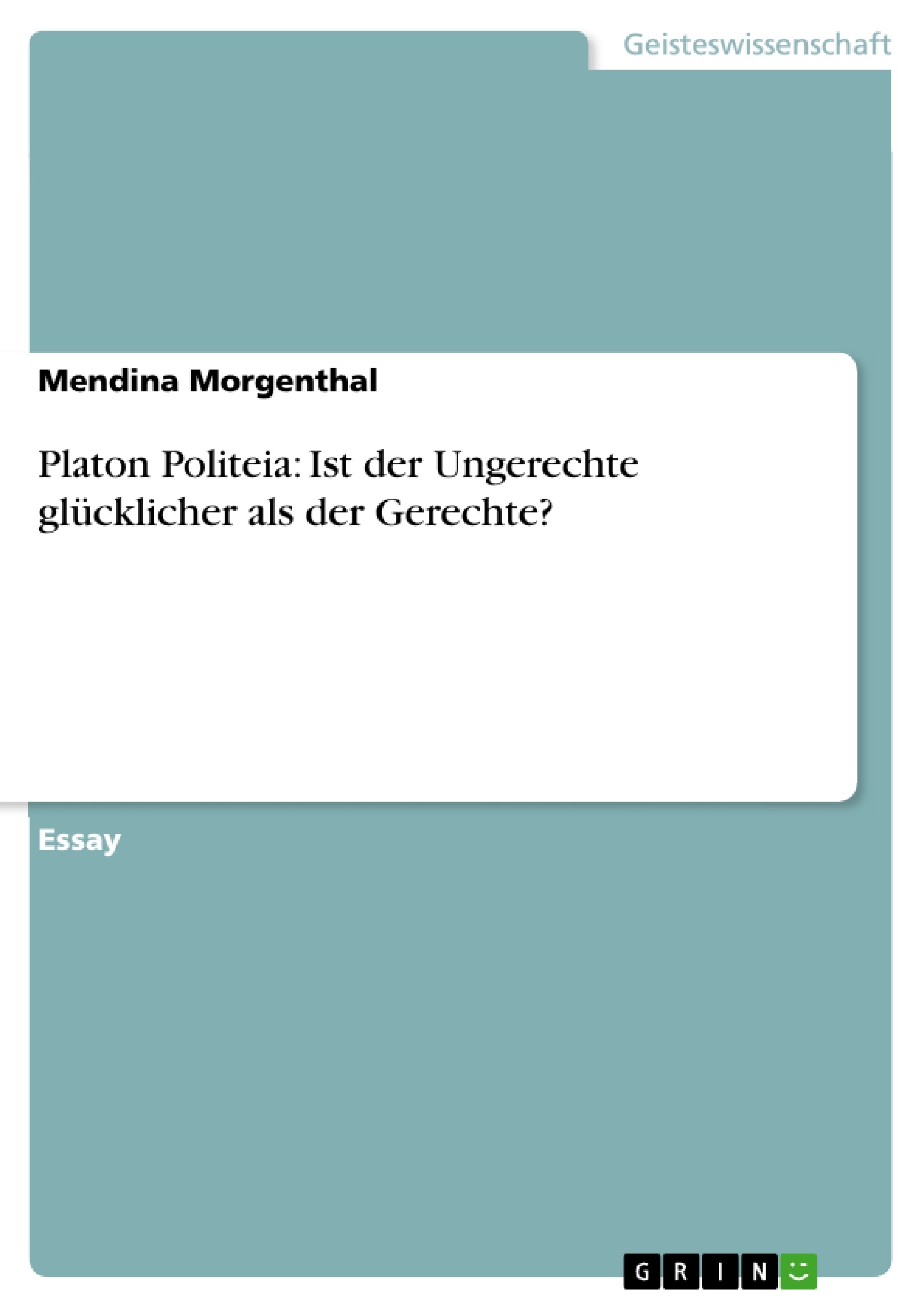In Platons „Politeia“ behauptet Sokrates´ Gesprächspartner Glaukon, dass der Gerechte, der nicht gerecht scheinen, sondern sein will, anderen ungerecht erscheint und sogar gekreuzigt würde. Der Ungerechte hingegen will demnach gerecht scheinen aber ungerecht sein. Seine Ungerechtigkeiten verschleiert er und kann die Vorzüge des Lebens, in einem gerechtem Rufe stehend, genießen.
Diese Annahme mag zunächst widersprüchlich sein, denn die meisten von uns haben schon von klein auf gelernt, was gut und was böse ist. Ziemlich schnell lernten wir auch den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kennen und im Einklang mit unserer moralischen Erziehung war es uns schließlich möglich die Gerechtigkeit dem Guten und die Ungerechtigkeit dem Bösen und Schlechten zuzuordnen. Warum also sollte der Gerechte letztlich gestraft werden, wohingegen dem Ungerechten ein besseres Los bestimmt ist? Aus der Konsequenz dieser Annahme entspringt folgende Vermutung: der Ungerechte ist glücklicher (eudaimoner) als der Gerechte.
Sokrates jedoch will diese Vermutung widerlegen. Aber wenn er oder auch Glaukon von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sprechen, so dürfen wir nicht mit naiver Leseart herangehen und beide Begriffe vorbehaltlos mit unserem heutigem Verständnis gleichsetzten. Nein, wir müssen unser wachsames Auge für Sokrates´ Begriffsbestimmung erst schärfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die praktische Philosophie
- Gerechtigkeit im Staat und im Menschen
- Glück und Gerechtigkeit bei Sokrates
- Das Problem des menschlichen Leids
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Platons Argumentation in der Politeia, dass der Gerechte glücklicher ist als der Ungerechte. Sie analysiert Sokrates' Definition von Gerechtigkeit im Staat und im Individuum und dessen Zusammenhang mit Glückseligkeit (Eudaimonie). Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Grenzen dieses Glücksbegriffs im Angesicht menschlichen Leids.
- Sokrates' Definition von Gerechtigkeit im Staat und deren Analogie zur Gerechtigkeit im Individuum
- Der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Glückseligkeit (Eudaimonie) bei Platon
- Die Kritik an Sokrates' Glücksbegriff angesichts von Ungerechtigkeit und Leid
- Die Frage nach dem Glück des Gerechten im Angesicht von Unrecht und Leid
- Die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Glückseligkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in die praktische Philosophie: Die Einleitung stellt die zentrale These der Politeia vor: die Behauptung Glaukons, dass der Ungerechte glücklicher ist als der Gerechte. Sie führt in die Problematik ein und weist auf die Notwendigkeit hin, Sokrates' Begriff von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Kontext seiner Zeit zu verstehen, anstatt sie mit modernen Vorstellungen zu vermischen. Die Einführung betont die methodische Vorgehensweise Sokrates', die Gerechtigkeit zuerst im Staat und dann im Individuum zu definieren.
Gerechtigkeit im Staat und im Menschen: Dieses Kapitel erläutert Sokrates' dreistufiges Modell der Gerechtigkeit im Staat (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit) und seine Analogie zur menschlichen Seele. Sokrates argumentiert, dass ein gerechter Mensch seine drei Seelenteile (weise, tapfer, besonnen) in Harmonie hält, während der ungerechte Mensch von innerem Zwiespalt geprägt ist. Die Analogie verdeutlicht, dass Gerechtigkeit nicht nur äußeres Handeln, sondern innere Ordnung der Seele bedeutet. Sokrates' Verständnis von Gerechtigkeit weicht von modernen Vorstellungen ab, indem es sich auf innere Harmonie konzentriert.
Glück und Gerechtigkeit bei Sokrates: Dieses Kapitel untersucht Sokrates' Verbindung von Glück und Gerechtigkeit. Es wird argumentiert, dass Sokrates' Glückseligkeit (Eudaimonie) nicht von äußeren Faktoren, sondern von innerer Harmonie abhängt. Ein gerechter Mensch, dessen Seelenteile im Einklang sind, ist aufgrund dieser inneren Ordnung glücklich. Glaukons Gegenargument, das Glück sei durch äußeres Ansehen und Vorteile bestimmt, wird widerlegt, indem Sokrates betont, dass inneres Glück durch nichts äußerliches aufgewogen werden kann. Die Unvereinbarkeit innerer Disharmonie mit Glück wird hervorgehoben.
Das Problem des menschlichen Leids: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an Sokrates' Glücksbegriff. Es wirft die Frage auf, wie Sokrates' Konzept der inneren Harmonie mit dem menschlichen Leid gerechter Menschen vereinbart werden kann. Das Kapitel stellt den Widerspruch dar: Gerechte Menschen können trotz innerer Harmonie unter Armut, Gewalt und Unrecht leiden. Die Frage, ob Sokrates' Glücksbegriff angesichts dieser Realität haltbar ist, wird offen gelassen und als Herausforderung für sein Konzept präsentiert.
Schlüsselwörter
Platon, Politeia, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Glückseligkeit (Eudaimonie), Seelenteile, Harmonie, innere Ordnung, menschliches Leid, Sokrates, Glaukon.
Platons Politeia: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Argumentation in der Politeia, dass der Gerechte glücklicher ist als der Ungerechte. Sie untersucht Sokrates' Definition von Gerechtigkeit im Staat und im Individuum und deren Zusammenhang mit Glückseligkeit (Eudaimonie). Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Herausforderungen und Grenzen dieses Glücksbegriffs angesichts menschlichen Leids.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Sokrates' Definition von Gerechtigkeit (im Staat und im Individuum), der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Glückseligkeit, die Kritik an Sokrates' Glücksbegriff angesichts von Ungerechtigkeit und Leid, die Frage nach dem Glück des Gerechten trotz Unrecht und Leid, sowie die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Glückseligkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einführung in die praktische Philosophie, ein Kapitel über Gerechtigkeit im Staat und im Menschen, ein Kapitel über Glück und Gerechtigkeit bei Sokrates und abschließend ein Kapitel zum Problem des menschlichen Leids. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Argumente.
Was ist Sokrates' Definition von Gerechtigkeit?
Sokrates definiert Gerechtigkeit im Staat dreistufig (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit) und überträgt diese Analogie auf die menschliche Seele. Ein gerechter Mensch lebt in innerer Harmonie seiner Seelenteile, während der Ungerechte von innerem Zwiespalt geprägt ist. Gerechtigkeit bedeutet für Sokrates innere Ordnung und Harmonie, nicht nur äußeres Handeln.
Wie verbindet Sokrates Gerechtigkeit und Glückseligkeit?
Für Sokrates hängt Glückseligkeit (Eudaimonie) von innerer Harmonie ab, nicht von äußeren Faktoren. Ein gerechter Mensch, dessen Seelenteile im Einklang sind, ist aufgrund dieser inneren Ordnung glücklich. Äußeres Ansehen und Vorteile können inneres Glück nicht aufwiegen.
Wie wird Glaukons Argumentation behandelt?
Glaukons Behauptung, der Ungerechte sei glücklicher als der Gerechte, wird als zentrale These der Politeia vorgestellt und im Laufe der Arbeit widerlegt. Sokrates widerlegt Glaukons Argument, indem er betont, dass inneres Glück durch nichts äußerliches aufgewogen werden kann.
Wie wird das Problem des menschlichen Leids angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Kritik an Sokrates' Glücksbegriff, indem sie die Frage stellt, wie Sokrates' Konzept der inneren Harmonie mit dem menschlichen Leid gerechter Menschen vereinbart werden kann. Gerechte Menschen können trotz innerer Harmonie unter Leid leiden, was die Haltbarkeit von Sokrates' Glücksbegriff in Frage stellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Platon, Politeia, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Glückseligkeit (Eudaimonie), Seelenteile, Harmonie, innere Ordnung, menschliches Leid, Sokrates, Glaukon.
- Quote paper
- Mendina Morgenthal (Author), 2008, Platon Politeia: Ist der Ungerechte glücklicher als der Gerechte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114522