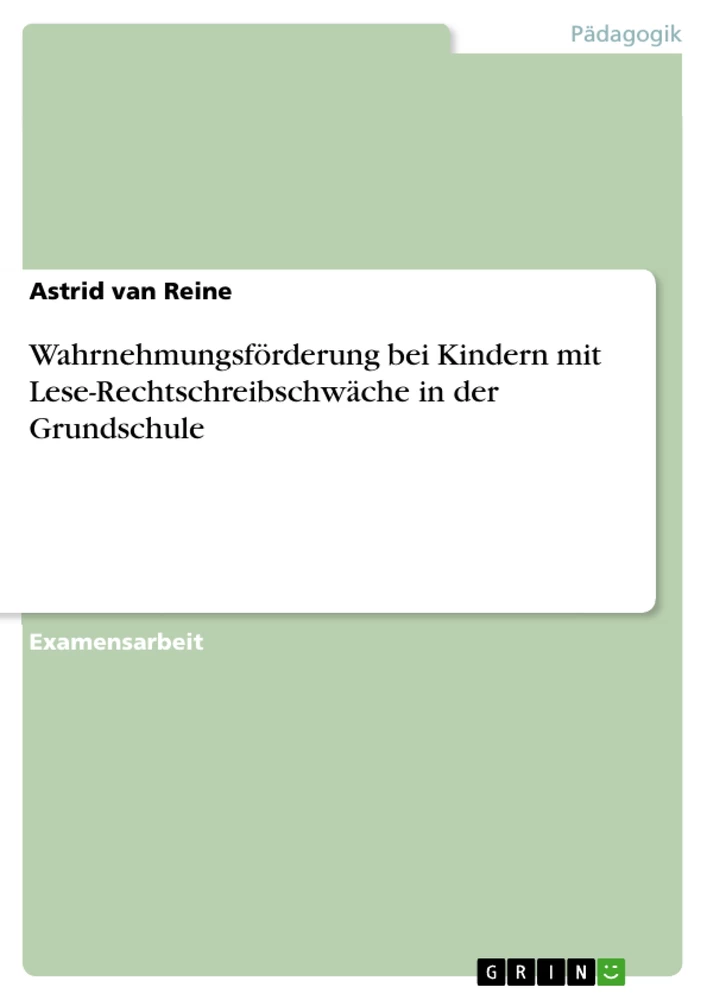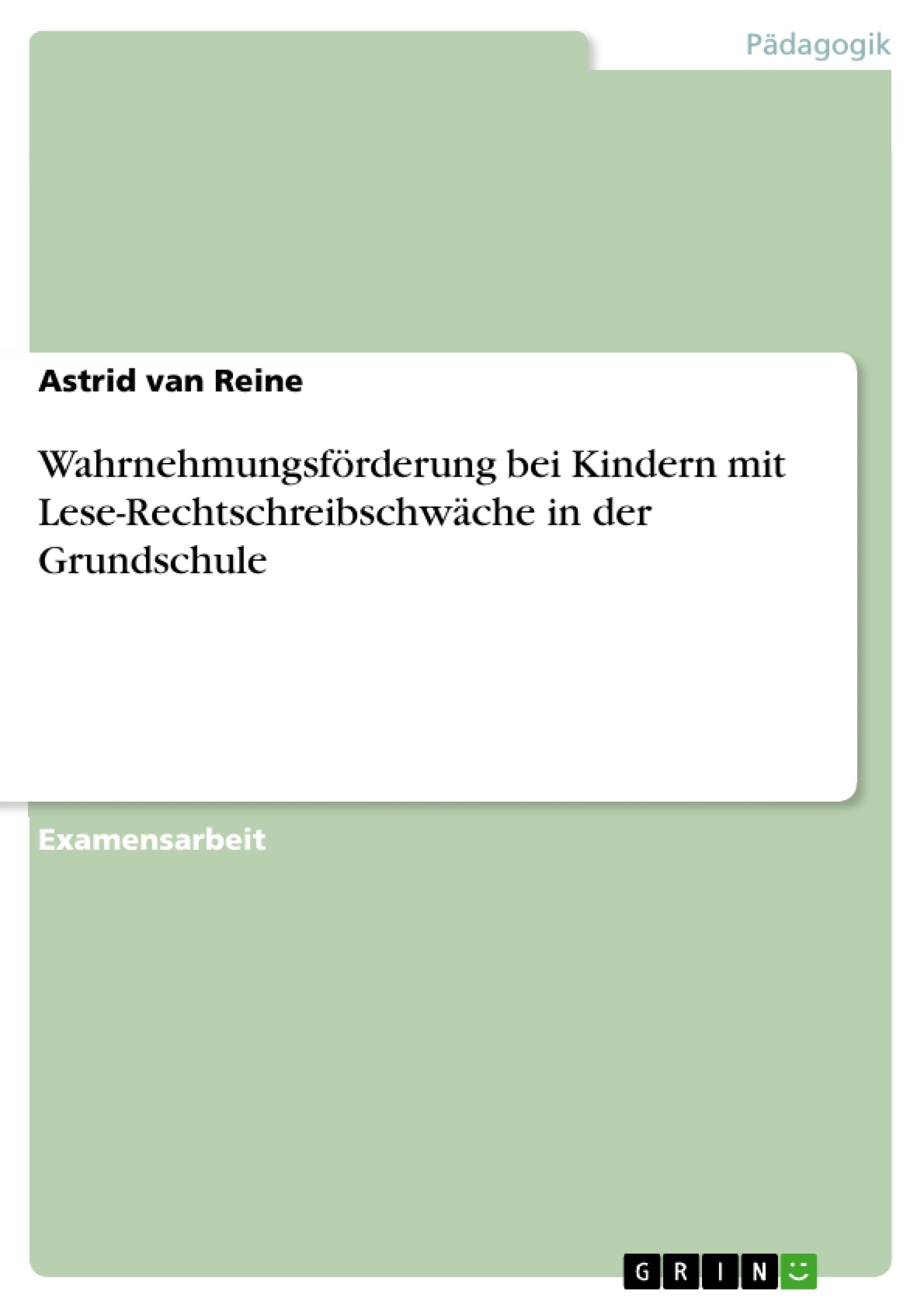„Streng dich an!“, „Konzentriere dich!“, „Pass besser auf!“... all diese Kommentare bekommen viele Kinder in der Grundschule zu hören. Doch stimmt es, dass diese Kinder sich nicht anstrengen, sich nicht konzentrieren oder nicht aufpassen, wenn sie Probleme beim Lesen und Schreiben lernen haben?
In der Schule werden bestimmte Anforderungen an Kinder gestellt, die jedoch nicht von allen erfüllt werden können. Die betroffenen Kinder fallen meistens durch Konzentrationsschwierigkeiten auf, können sich nur schwer Buchstaben einprägen, vertauschen beim Schreiben ähnlich aussehende Buchstaben und lassen sich – scheinbar unbegründet – im Unterricht schnell ablenken (vgl. GÜNTHER 1998, 4). Oft werden diese Symptome als ‚Wahrnehmungsauffälligkeiten’ beschrieben. Sie werden unter anderem als Ursache dafür gesehen, warum Kinder unter erschwerten Bedingungen lesen und schreiben lernen.
Im Rahmen dieser Arbeit werde ich auf das Thema der Wahrnehmungsförderung bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) in der Grundschule eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 2. Wahrnehmung
- 2.1 Bedeutung der Wahrnehmung
- 2.2 Neurophysiologische Grundlagen
- 2.3 Der Prozess der Wahrnehmung
- 2.4 Die Sensorische Integration
- 2.5 Die für die Wahrnehmung bedeutsamen Sinnessysteme und ihre Bedeutung für schulisches Lernen
- 2.5.1 Der taktile Analysator
- 2.5.2 Der kinästhetische Analysator
- 2.5.3 Der vestibuläre Analysator
- 2.5.4 Der visuelle Analysator
- 2.5.5 Der auditive Analysator
- 2.6 Die Entwicklung der Wahrnehmung
- 2.7 Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Bewegung
- 2.8 Resümee
- 3. Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)
- 3.1 Begriffbestimmung
- 3.2 Erklärungsansätze zur Ursachenforschung der LRS
- 3.2.1 Medizinischer Ansatz
- 3.2.2 Psychologischer Ansatz
- 3.2.3 Soziologischer Ansatz
- 3.2.4 Pädagogischer Ansatz
- 3.2.5 Das Teilleistungskonzept
- 3.2.6 Stufenmodell der Schriftsprachentwicklung
- 3.2.7 Praxisrelevanz der Ansätze
- 3.3 Symptomatik und Erscheinungsbilder
- 3.3.1 Probleme des Lesens
- 3.3.2 Probleme des Rechtschreibens
- 3.3.3 Probleme der Motorik
- 3.3.4 Probleme des Verhaltens
- 3.4 Diagnose
- 3.4.1 Die Differenzierungsprobe für Sechs- bis Siebenjährige
- 3.4.2 Die Funktionsprobe für Lese- und Schreiblernvoraussetzungen nach SOMMER-STUMPENHORST
- 3.5 Resümee
- 4. Die Situation von Kindern mit LRS in der Grundschule
- 4.1 Der LRS-Erlass NRW
- 4.2 Der Lehrplan Sprache
- 4.3 Die psycho-soziale Lage
- 4.3.1 Die gegenwärtige Situation von Schülern mit LRS
- 4.3.2 Die Situation in der Familie
- 4.3.3 Die soziale Eingliederung in der Klasse
- 4.3.4 Die Einstellung des betroffenen Kindes zu sich selbst
- 4.3.5 Psychosomatische Beschwerden
- 4.4 Resümee
- 5. Wahrnehmungsförderung im Schulalltag bei Kindern mit LRS
- 5.1 Wahrnehmungsförderprogramme
- 5.1.1 Der Kieler Lese- und Schreibaufbau
- 5.1.2 Die Sinnesschulung von MONTESSORI
- 5.1.3 Die Förderung nach BREUER/WEUFFEN
- 5.1.4 Das Förderprogramm nach SOMMER-STUMPENHORST
- 5.2 Förderung im Sportunterricht
- 5.2.1 Wahrnehmungsförderung in der Psychomotorik
- 5.2.2 Praxisbeispiele aus der Psychomotorik
- 5.3 Förderung im Elternhaus
- 5.4 Der Einsatz von Computern in der Wahrnehmungsförderung
- 5.5 Grenzen der Wahrnehmungsförderung
- 5.6 Resümee
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Wahrnehmungsförderung bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) in der Grundschule. Sie analysiert die Bedeutung der Wahrnehmung für den schulischen Lernerfolg und beleuchtet die Herausforderungen, die Kinder mit LRS in ihrem Schulalltag erleben. Die Arbeit untersucht verschiedene Erklärungsansätze für die Ursachen der LRS und stellt verschiedene Förderprogramme vor, die sich mit der Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeiten von Kindern mit LRS befassen.
- Die Bedeutung der Wahrnehmung für das schulische Lernen
- Die Herausforderungen, die Kinder mit LRS im Schulalltag erleben
- Erklärungsansätze für die Ursachen der LRS
- Verschiedene Förderprogramme zur Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeiten von Kindern mit LRS
- Der Einsatz von verschiedenen Fördermethoden im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Wahrnehmung für den Menschen und beschreibt den Prozess der Wahrnehmung anhand verschiedener Sinnessysteme. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und analysiert verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung dieser Störung. Es werden verschiedene Symptome und Erscheinungsbilder der LRS sowie verschiedene Diagnosemethoden vorgestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich der Situation von Kindern mit LRS in der Grundschule und beleuchtet die verschiedenen Herausforderungen, die diese Kinder in ihrem Schulalltag erleben. Es werden Aspekte wie der LRS-Erlass in NRW, der Lehrplan Sprache, die psycho-soziale Lage und die Einstellung des betroffenen Kindes zu sich selbst behandelt.
Das fünfte Kapitel behandelt die Thematik der Wahrnehmungsförderung im Schulalltag bei Kindern mit LRS. Es werden verschiedene Förderprogramme vorgestellt, die sich mit der Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeiten von Kindern mit LRS befassen. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten im Sportunterricht, im Elternhaus und durch den Einsatz von Computern beleuchtet. Die Grenzen der Wahrnehmungsförderung werden ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit fokussiert sich auf die Themen Wahrnehmungsförderung, Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Sinnessysteme, Förderung im Schulalltag, Erklärungsansätze für LRS, Diagnosemethoden, psychosoziale Lage, Förderprogramme, Sportunterricht, Elternhaus, Einsatz von Computern, Grenzen der Wahrnehmungsförderung.
- Quote paper
- Astrid van Reine (Author), 2002, Wahrnehmungsförderung bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11451