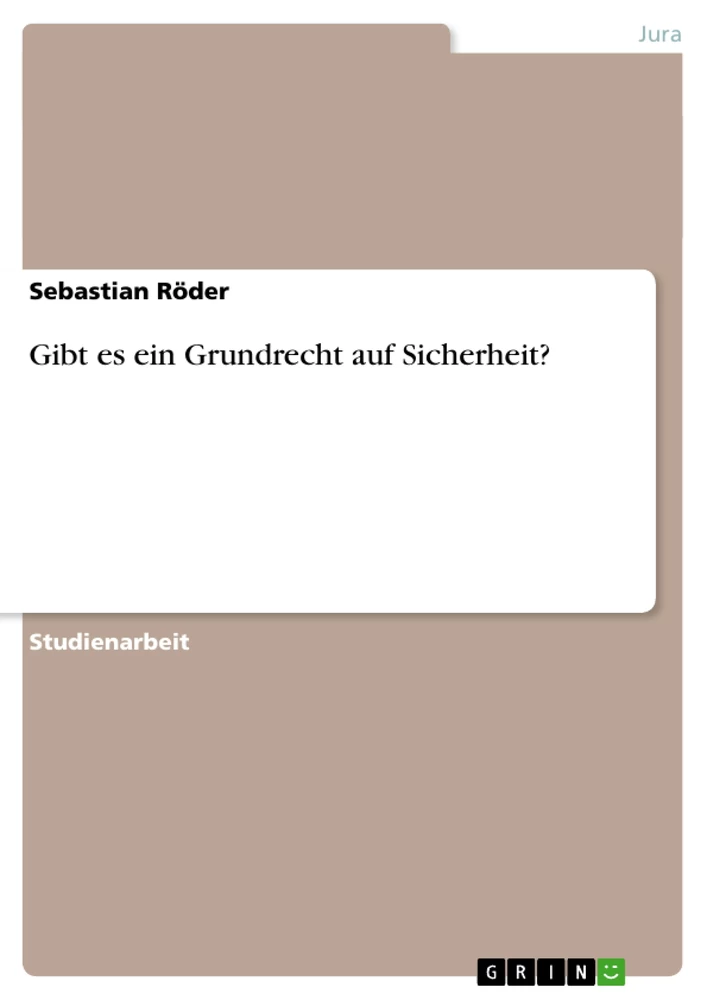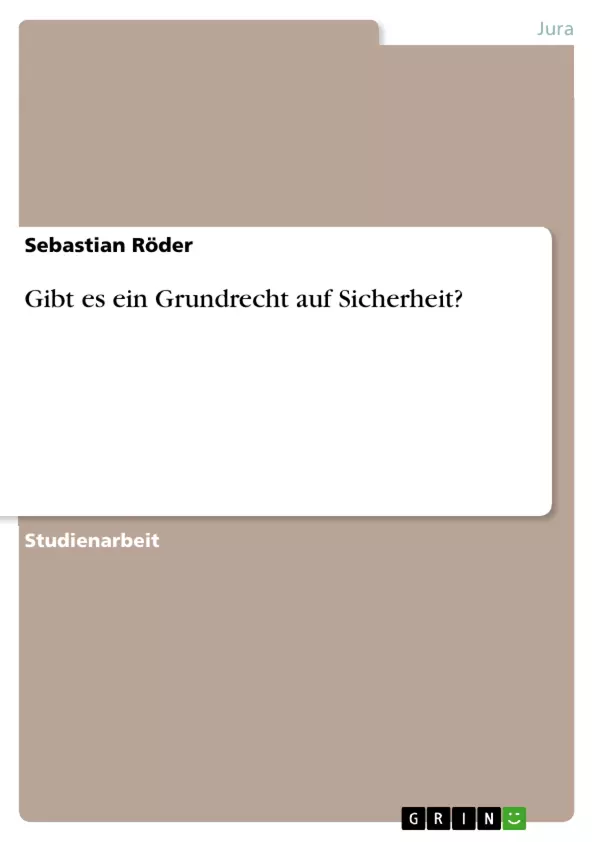Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des Grundrechts auf Sicherheit, einem Recht, das zumindest im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht explizit kodifiziert wurde. Zwar gab es bei den Beratungen des Parlamentarischen Rats Überlegungen bezüglich einer solchen Kodifikation eines Grundrechts auf „Freiheit und Sicherheit“, allerdings verstand man dieses mehr als Ausfluss der individuellen Freiheit, also ganz im Sinne einer abwehrrechtlichen Funktion.
Sicherheit ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht als Schutz vor staatlicher Gewalt zu verstehen, wie es der klassischen „status negativus Funktion“ entsprechen würde, sondern vielmehr als eine Sicherheit, die durch den Staat gewährleistet wird. Die Rechte des Grundrechtsträgers werden also nicht nur vor Eingriffen des Staates geschützt, sondern auch vor Beeinträchtigungen durch Dritte. Der Staat ist somit nicht mehr nur zu einem negativen Unterlassen, sondern auch zu einem positiven Tun verpflichtet um effektiven Grundrechtsschutz gewährleisten zu können. Problematisch an dieser „neuen“ Funktion ist, dass sie sich explizit nirgendwo dem Wortlaut der Verfassung entnehmen lässt ganz im Gegensatz zu der abwehrrechtlichen Funktion. Dennoch lassen sich der Verfassung zumindest Hinweise darauf entnehmen, dass eine solche Funktion auch vom Verfassungsge-ber mit eingeplant worden ist. Diese Untersuchung ist Aufgabe dieser Arbeit. Hierbei werde ich in einem ersten Schritt zunächst auf den ideengeschichtlichen Hintergrund eingehen. Es wird sich herausstellen, dass schon die aufklärerischen Denker des 17. und 18. Jahrhunderts, von deren Werken die europäischen Verfas-sungen und die Nordamerikas maßgeblich beeinflusst wurden, bereits das Prob-lem einer Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit erkannten.
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG. IDEENGESCHICHTLICHER HINTERGRUND
- I. Thomas Hobbes
- II. John Locke
- B. DAS RECHT AUF SICHERHEIT IN DEN ERSTEN VERFASSUNGEN
- I. Das Recht auf Sicherheit in den USA.
- II. Das Recht auf Sicherheit in Frankreich.....
- C. DER WORTLAUT DES GRUNDGESTZES
- D. DIE ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
- E. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Grundrechts auf Sicherheit, das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nicht explizit kodifiziert ist. Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern sich aus dem Grundgesetz Hinweise auf eine staatliche Schutzpflicht ableiten lassen, die über die klassische abwehrrechtliche Funktion hinausgeht.
- Ideengeschichtlicher Hintergrund: Die Arbeit analysiert die Ansichten von Thomas Hobbes und John Locke zur Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit.
- Erste Verfassungen: Die Arbeit untersucht, ob die ersten modernen Verfassungen in den USA und Frankreich ein positiviertes Grundrecht auf Sicherheit enthielten.
- Wortlaut des Grundgesetzes: Die Arbeit analysiert den Wortlaut des Grundgesetzes, um herauszufinden, ob sich aus ihm eine staatliche Schutzpflicht ableiten lässt.
- Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Begründung und Akzeptanz staatlicher Schutzpflichten beigetragen hat.
- Entwicklung des Grundrechts auf Sicherheit: Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Grundrechts auf Sicherheit von den frühen Verfassungen bis zum heutigen Tag.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Existenz eines Grundrechts auf Sicherheit im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit untersucht, ob und inwiefern sich aus dem Grundgesetz Hinweise auf eine staatliche Schutzpflicht ableiten lassen, die über die klassische abwehrrechtliche Funktion hinausgeht.
Im ersten Kapitel wird der ideengeschichtliche Hintergrund des Grundrechts auf Sicherheit beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Ansichten von Thomas Hobbes und John Locke zur Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit. Hobbes argumentierte, dass der Staat die Aufgabe hat, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, auch wenn dies Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen erfordert. Locke hingegen betonte die Bedeutung individueller Freiheit und sah den Staat als Garant dieser Freiheit.
Das zweite Kapitel untersucht, ob die ersten modernen Verfassungen in den USA und Frankreich ein positiviertes Grundrecht auf Sicherheit enthielten. Die Arbeit zeigt, dass die amerikanischen und französischen Verfassungen zwar die Bedeutung von Sicherheit betonten, aber kein explizites Grundrecht auf Sicherheit kodifizierten.
Das dritte Kapitel analysiert den Wortlaut des Grundgesetzes, um herauszufinden, ob sich aus ihm eine staatliche Schutzpflicht ableiten lässt. Die Arbeit zeigt, dass das Grundgesetz zwar kein explizites Grundrecht auf Sicherheit enthält, aber einige Formulierungen eine Interpretation hinsichtlich der Annahme staatlicher Schutzpflichten grundsätzlich erlauben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Grundrecht auf Sicherheit, die staatliche Schutzpflicht, die Vereinbarkeit von Freiheit und Sicherheit, die ideengeschichtliche Entwicklung des Grundrechts auf Sicherheit, die ersten modernen Verfassungen, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es im deutschen Grundgesetz ein explizites Grundrecht auf Sicherheit?
Nein, ein eigenständiges Grundrecht auf Sicherheit ist im Wortlaut des Grundgesetzes nicht explizit kodifiziert. Es wird jedoch oft als Teil der staatlichen Schutzpflichten aus anderen Grundrechten abgeleitet.
Was unterscheidet Thomas Hobbes und John Locke in Bezug auf Sicherheit?
Thomas Hobbes sah den Staat als Garanten der Sicherheit, der auch Freiheit einschränken darf, um Chaos zu verhindern. John Locke hingegen betonte die individuelle Freiheit und sah den Staat primär als Schützer dieser natürlichen Rechte.
Was versteht man unter der staatlichen Schutzpflicht?
Die staatliche Schutzpflicht verpflichtet den Staat zu einem aktiven Handeln, um die Grundrechte seiner Bürger vor Eingriffen durch Dritte (z. B. Kriminelle) zu schützen, statt nur auf eigene Eingriffe zu verzichten.
Wie hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf Sicherheit geprägt?
Durch verschiedene wegweisende Entscheidungen hat das Gericht die staatlichen Schutzpflichten konkretisiert und anerkannt, dass der Staat eine positive Verpflichtung zum Schutz von Leib und Leben hat.
Enthalten die Verfassungen der USA oder Frankreichs ein Recht auf Sicherheit?
Obwohl beide historischen Verfassungen die Bedeutung der Sicherheit betonen, kodifizierten sie kein einklagbares, positives Grundrecht auf Sicherheit im modernen Sinne, sondern sahen Sicherheit eher als Zweck des Staates.
- Quote paper
- Sebastian Röder (Author), 2003, Gibt es ein Grundrecht auf Sicherheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114442