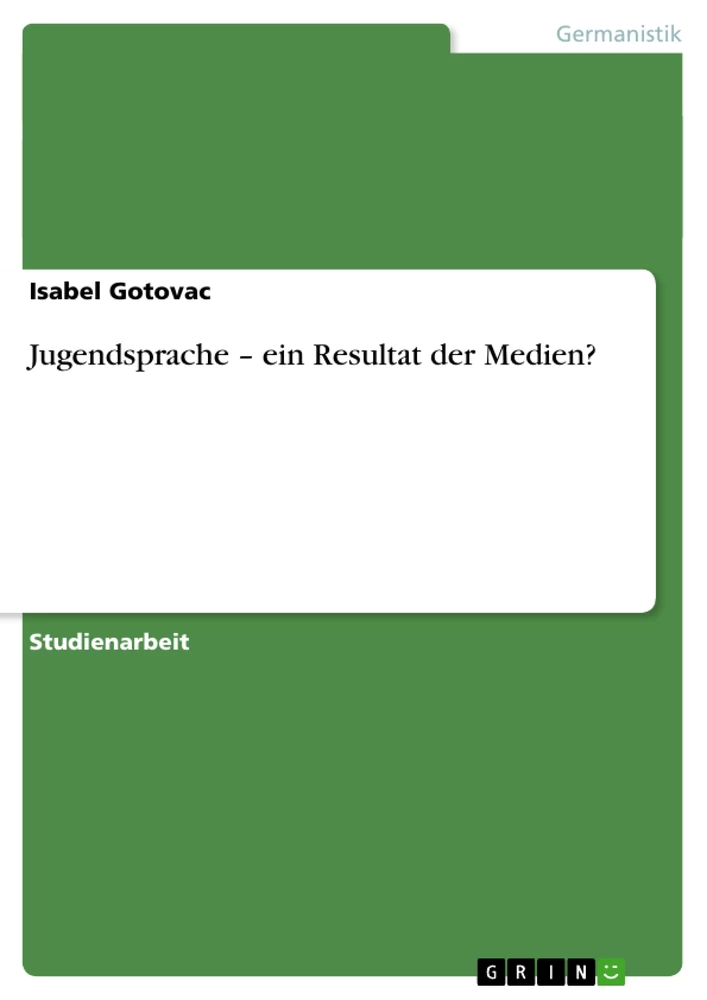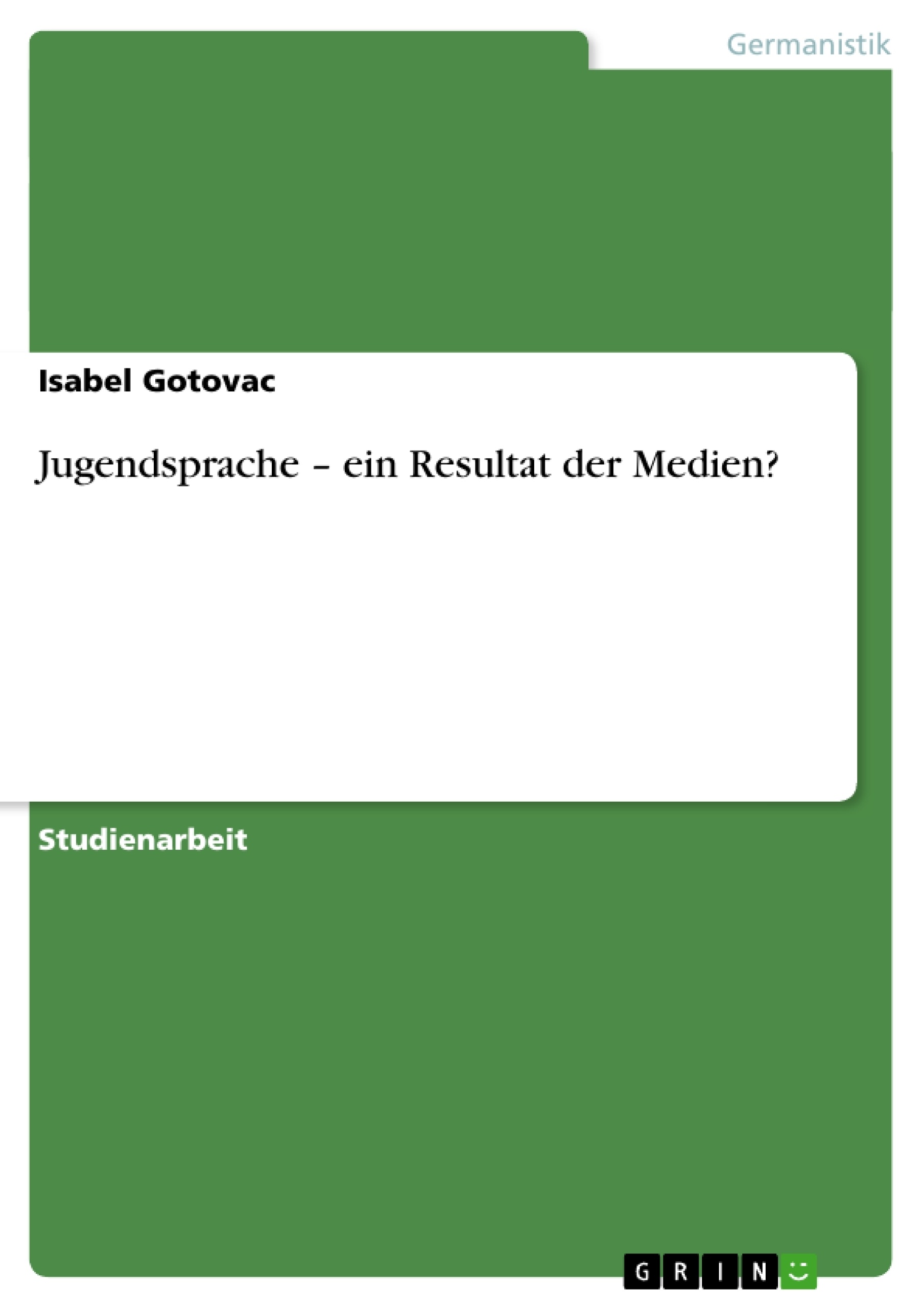„Wer auf andre Leute wirken will, der muß erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen
reden“
Das Zitat Tucholskys beschreibt, inwieweit die Beherrschung des jeweiligen
Sprachcodes innerhalb einer Kommunikation relevant sein kann.
Fehlt das Verständnis für die Sprache des jeweiligen Gegenübers, wird die
Kommunikation früher oder später scheitern. Sprache hat nicht nur mit dem Verstehen
des jeweiligen Sprachsystems (Deutsch, Italienisch, Chinesisch etc.) zu tun, sondern
auch mit der Anpassung des eigenen Sprachverhaltens an den Wandel der Zeit und an
die daraus resultierenden Neologismen in unserem Sprachalltag. Das angeführte Zitat
Tucholskys auf die heutige Zeit angewandt, beschreibt die Sprachbarriere, die sich
schon heute im Sprachverständnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen auftut.
Geil, fett und chillig sind nur wenige der jugendsprachlichen Ausdrücke, die in keiner
wissenschaftlichen Fachsprache zu finden sind, sondern mehr dem Inhalt des
jugendlichen Sprachgebrauchs zuzuordnen sind. Nachdem das Thema Jugendsprache,
ausgelöst durch die Jugendrevolten Ende der 70er Jahre, zum Gegenstand öffentlicher
Diskussionen wurde, wurde sie auch Objekt der sprachwissenschaftlichen Forschung.
Die erste Untersuchung zur Jugend unternahm der Germanist Helmut Henne. Dieser
musste 1981 bedauernd resümieren, dass Jugendsprache als Forschungsobjekt in der
linguistischen Jugendsprachforschung nicht existierte. Jugendsprache als
Forschungsgegenstand ist ein offenes und weites Feld, Kenntnisse der Sozio- und
Pragmalinguistik sind unabdingbar, die Herangehensweise an dieses Thema erweist sich
mehr als vielfältig.
Vulgär, niveaulos und ungepflogen finden sie diejenigen, die sich einer anderen
Sprache, der so genannten Standardsprache bedienen. Die vielschichtige Problematik
der ziemlich umstrittenen Jugendsprache wurde besonders in den 80er und 90er Jahren
von vielen Linguisten allseitig beschrieben...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Sprache in der Sprache- Was ist Jugendsprache?
- 1.2 Jugendsprache innerhalb des deutschen Sprachsystems
- 1.3 Sprachliche Merkmale der Jugendsprache
- 2. Jugendliche und die Medien
- 2.1 Die Orientierung der Sprache an den Medien
- 2.2 Jugendsprache gleich Mediensprache?
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Jugendsprache als eigenständiges Sprachgefüge im deutschen Sprachsystem und betrachtet sie als Spiegel der Medien. Ziel ist es, die sprachlichen Merkmale der Jugendsprache zu beleuchten und ihren Zusammenhang mit den Medien zu analysieren. Aufgrund der Dynamik des Themas kann nur ein Ausschnitt der Jugendsprache behandelt werden.
- Definition und Abgrenzung von Jugendsprache
- Jugendsprache als Teil des deutschen Sprachsystems
- Sprachliche Merkmale der Jugendsprache
- Einfluss der Medien auf Jugendsprache
- Jugendsprache als Spiegelbild der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Relevanz von Sprachverständnis in der Kommunikation und die Herausforderungen, die sich aus dem unterschiedlichen Sprachgebrauch zwischen Erwachsenen und Jugendlichen ergeben. Sie führt in das Thema Jugendsprache ein, skizziert die Geschichte der sprachwissenschaftlichen Forschung auf diesem Gebiet und beschreibt die Vielschichtigkeit der Problematik. Die Arbeit konzentriert sich auf die Jugendsprache als eigenständiges Sprachsystem und ihren Bezug zu den Medien. Der Fokus liegt auf der Analyse der sprachlichen Merkmale und der Reflexion der Medien im Sprachgebrauch Jugendlicher. Der einleitende Teil betont den umfangreichen Forschungsbedarf im Kontext dieses dynamischen Phänomens.
2. Sprache in der Sprache- Was ist Jugendsprache?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Jugendsprache. Es diskutiert die Vielfältigkeit des deutschen Sprachsystems und positioniert Jugendsprache als einen Teilaspekt davon. Die Definition von Jugendsprache wird anhand soziolinguistischer und pragmatischer Aspekte beleuchtet, wobei der zeitliche und gesellschaftliche Kontext hervorgehoben wird. Die Jugendsprache wird als ein sich ständig wandelndes Phänomen dargestellt, das als „Modesprache“ oder „Zeitsprache“ interpretiert werden kann. Der Kapitelteil unterstreicht den dynamischen und historisch bedingten Charakter von Jugendsprache.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Mediensprache, Sprachwandel, Soziolinguistik, Pragmalinguistik, Sprachsystem, Sprachmilieus, Neologismen, Kommunikation, Generationensprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Jugendsprache und Medien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Jugendsprache als eigenständiges Sprachsystem innerhalb des Deutschen und analysiert ihren Zusammenhang mit den Medien. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der sprachlichen Merkmale und der Reflexion des Medieneinflusses im Sprachgebrauch Jugendlicher.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über die Definition und Merkmale der Jugendsprache und ihre Beziehung zu den Medien, und abschließend ein Fazit. Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas, skizziert die Geschichte der Forschung und beschreibt die Komplexität der Jugendsprache. Kapitel zwei konzentriert sich auf die Definition, die sprachlichen Merkmale und den Einfluss der Medien. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Jugendsprache definiert?
Die Arbeit definiert Jugendsprache soziolinguistisch und pragmatisch als einen dynamischen, sich ständig wandelnden Teilaspekt des deutschen Sprachsystems. Sie wird als "Modesprache" oder "Zeitsprache" beschrieben, die historisch bedingt und einem steten Wandel unterliegt.
Welche sprachlichen Merkmale der Jugendsprache werden untersucht?
Die Arbeit beschreibt zwar nicht explizit alle untersuchten Merkmale, hebt aber die Notwendigkeit der Analyse sprachlicher Merkmale hervor und benennt implizit Bereiche wie Neologismen und den Einfluss der Mediensprache auf die Jugendsprache.
Welche Rolle spielen die Medien in der Jugendsprache?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Medien auf die Jugendsprache und betrachtet die Jugendsprache als Spiegel der Medien. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit Mediensprache und Jugendsprache übereinstimmen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Mediensprache, Sprachwandel, Soziolinguistik, Pragmalinguistik, Sprachsystem, Sprachmilieus, Neologismen, Kommunikation, Generationensprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die sprachlichen Merkmale der Jugendsprache zu beleuchten und ihren Zusammenhang mit den Medien zu analysieren. Aufgrund der Dynamik des Themas wird nur ein Ausschnitt der Jugendsprache behandelt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist im vorliegenden Auszug nicht explizit dargestellt. Es wird aber implizit deutlich gemacht, dass die Arbeit die Komplexität und den dynamischen Charakter der Jugendsprache und ihren Bezug zu den Medien beleuchtet.)
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Isabel Gotovac (Auteur), 2004, Jugendsprache – ein Resultat der Medien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114339