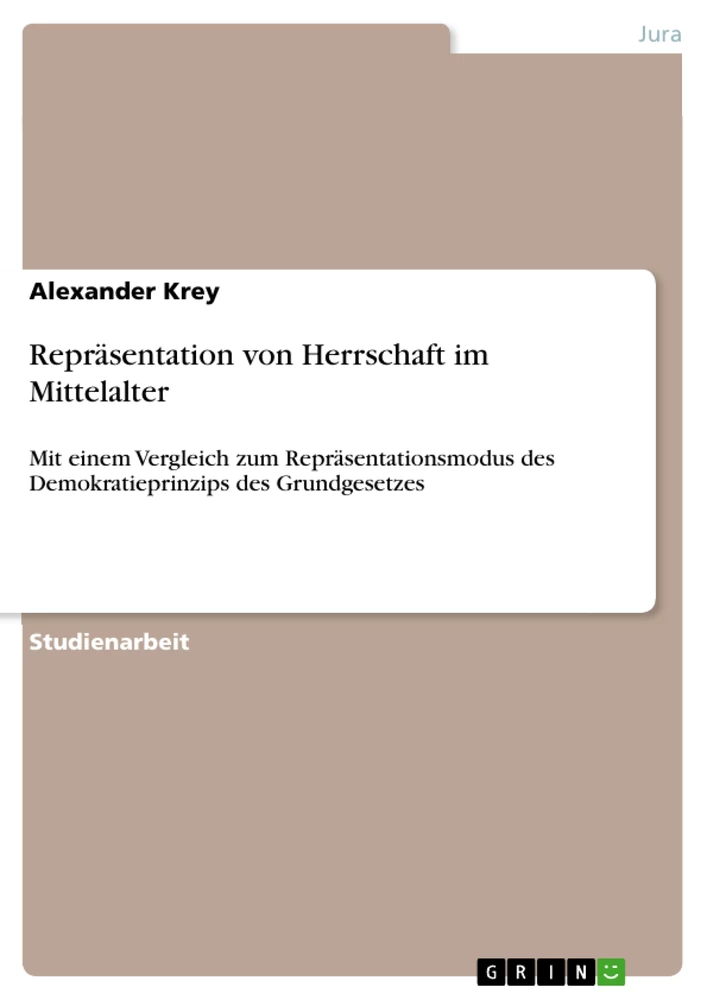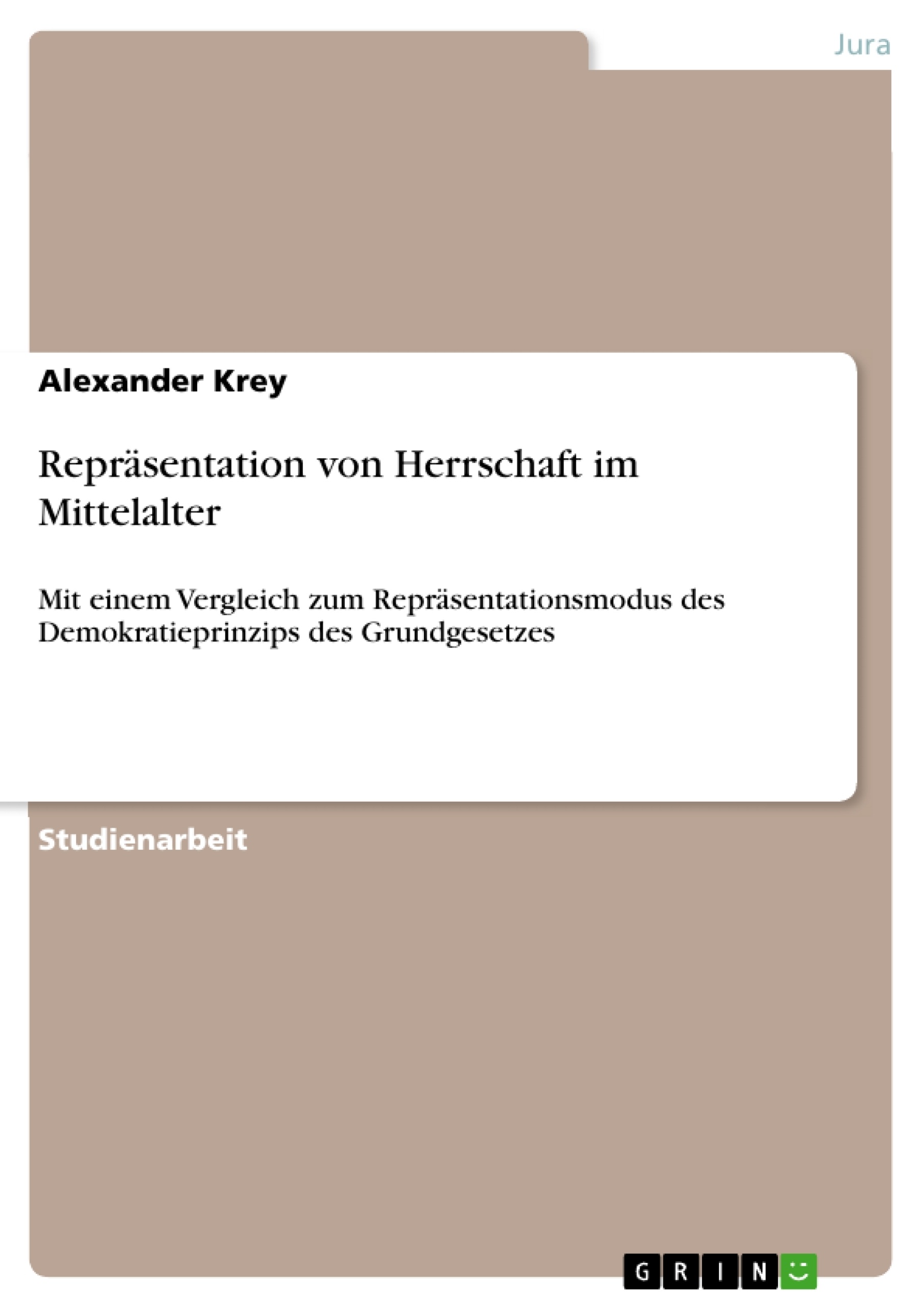In Deutschland gibt es keinen terminologischen Konsens zum Begriff der Repräsentation.1 Im Grundsatz kann aber zwischen einer stärker rechtlich-politischen Sichtweise als Stellvertretung sowie einer mehr theologischen Betrachtungsart als Vergegenwärtigung vorgegebener Ideen und Ordnungsstrukturen unterschieden werden.2 Beiden Bedeutungsweisen liegt als gemeinsame Wurzel der lateinische Begriff repraesentatio zu Grunde. Auch wenn beide Formen des Wortgebrauchs begrifflich sehr wohl unterschieden werden können und auch müssen, so sind sie im Mittelalter wie überhaupt Staat und Kirche eng mit einander verbunden und kaum zu trennen. Repräsentation bedeutete für die Herrschenden des Mittelalters in einem sehr starkem Maße die Sichtbarmachung der sozialen Stellung, da der die Herrschaft legitimierende Konsens kein auf ewig erlangter Status war, sondern fortwährend hergestellt und herbeigeführt werden musste.3 Die Notwendigkeit der Vergegenwärtigung von Herrschaft folgte aus der ständigen Notwendigkeit der Legitimation der Herrschaft.4 Zeremoniell und Symbolik als Repräsentationsmittel spielten daher eine große, wenn nicht sogar beherrschende Rolle bei den großen Staatsaktionen des Reiches und der Territorien: So wurden die Reichsfürsten mittels der Übergabe einer Fahne belehnt, der Ritterschlag geschah durch Berührung mit der ritterlichen Waffe des Schwertes und die Kurfürsten bekundeten dem Kaiser ihre Unterwerfung, indem sie ihm als Marschall, Kämmerer, Truchseß und Mundschenk symbolisch dienten.5 Diese reichhaltige Symbolik veranschaulichte Rechtsgeschäfte und machte so das Herrschafts- und Anhängigkeitsverhältnis für jedermann sinnlich wahrnehmbar.6 Mittels dieser Symbolik wurde Herrschaft repräsentiert und Rechtssicherheit erst ermöglicht.7 Im Grunde genommen wurde nicht darstellbares Recht über das Mittel der Symbolik in eine darstellbare Form überführt. Repräsentation war hierbei auch zugleich Kommunikation:8 In der mittelalterlichen Gesellschaft musste sich der Mensch fortwährend durch die Darstellung dessen ausweisen, was er war und zu sein beanspruchte.9
1 Hofmann 2003, S. 16.
2 Wenzel 2005, S. 27.
3 vgl. Sauter 2003, S. 11.
4 Sauter 2003, S. 11.
5 Andermann, AmrhKG 1990, S. 125 (125).
6 vgl. Andermann, AmrhKG 1990, S. 125 (125).
7 Becker, HRG IV, Sp. 337 (338).
8 Sauter 2003, S. 12 f.
9 Wenzel 2005, S. 11.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- B. Herrschaftsrepräsentation mittels sakraler Bauten
- I. Dombau in Lübeck unter Heinrich dem Löwen
- II. Gründung des Klosters Tulln durch König Rudolf
- C. Repräsentation von Herrschaft in Korporationen
- I. mittelalterliche Korporationslehre
- II. Repräsentation durch das Haupt
- III. Repräsentation durch den Körper
- IV. Das Volk der Bundesrepublik im Vergleich zur universitas
- 1. Das Demokratieprinzip des Grundgesetzes
- 2. Das Bundesvolk des Art. 20 Abs. 2 GG und die universitas
- V. Repräsentation durch den Bundespräsidenten
- VI. Repräsentation durch den Bundestag
- D. Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Repräsentation von Herrschaft im Mittelalter. Ziel ist es, verschiedene Formen der Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden sowohl sakrale Bauten als auch Korporationen als Repräsentationsformen untersucht.
- Repräsentation von Herrschaft durch sakrale Bauten
- Repräsentation von Herrschaft durch Korporationen
- Die Rolle des Volkes in der Repräsentation von Herrschaft
- Die Bedeutung von Symbolen und Ritualen in der Herrschaftsrepräsentation
- Vergleich der mittelalterlichen Repräsentation von Herrschaft mit modernen Formen der Repräsentation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und führt in die Thematik der Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter ein. Im zweiten Kapitel werden sakrale Bauten als Repräsentationsformen von Herrschaft analysiert. Am Beispiel des Dombaues in Lübeck unter Heinrich dem Löwen und der Gründung des Klosters Tulln durch König Rudolf wird gezeigt, wie sakrale Bauten zur Stärkung der Herrschaftslegitimation und zur Repräsentation von Macht eingesetzt wurden. Das dritte Kapitel widmet sich der Repräsentation von Herrschaft in Korporationen. Zunächst wird die mittelalterliche Korporationslehre erläutert. Anschließend werden verschiedene Formen der Repräsentation durch Korporationen untersucht, wie die Repräsentation durch das Haupt, den Körper und das Volk. Im Vergleich zur universitas wird das Volk der Bundesrepublik Deutschland als Repräsentationsform des Staates betrachtet. Abschließend werden die Repräsentationsformen des Bundespräsidenten und des Bundestages analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Repräsentation von Herrschaft, sakrale Bauten, Korporationen, mittelalterliche Korporationslehre, das Volk, der Bundespräsident, der Bundestag, das Demokratieprinzip, das Grundgesetz, Symbolen und Ritualen, Herrschaftslegitimation, Macht und mittelalterliche Geschichte.
- Quote paper
- Referendar jur. Alexander Krey (Author), 2006, Repräsentation von Herrschaft im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114320