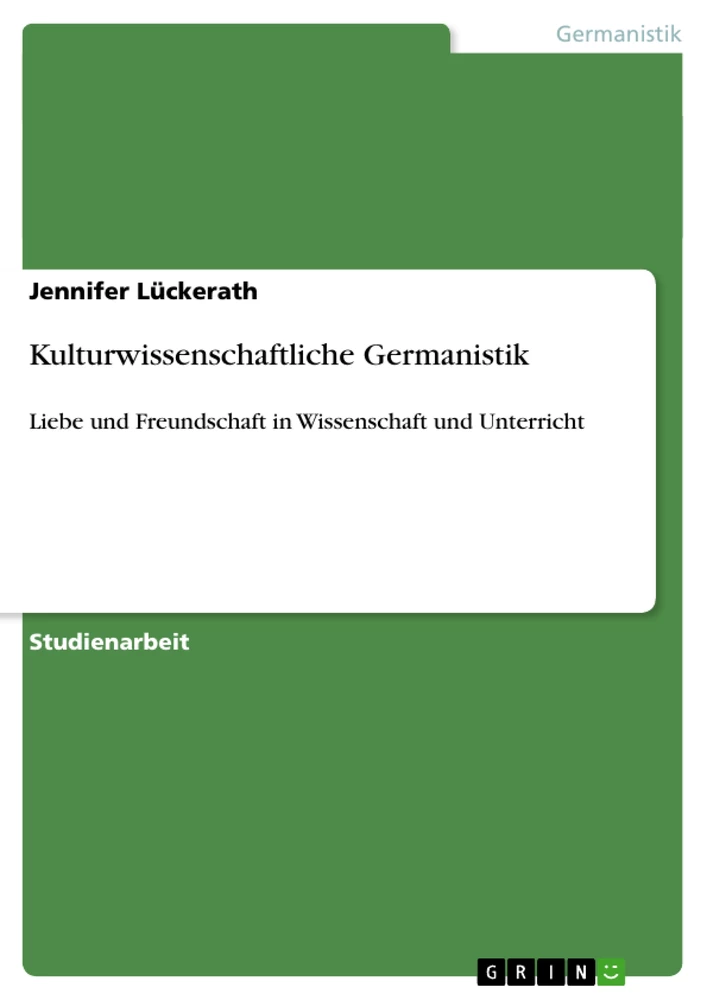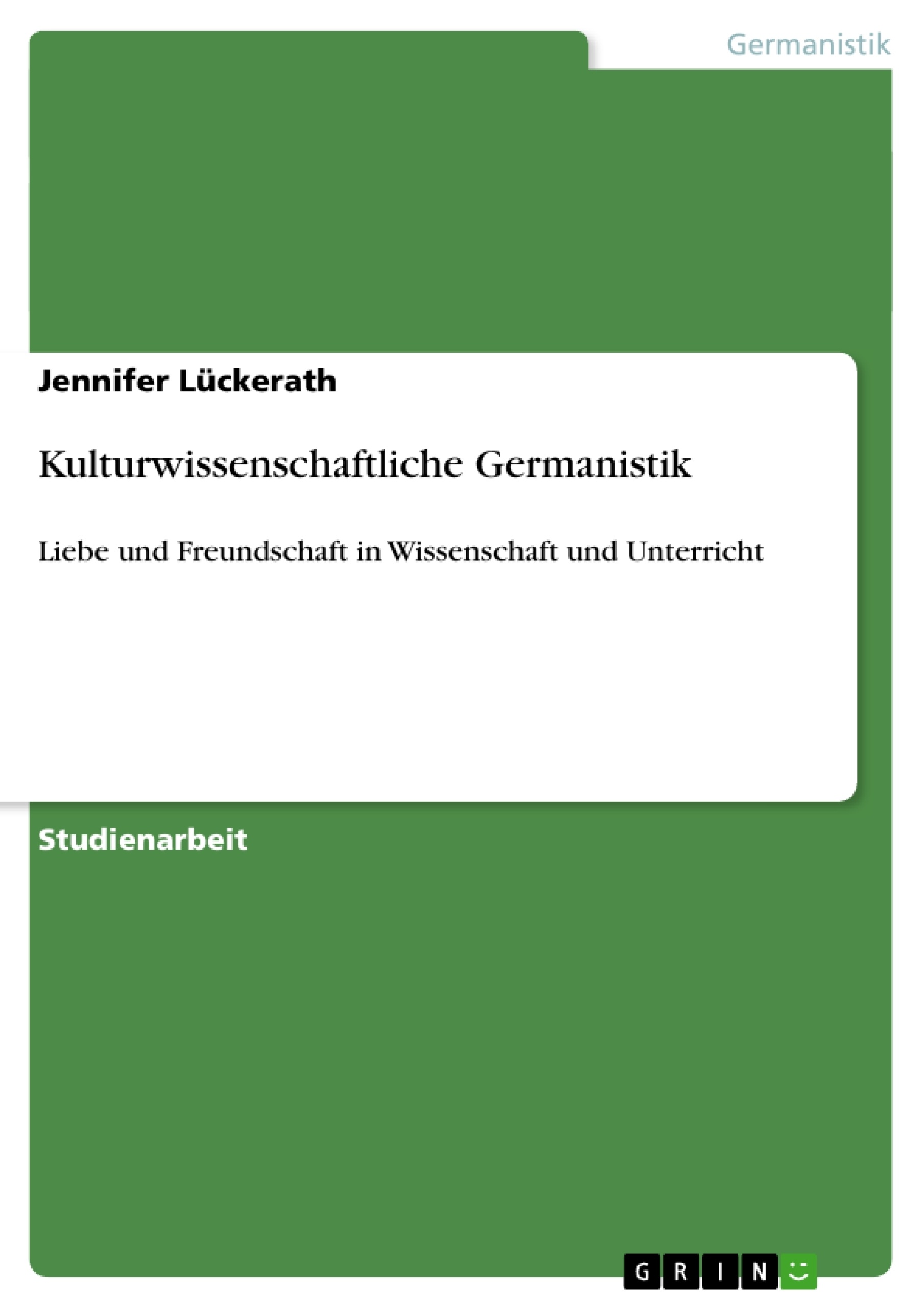„Kultur ist soziale Ordnung, welche schöpferische Tätigkeiten begünstigt. Vier Elemente setzen sie zusammen: Wirtschaftliche Vorsorge, politische Organisation, moralische Traditionen und das Streben nach Wissenschaft und Kunst. Sie beginnt, wo Chaos und Unsicherheit enden. Neugier und Erfindungsgeist werden frei, wenn die Angst besiegt ist, und der Mensch schreitet aus natürlichem Antrieb dem Verständnis und der Verschönerung des Lebens entgegen.“
Auf der Grundlage des Hauptseminars mit dem Titel „Kulturwissenschaftliche Germanistik IX: Liebe und Freundschaft in Wissenschaft und Unterricht“ ist vorliegende Seminararbeit verfasst mit dem Ziel, kulturwissenschaftliche Aspekte des Themas Liebe und Freundschaft zu beleuchten, um dann didaktische Überlegungen anzustellen, wie es in adäquater Form im Unterricht zum Einsatz kommen kann.
Zunächst wird der Begriff Kultur aus wissenschaftlicher Sicht erläutert als Grundlage für die Sichtweise des eigentlichen Themas „Liebe und Freundschaft“, da die Definition dessen immer auch abhängig ist von der Kultur des Betrachters. Als Thema für die Unterrichtsreihe werden Ideen zur didaktischen Umsetzung
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Kultur(wissenschaft) – eine Definition
2 Liebe und Freundschaft
2.1 Liebe und Freundschaft als Thema für die Unterrichtsreihe
2.1.1 Ideen zur didaktischen Umsetzung
2.1.2 Puzzle zum Thema „Freundschaft/Liebe“
2.1.3 Liebeslied
2.1.4 Materialsammlung
3 Lernziele – Lernwege
4 Lektüre: Der gelbe Vogel (Myron Levoy)
4.1 Allgemeines zum Buch
4.2 Wie kann das Buch für den Unterricht verwendet werden?
4.2.1 Das Lesetagebuch
4.2.2 Hinweise für Schüler / Lesetagebuch:
4.2.3 Mögliche Aufgaben für das Lesetagebuch
5 Resümee
6 Literaturverzeichnis
Einleitung
„Kultur ist soziale Ordnung, welche schöpferische Tätigkeiten begünstigt. Vier Elemente setzen sie zusammen: Wirtschaftliche Vorsorge, politische Organisation, moralische Traditionen und das Streben nach Wissenschaft und Kunst. Sie beginnt, wo Chaos und Unsicherheit enden. Neugier und Erfindungsgeist werden frei, wenn die Angst besiegt ist, und der Mensch schreitet aus natürlichem Antrieb dem Verständnis und der Verschönerung des Lebens entgegen.“[1]
Auf der Grundlage des Hauptseminars mit dem Titel „Kulturwissenschaftliche Germanistik IX: Liebe und Freundschaft in Wissenschaft und Unterricht“ ist vorliegende Seminararbeit verfasst mit dem Ziel, kulturwissenschaftliche Aspekte des Themas Liebe und Freundschaft zu beleuchten, um dann didaktische Überlegungen anzustellen, wie es in adäquater Form im Unterricht zum Einsatz kommen kann.
Zunächst wird der Begriff Kultur aus wissenschaftlicher Sicht erläutert als Grundlage für die Sichtweise des eigentlichen Themas „Liebe und Freundschaft“, da die Definition dessen immer auch abhängig ist von der Kultur des Betrachters. Als Thema für die Unterrichtsreihe werden Ideen zur didaktischen Umsetzung gesammelt, die als Einstieg dienen könnten. Im Anschluss wird auf entsprechende Lernziele und Lernwege eingegangen, die die Schüler im Rahmen der Unterrichtsreihe erwerben sollen. In Kapitel 4 wird dann die Lektüre „Der gelbe Vogel“ vorgestellt anhand allgemeiner Informationen zum Buch und möglichen didaktischen Ansätzen zur Verwendung. Ein großer Teil nimmt das Lesetagebuch ein, das eine Methode zur Bearbeitung des Buches darstellt. Die Methode wird erläutert und auf das Thema bezogen, nennt darüber hinaus Tipps für Schüler und beinhaltet einen zu bearbeitenden Fragenkatalog.
1 Kultur(wissenschaft) – eine Definition
Das Hauptseminar „Liebe und Freundschaft in Wissenschaft und Unterricht“ fällt unter die Kategorie der kulturwissenschaftlichen Germanistik.
Kulturwissenschaft als eine hermeneutische Wissenschaft vereinigt die kulturellen Aspekte von Kunstwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Philosophie, Theologie, Psychologie und Soziologie zu einem multidisziplinären Fach. Besonderes Augenmerk legt die kulturwissenschaftliche Forschung auf die Anthropologie - des Kulturschaffens im Bezugsrahmen der jeweiligen gesellschaftlichen, historisch-politischen, literarisch-künstlerischen, ökonomischen, rechtlichen und räumlichen Bedingungen. Auch die so genannten Gender-Studies, Untersuchungen zum Verhältnis zwischen den Geschlechtern, ihrer kulturellen Geformtheit und zur Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Gesellschaft, haben seit einigen Jahren einen festen Platz innerhalb der Kulturwissenschaft.
Wird Kultur hierbei als geschlossen und komplex oder eher als prozessual und veränderbar angesehen?
Prof. Dr. rer. soc. Wolfgang Kaschuba - seit 1992 Professor für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und zugleich geschäftsführender Direktor des Instituts für Europäische Ethnologie mit Forschungsschwerpunkten Alltag und Kultur in der europäischen Moderne, nationale und ethnische Identitäten, Stadt- und Metropolenforschung[2] - definiert den Kulturbegriff in seinem Werk Kulturalismus: Vom Verschwinden des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs als „Interpretament“[3]. Somit erklärt Kultur nicht mehr einem bestimmten Gegenstand, sondern gibt vielmehr einen Blickwinkel auf gesellschaftliche Prozesse, ist also ein Deutungs-, Verständigungs- und Kommunikationsmittel. Der eröffnete Blickwinkel besteht aus Verknüpfung von Wissenschaftsperspektiven und Weltanschauung. Auch als Verständigungsmittel besitzt die Kultur(wissenschaft) zwei Seiten: Vordergründig geht es um den Erklärungsversuch sozialer Sachverhalte und Gegenstandsbedeutungen. Hintergründig findet man hier ein Deutungsmodell von Gesellschaft und Geschichte mit hohem generalisierendem Anspruch. In diesem Rahmen muss diese Funktion zentraler Gegenstand kritischer Selbstreflexion sein, die in drei Richtungen angedeutet werden kann: im Blick auf die Geschichtsschreibung, im Blick auf Fremd-Verstehen und im Blick auf den Kulturvergleich. Es geht also um eine Ideologie, eine Sichtweise und Weltanschauung.
Doch was bedeutet „Kultur“ überhaupt? Im alltagssprachlichen Sinn wird Kultur häufig gleichgesetzt mit der eigentlichen „Hochkultur“, die sich zumeist auf Musik, bildende Künste, Literatur, Tanz, Theater etc. bezieht. So zum Beispiel gibt es in Tageszeitungen eine Rubrik, die sich „Kultur“ nennt und Angebote zu kulturellen Veranstaltungen (Bühne, Museen, Festivals) und Tipps zu Literaturanschaffungen, Hörbüchern oder Vorträgen veröffentlicht. Dieser Kulturbegriff ist jedoch nur ein eingeschränkter Teil der eigentlichen Kultur. Alles, was der Mensch prägt wird quasi zur Kultur. Man benutzt Ausdrücke wie „Das Volk hat eine kulturelle Entwicklung gemacht“ oder spricht von „bürgerlicher oder rationaler Kultur“, akzeptiert Kultur als Allgemeingut durch immer verfügbare Medien und es existiert einen Fachbereich an Universitäten „Geistes- und Kulturwissenschaft
In den verschiedenen Wissenschaften wird Kultur jeweils anders definiert; etwa in den Sozialwissenschaften als ein Begriff, der vor allem die Beobachtung beinhaltet, dass menschliche Gesellschaften nicht nach den von der Natur gegebenen Regeln leben und diese Regeln in spezifischer Art und Weise an ihre Nachfahren weitergeben. Mit Kultur ist also vielmehr eine Gesamtheit der Verhaltens- konfigurationen oder auch der Symbolgehalte einer Gesellschaft gemeint.
Der Mensch als soziales Wesen ist Teil von verschiedenem alltagskulturellem Zusammenleben, was die Entwicklung von expliziten Regeln und Formen dieses Zusammenlebens voraussetzt. Es geht hierbei um „Empfindungen wie Liebe, Scham, Konkurrenz oder Treue, aber auch alltägliche Verrichtungen wie Mahlzeiten und schließlich die Sinne selbst“. (Korte/Schäfers)
Im 18. und 19. Jahrhundert – und auch teilweise noch heute – wird Kultur mit dem Begriff der Zivilisation gleichgesetzt und als Gegensatz zur Natur gesehen. In diesem Zusammenhang wurden Menschen, die keinen Bezug zur so genannten „Hochkultur“ besaßen als eher naturverbunden und unzivilisiert bezeichnet. Im gleichen Zug wurde die Hochkultur als positiv angesehen, da sie die menschliche Natur unterdrücke. Erst im späten 19. Jahrhundert entstand eine breitere Begriffsdefinition, die aus dem Gedanken herleitete, dass die Kultur ihre Wurzeln in der menschlichen Fähigkeit besäße, Versuche zu systematisieren und auszuwerten und diese Ergebnisse in schriftlicher Form festzuhalten und in Sprache weiterzugeben. Somit entspricht die Kultur der menschlichen Natur. Es wurde also notwendig, methodisch und theoretisch nützlichere Definitionen von Kultur zu entwickeln. Dabei wird grundlegend unterschieden zwischen:
- materieller Kultur und
- symbolischer Kultur (Schrift und Sprache)
Als materielle Kultur wird die gesellschaftlich geprägt Gesamtheit der Gebrauchsgegenstände, Geräte, Werkzeuge, Bauten, Kleidungs- und Schmuckstücke etc der Menschen bezeichnet. Materielles und Kultur sind ohne einander nicht denkbar. Erst durch eine Verbindung von Materiellem und Immateriellem entsteht ein Zugang zum Verstehen des Alltags verschiedenster Gesellschaften. Es kann keine Verbindung zu einem Gegenstand entstehen, wenn seine geistigen Ausdrucksformen – also Sprache und Text - nicht im Zusammenhang betrachtet werden.
Die Bedeutung und sein Gegenstand müssen stets in Zusammenhang zueinander stehen. Durch eine derartige Betrachtungsweise besteht nicht die Gefahr, dass die betrachteten Objekte als etwas Isoliertes, Abgetrenntes angesehen und somit vielleicht falsch gedeutet werden. Ein wichtiger Gesichtspunkt hierbei sind auch die sozialen Beziehungen und Handlungsweisen, in welche die Dinge des täglichen Lebens einbezogen werden.
Die heutigen Kulturindustrien besitzen zwar die Macht, Kulturwaren zu produzieren und weltweit zirkulieren zu lassen, aber es sind die Rezipienten, die im Prozess der Aneignung den Kulturobjekten erst Bedeutung zuweisen. Dies ist gerade in einer immer komplexer werdenden Welt ein entscheidender Vorgang, denn im Prozess der Vermittlung vom Produzenten zum Konsumenten ist das kulturelle Produkt verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, die die ursprüngliche Bedeutung verändern können. Es liegt also an den Rezipienten, entsprechend ihres individuellen sozialen Hintergrundes aktiv interpretativ tätig zu werden. Dies hat natürlich zur Folge, dass es unterschiedliche Deutungsvarianten gibt, die auch von sozio-kulturellen Faktoren abhängen.
2 Liebe und Freundschaft
„Liebe und Freundschaft“ kann in verschiedenen Zusammenhängen betrachtet werden, wobei Sichtweise und Definition demzufolge immer abhängig sind von Person, Tradition, historischen Hintergrund, Geschlecht und soziokulturellen Faktoren. Liebe kann als gesamtgesellschaftliches Phänomen aufgefasst werden. Niklas Luhmann hat sich in seinem 1982 erschienen Werk „Liebe als Passion: zur Codierung von Intimität“ mit einer Kommunikationstheorie beschäftigt, in deren Mittelpunkt der Begriff der Liebe steht. In diesem Zusammenhang geht es um den ‚Code’ in Intimbeziehungen, der erfolgreiches Kommunizieren und damit ‚Liebe’ überhaupt erst ermöglicht. Liebe wird nicht als Gefühl untersucht, „sondern als symbolischer Code, der darüber informiert, wie man in Fällen, wo dies eher unwahrscheinlich ist, dennoch erfolgreich kommunizieren kann. Der Code ermutigt, entsprechende Gefühle zu bilden“. Was ist richtiges, angemessenes und sachliches Verhalten in intimen Beziehungen? Was bietet Orientierung und welcher Verhaltenserwartungen existieren oder entstehen?
Liebe wird bei Luhmann als „symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium begriffen, das zur Ausmerzung von Unwahrscheinlichkeiten und zur Bildung von Systembildungsmöglichkeiten dient. Liebe ist hier kein Gefühl, sondern ein Kommunikationscode, mit dessen Hilfe Gefühle ausgedrückt werden können; Medien sind nicht Sachverhalte, sondern Kommunikationsanweisungen. Liebe ist von daher zugleich ein Verhaltensmodell, das gespielt werden kann“[4]
Mit dieser theoretischen Grundlage im Hinterkopf werde ich mich im Folgenden mit dem Thema „Liebe und Freundschaft“ im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung im Fach Deutsch beschäftigen.
2.1 Liebe und Freundschaft als Thema für die Unterrichtsreihe
2.1.1 Ideen zur didaktischen Umsetzung
Die Unterrichtsreihe „Liebe und Freundschaft“ bietet sich für eine Durchführung in einer achten oder neunten Klassen an, da hier sowohl von einer entsprechenden (geistigen, seelischen, emotionalen) Reife, als auch von ersten eigenen Erfahrungen der Schüler mit diesem Thema ausgegangen werden kann. Die Schulform spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. In den jeweiligen Lehrplänen ist ein entsprechendes Thema vorgesehen. Diese Unterrichtsreihe vereint die Vermittlung verschiedener Kompetenzen auf die später noch genauer eingegangen werden wird und ist gegebenenfalls auch für eine fächerverbindende Kooperation geeignet.
Zu Beginn der Unterrichtsreihe sollten Vorbereitungen getroffen werden, um die Schüler in die Thematik einzuführen bzw. sie für das Thema generell und Lektüre zu sensibilisieren. Wenn ein neues Unterrichtsthema interessant beginnt, ist bereits viel gewonnen. Ich stelle mir hier einen spielerischen Einstieg vor, der das Thema situativ vergegenwärtigt und einen dynamischen Anfang setzt.
2.1.2 Puzzle zum Thema „Freundschaft/Liebe“
Zur Vorbereitung werden hier mehrere Bilder mit Bezug zum Thema grob zerschnitten. Bei einer Klassengröße von 25 Schülern werden 5 Bilder in jeweils Puzzleteile zerschnitten. Das Unterrichtsvorhaben startet damit, dass jeder Schüler ein Puzzleteil blind zieht und sich auf die Suche nach den Mitschülern macht, die die passenden Puzzleteile gezogen haben. Durch das Zusammensetzen der Bilder ergeben sich auch die Arbeitsgruppen. Sind diese komplett, stellt jede Gruppe Überlegungen zu ihrem jeweiligen Bild an, die anschließend im Plenum zusammenfassend vorgetragen werden. Die jeweiligen Fragestellungen bieten Diskussionsgrundlage und Anregungen. Somit ist das Thema auf visuelle Art anschaulich und vielschichtig eröffnet worden mittels spielerischem Einstieg.
[...]
[1] Durant; William James: Kulturgeschichte der Menschheit, Frankfurt am Main/Berlin/Wien, 1981,
S. 265
[2] http://www2.hu-berlin.de/ethno/reload.html?seiten/institut/mitarbeiter/kaschuba.htm
[3] - Kaschuba, Wolfgang: Kulturalismus: Vom Verschwinden des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs. In: Berliner Journal für Soziologie 2/1994, S. 179-192
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist ein Auszug aus einer Seminararbeit zum Thema "Kulturwissenschaftliche Germanistik IX: Liebe und Freundschaft in Wissenschaft und Unterricht". Es enthält eine Definition des Kulturbegriffs, Überlegungen zur didaktischen Umsetzung des Themas Liebe und Freundschaft im Unterricht (insbesondere für die 8. oder 9. Klasse), Lernziele und Lernwege sowie eine Vorstellung der Lektüre "Der gelbe Vogel" von Myron Levoy.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, kulturwissenschaftliche Aspekte des Themas Liebe und Freundschaft zu beleuchten und didaktische Überlegungen anzustellen, wie dieses Thema in adäquater Form im Deutschunterricht eingesetzt werden kann.
Wie wird der Begriff Kultur definiert?
Der Kulturbegriff wird in Anlehnung an Wolfgang Kaschuba als "Interpretament" definiert, also als ein Deutungs-, Verständigungs- und Kommunikationsmittel, das einen Blickwinkel auf gesellschaftliche Prozesse eröffnet. Es wird zwischen materieller und symbolischer Kultur unterschieden.
Welche didaktischen Überlegungen werden zum Thema Liebe und Freundschaft angestellt?
Es werden Ideen für einen spielerischen Einstieg in das Thema vorgestellt, wie zum Beispiel ein Puzzle mit Bildern zum Thema Liebe und Freundschaft. Die Unterrichtsreihe eignet sich für die 8. oder 9. Klasse und kann fächerübergreifend gestaltet werden.
Was ist das Lesetagebuch und wie wird es im Zusammenhang mit der Lektüre "Der gelbe Vogel" eingesetzt?
Das Lesetagebuch ist eine Methode zur Bearbeitung des Buches "Der gelbe Vogel". Es enthält Hinweise und Aufgaben für Schüler, um sich intensiv mit dem Inhalt und den Themen des Buches auseinanderzusetzen. Es wird als Möglichkeit gesehen, die Schüler zur Auseinandersetzung mit dem Thema Freundschaft und Toleranz anzuregen, da das Buch sich um die Freundschaft zwischen einem jüdischen Jungen und einem autistischen Mädchen dreht.
Wer ist Niklas Luhmann und welche Rolle spielt er im Dokument?
Niklas Luhmann ist ein Soziologe, der sich in seinem Werk "Liebe als Passion" mit einer Kommunikationstheorie beschäftigt hat, in deren Mittelpunkt der Begriff der Liebe steht. Seine Theorie dient als Grundlage für die Betrachtung des Themas Liebe im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung.
Was sind die Forschungsschwerpunkte von Wolfgang Kaschuba?
Wolfgang Kaschubas Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Alltag und Kultur in der europäischen Moderne, nationale und ethnische Identitäten, Stadt- und Metropolenforschung.
- Citar trabajo
- Jennifer Lückerath (Autor), 2008, Kulturwissenschaftliche Germanistik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114284