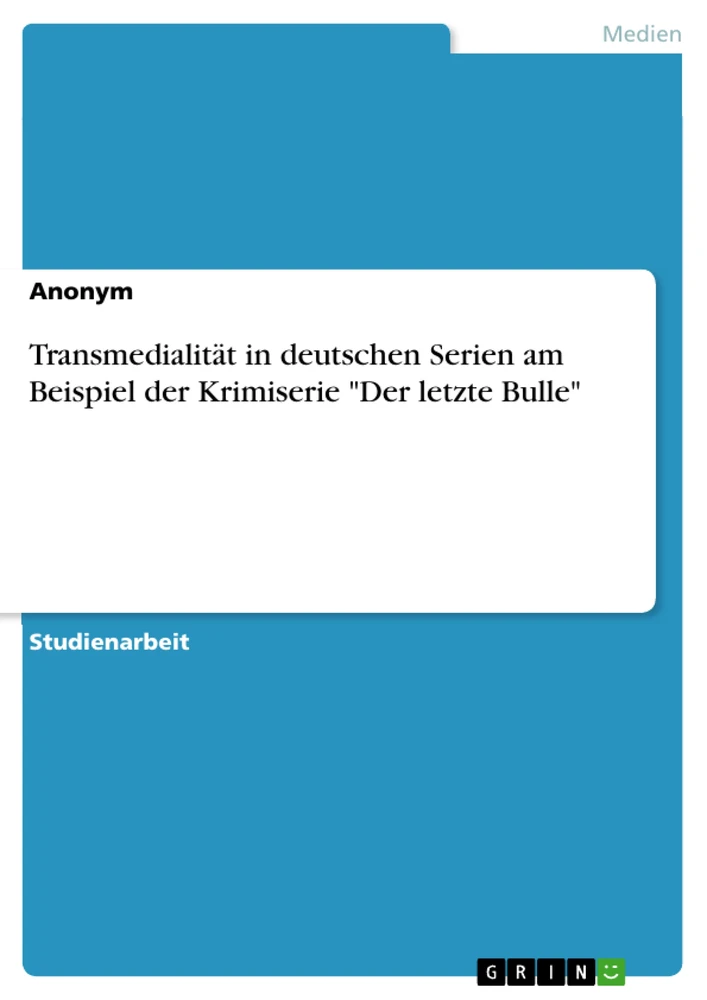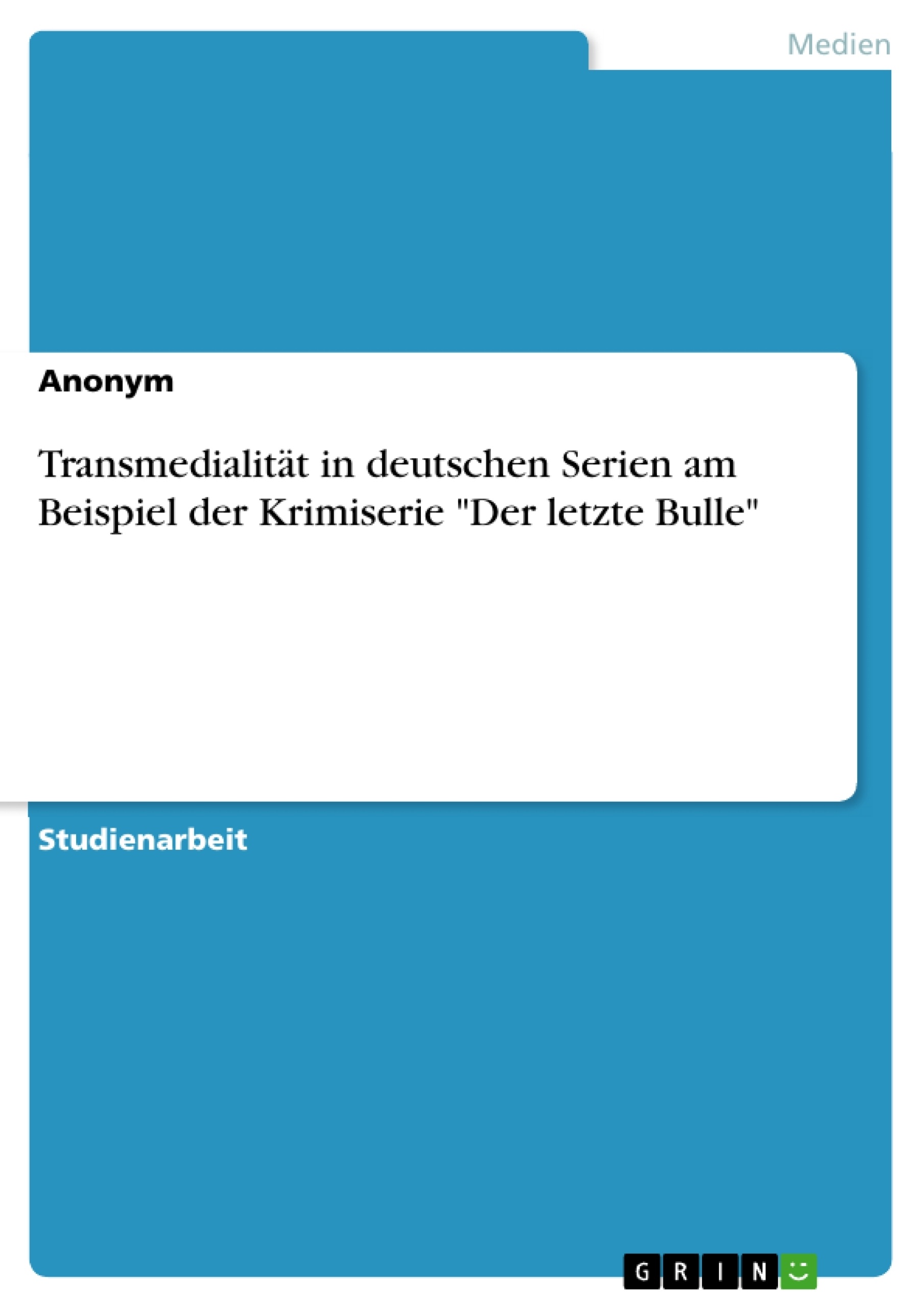Ob in Gesellschaft oder allein, wöchentlich oder täglich, Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgen regelmäßig Geschichten im Fernsehen, identifizieren sich mit ihren Protagonisten und fiebern auf die nächste Folge hin. Sie alle scheinen es zu lieben: Serien schauen. Auch wenn sich die Sehgewohnheiten der Zuschauer in den letzten Jahrzehnten geändert haben, die Faszination für das alltägliche Serienvergnügen scheint ungebrochen.
Dennoch lassen sich im Vergleich früherer und heutiger TV-Serien Veränderungen feststellen. Individualisierung, Kommerzialisierung und Globalisierung führen zu einer zunehmenden Medienkonvergenz, bei der viele, früher noch klar getrennte Kanäle mehr und mehr zusammenwachsen, sowohl auf technischer, aber auch auf inhaltlicher Ebene. Die Serienrezeption verlagert sich nicht nur auf das Internet, sondern auf alles, was geboten wird. TV-Serien versuchen die wachsende Vielfalt der Medienlandschaft zu nutzen, um ihre Geschichten über Mediengrenzen hinweg zu verbreiten, zu erweitern und weiterzuerzählen. Doch diese komplexe Erzählweise namens Transmedia Storytelling aus den USA findet man in deutschen Serienproduktionen nach wie vor selten.
Aus diesem Grund versucht die vorliegende Arbeit anhand einer deutschen Beispielserie zu klären, inwieweit das Phänomen der Transmedialität auch in Deutschland bereits angekommen ist. Es wird die Frage beantwortet, wie und zu welchem Zweck transmediales Erzählen in deutschen Serien eingesetzt wird.
Hierzu wird zunächst versucht, den Begriff des Transmedia Storytellings beziehungsweise des transmedialen Erzählens zu definieren, bevor näher darauf eingegangen wird, wie die Einbeziehung verschiedener Medienkanäle im Serienkontext bisher genutzt wird und welchen Zweck sie verfolgt. Um deutlich zu machen, wie dieses Verfahren im Hinblick auf TV-Serien auch in Deutschland umgesetzt wird, wird im Anschluss der Einsatz verschiedener Medien im Rahmen der erfolgreichen deutschen Krimiserie "Der letzte Bulle" untersucht. Hierzu werden nach einer kurzen Vorstellung des Formats die Darstellungsformen, die Erzählstrategien sowie die Ereignisstrukturen der TV-Serie selbst, der ergänzenden Webserie sowie der erschienenen Buchausgabe näher betrachtet, um zu klären, welche Funktion die verschiedenen Medien für die Serie erfüllen. Abschließend folgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse sowie ein Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Serialität in Zeiten der Medienkonvergenz
- Transmedialität
- Definition von Transmedialität und Transmedia Storytelling
- Funktion von transmedialem Erzählen
- Transmediales Erzählen im Serienkontext
- Verwendung von Transmedialität in der Serie „Der letzte Bulle“
- Kurzvorstellung der Serie
- Analyse der Medienprodukte nach Darstellungsform, Erzählstrategien und Ereignisstrukturen
- TV-Serie
- Webserie
- Buch
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Transmedialität in deutschen Fernsehserien am Beispiel der Krimiserie „Der letzte Bulle“. Die Zielsetzung besteht darin, die Funktionen und den Zweck transmedialen Erzählens in diesem spezifischen Kontext zu analysieren und zu beleuchten, inwiefern sich deutsche Produktionen von internationalen Beispielen unterscheiden.
- Serialität im Kontext der Medienkonvergenz
- Definition und Abgrenzung von Transmedialität, Intermedialität und Crossmedialität
- Transmediales Erzählen im Serienkontext und dessen Funktionen
- Analyse der Transmedialität in „Der letzte Bulle“ über verschiedene Medienplattformen (TV-Serie, Webserie, Buch)
- Bewertung des Erfolgs und der Auswirkungen transmedialer Erzählstrategien in deutschen Serien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Serialität in Zeiten der Medienkonvergenz: Dieses Kapitel beleuchtet die anhaltende Popularität von Fernsehserien trotz veränderter technischer Voraussetzungen und Sehgewohnheiten. Es thematisiert die zunehmende Medienkonvergenz und den damit verbundenen Wandel in der Serienrezeption, die sich nicht mehr auf das Fernsehen beschränkt, sondern auf diverse Plattformen ausdehnt. Die wachsende Komplexität der Erzählweisen in Serien und die zunehmende Nutzung von Transmedia Storytelling, insbesondere in US-amerikanischen Produktionen, werden hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern diese Entwicklungen auch deutsche Serienproduktion beeinflussen.
2. Transmedialität: Das Kapitel bietet eine theoretische Einführung in den Begriff der Transmedialität und grenzt ihn von verwandten Begriffen wie Intermedialität und Crossmedialität ab. Es definiert Transmedia Storytelling nach Henry Jenkins und erläutert dessen Kernprinzipien: die systematische Verteilung von fiktionalen Elementen über verschiedene Kanäle, die Schaffung einer umfassenden „Storyworld“ und die Einbeziehung der Rezipienten durch interaktive Elemente und die Bildung von Communities. Die Bedeutung der „convergence culture“ im Kontext des Transmedia Storytelling wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Transmedialität, Transmedia Storytelling, Medienkonvergenz, Fernsehserien, „Der letzte Bulle“, Intermedialität, Crossmedialität, Serienanalyse, Erzählstrategien, Medienplattformen, Rezipienten, Convergence Culture.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Transmedialität in der deutschen Fernsehserie "Der letzte Bulle"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einsatz von Transmedialität in der deutschen Fernsehserie "Der letzte Bulle". Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Funktionen und des Zwecks transmedialen Erzählens in diesem spezifischen Kontext und einem Vergleich mit internationalen Produktionen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Serialität im Kontext der Medienkonvergenz, die Definition und Abgrenzung von Transmedialität, Intermedialität und Crossmedialität, transmediales Erzählen im Serienkontext und dessen Funktionen, sowie eine Analyse der Transmedialität in "Der letzte Bulle" über verschiedene Medienplattformen (TV-Serie, Webserie, Buch). Zusätzlich wird der Erfolg und die Auswirkungen transmedialer Erzählstrategien in deutschen Serien bewertet.
Welche Medienprodukte der Serie "Der letzte Bulle" werden untersucht?
Die Analyse umfasst die TV-Serie, die Webserie und das Buch zu "Der letzte Bulle". Die Untersuchung betrachtet die Darstellungsform, Erzählstrategien und Ereignisstrukturen dieser verschiedenen Medienprodukte.
Wie wird Transmedialität in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert Transmedia Storytelling nach Henry Jenkins und erläutert dessen Kernprinzipien: die systematische Verteilung von fiktionalen Elementen über verschiedene Kanäle, die Schaffung einer umfassenden „Storyworld“ und die Einbeziehung der Rezipienten durch interaktive Elemente und die Bildung von Communities. Die Bedeutung der „convergence culture“ im Kontext des Transmedia Storytelling wird ebenfalls diskutiert. Die Arbeit grenzt Transmedialität zudem von Intermedialität und Crossmedialität ab.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Serialität in Zeiten der Medienkonvergenz, Transmedialität (mit Definition und Abgrenzung verwandter Begriffe), der Verwendung von Transmedialität in der Serie "Der letzte Bulle" (inkl. Einzelanalysen der verschiedenen Medienprodukte) und Schlussfolgerungen/Ausblick.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Transmedialität, Transmedia Storytelling, Medienkonvergenz, Fernsehserien, „Der letzte Bulle“, Intermedialität, Crossmedialität, Serienanalyse, Erzählstrategien, Medienplattformen, Rezipienten, Convergence Culture.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktionen und den Zweck transmedialen Erzählens in der Serie "Der letzte Bulle" zu analysieren und zu beleuchten, inwiefern sich deutsche Produktionen von internationalen Beispielen unterscheiden. Sie untersucht, wie Transmedialität in der Serie eingesetzt wird und welche Auswirkungen dies hat.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Transmedialität in deutschen Serien am Beispiel der Krimiserie "Der letzte Bulle", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1142551